| Paulas Törnberichte | 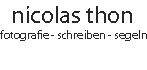 |
|||||
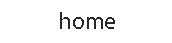 |
 |
 |
 |
 |

|
|
|
|
||||||

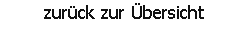
Die kurze Anna
Der Große Belt ist diesig und wolkenverhangen.
Musholm verliert sich im Dunst. Die „Kurze Anna“
ist
längst nicht mehr zu erkennen. Während die kaum
merkliche
Brise von West über Nord auf Nordost drehte, ließ
ich das morgendliche Ambiente auf
mich wirken. Was es bedeutet, allein mit seinem Boot
unterwegs zu sein in einer großen, weiten,
prächtigen Welt, von der man nichts sieht außer
einigen Kabellängen platten Wassers in direkter Umgebung,
gleichwohl vorangetrieben von einer Woge der Begeisterung - das
lässt sich nicht in verständliche Worte fassen. Man
muss es erleben.
September 2017
 Die
gute Seemannschaft erfordert es, dass ich
mir Gedanken mache. Knapp drei Meilen voraus liegt Weg Tango, der
Tiefwasserweg durch den Großen Belt. Dort hat die
Großschifffahrt Vorrang. So lange ich weder die
Brücke noch die Betonnung sehe, ist er für mich ein
Paar Wegpunkte auf dem GPS: Einer, wo wir in Weg T einlaufen. Ein
zweiter an der Stelle, wo wir ihn wieder verlassen. Beide liegen auf
einer Kurslinie zur Westbrücke. Eine halbe Seemeile diesseits
und jenseits der Mitte des Tiefwasserwegs markieren die Wegpunkte
jeweils einen Schluck Wasser. Reduktion auf das Einfache und
Wesentliche, könnte man sagen. Aber in Anbetracht von
Frachtern und Tankern, die mit zwanzig Knoten unseren Kurs kreuzen
könnten, erscheint es mir auf unbefriedigende Weise abstrakt.
Die
gute Seemannschaft erfordert es, dass ich
mir Gedanken mache. Knapp drei Meilen voraus liegt Weg Tango, der
Tiefwasserweg durch den Großen Belt. Dort hat die
Großschifffahrt Vorrang. So lange ich weder die
Brücke noch die Betonnung sehe, ist er für mich ein
Paar Wegpunkte auf dem GPS: Einer, wo wir in Weg T einlaufen. Ein
zweiter an der Stelle, wo wir ihn wieder verlassen. Beide liegen auf
einer Kurslinie zur Westbrücke. Eine halbe Seemeile diesseits
und jenseits der Mitte des Tiefwasserwegs markieren die Wegpunkte
jeweils einen Schluck Wasser. Reduktion auf das Einfache und
Wesentliche, könnte man sagen. Aber in Anbetracht von
Frachtern und Tankern, die mit zwanzig Knoten unseren Kurs kreuzen
könnten, erscheint es mir auf unbefriedigende Weise abstrakt.
Die Sicht reicht definitiv nicht, um eine sichere, niemanden
behindernde oder gefährdende Passage zu
gewährleisten. Ich ziehe in Erwägung, mich
über Funk bei Great Belt Traffic zu vergewissern, dass die
Bahn frei ist. Nehme das Smartphone, werfe bei shipspotter.de einen
Blick auf die AIS-gestützte Verkehrslage. Als ich diesen Blick
aktualisieren will, reicht die Netzqualität nicht mehr aus,
die Seite neu zu laden (inzwischen ist sie zur Baustelle
degeneriert...).
Dann kommen sie im gleichen Moment: Der Regen und der Wind. Der Wind
bewirkt, dass Paula nun mit guten fünf Knoten losrennt. Der
Regen wäscht die Nebeltropfen aus der Luft und sorgt
vorläufig für erheblich verbesserte Sicht. Ich
erkenne einen Frachter, der von Süden kommend zwei Meilen vor
uns durchgeht. Und einen zweiten, der von Norden kommt. Gemeinsam
markieren sie Weg T viel anschaulicher als zwei GPS-Wegpunkte. Ich
nehme den Fockausbaumer weg, Paula luvt an. Sie saust aufs Heck des
näher kommenden Schiffes zu, dessen Konturen deutlicher und
deutlicher werden. Als wir ihn querab haben, halten wir direkt auf ihn
zu. Hastig entweicht er unserer Reichweite. Und als ich nicht nur sein
Heck, sondern auch seine Steuerbordseite sehe, weiß ich: Weg
T ist gequert, sicher und problemlos. Paula geht wieder auf Kurs.
 Die Westbrücke, kaum fünf
Meilen entfernt und gestern noch in voller Größe und
Pracht zu sehen, zeigt sich schemenhaft, verschwindet wieder, zeigt
sich erneut. Irgendwann ist Betonnung erkennbar, dann auch die
Durchfahrt in der Mitte der Brücke. Wir sind nicht auf diese
Durchfahrt angewiesen - elf Meter Masthöhe passen auch durch
westlichere Segmente. Die Ausrichtung der Brücke, der Seegang,
der inzwischen ganz enorme Speed sowie die erhebliche Strömung
sorgen dafür, dass wir letzten Endes mit ausgebaumter Fock auf
Am-Wind-Kurs durch die Brücke segeln. Das ist ein bisschen
knifflig, aber es geht. Es geht überhaupt so gut wie alles,
wenn Paula und ich unterwegs sind. Ich kann sogar für den
kurzen Moment des Hindurchrauschens die Schönheit
genießen, mit der das Regenwasser von der Straße
zwischen den Brückenpfeiler hinunterplätschert.
Die Westbrücke, kaum fünf
Meilen entfernt und gestern noch in voller Größe und
Pracht zu sehen, zeigt sich schemenhaft, verschwindet wieder, zeigt
sich erneut. Irgendwann ist Betonnung erkennbar, dann auch die
Durchfahrt in der Mitte der Brücke. Wir sind nicht auf diese
Durchfahrt angewiesen - elf Meter Masthöhe passen auch durch
westlichere Segmente. Die Ausrichtung der Brücke, der Seegang,
der inzwischen ganz enorme Speed sowie die erhebliche Strömung
sorgen dafür, dass wir letzten Endes mit ausgebaumter Fock auf
Am-Wind-Kurs durch die Brücke segeln. Das ist ein bisschen
knifflig, aber es geht. Es geht überhaupt so gut wie alles,
wenn Paula und ich unterwegs sind. Ich kann sogar für den
kurzen Moment des Hindurchrauschens die Schönheit
genießen, mit der das Regenwasser von der Straße
zwischen den Brückenpfeiler hinunterplätschert.
Hinter dem Monstrum von Brücke ist kaum Wind. Für ein
paar Hundert Meter ist das normal, die Pfeiler verwirbeln Luft- und
Wasserströmung. Doch die Brise berappelt sich nicht wieder,
und auch der Regen hört auf - die Brücke ist auch
eine Wetterscheide. Ich beschließe, aus Erfahrung klug
geworden, es heute nicht zu übertreiben: Der nächste
Hafen ist Nyborg. Wir haben drei Tage Zeit für neunzig Meilen
Rückweg - heute sollen zwanzig genügen.
 Nachdem
das geklärt ist, denke ich nach
über die Steigerung des Adjektivs
„intensiv“. Als „intensiv“
beschreibe ich fast alle unsere Reisen. Weil es zutrifft. Aber diese
sechs Tage, längst ist das unzweifelhaft, ragen noch wieder
heraus aus dem grandiosen Rest. Wenn ich immer das gleiche Wort
verwende, fangen die Leser an zu gähnen und vermuten, dass
auch ich es tue. Und alsbald die Lust verliere. Doch das Gegenteil ist
der Fall, und dafür fehlen mir die Worte.
Nachdem
das geklärt ist, denke ich nach
über die Steigerung des Adjektivs
„intensiv“. Als „intensiv“
beschreibe ich fast alle unsere Reisen. Weil es zutrifft. Aber diese
sechs Tage, längst ist das unzweifelhaft, ragen noch wieder
heraus aus dem grandiosen Rest. Wenn ich immer das gleiche Wort
verwende, fangen die Leser an zu gähnen und vermuten, dass
auch ich es tue. Und alsbald die Lust verliere. Doch das Gegenteil ist
der Fall, und dafür fehlen mir die Worte.
Ich ziehe kurz eine physikalische Definition in Erwägung. Doch
ein psychologisches Phänomen wie die Intensität, mit
der eine bestimmte Person ein bestimmtes Erlebnis erlebt, in
naturwissenschaftlicher Präzision zu messen, ist nicht
einfach. Zu viel hängt ab von den vorigen Erfahrungen der
Person: Ein Skippertraining, das neben zwei, drei
Anlegemanövern einen Segelschlag von Arnis nach Kappeln
beinhaltet, führt bei Segelanfängern, die bisher
Jolle und Mitsegeln kennen und sich nun auf ihren ersten
eigenverantwortlichen Folkeboottörn vorbereiten, zur abrupten
Erschöpfung der Aufnahmefähigkeit und wird ihnen ewig
im Gedächtnis bleiben. Das ist allemal zu einhundert Prozent
intensiv. Mir und Paula muss Anderes geboten werden. Die
Intensität der Wahrnehmung hängt aber auch ab von der
individuellen Bereitschaft, Neues und Großartiges
überhaupt zu erkennen. Anzuerkennen. Zu genießen.
Statt also Intensität mit einer Formel zu berechnen, die
Windgeschwindigkeit, Sichtweite, Pulsfrequenz, Hormonausstoß,
zurückgelegte Strecke und ähnliche Faktoren
beinhaltet, erstmals erreichte Territorien berücksichtigt, mit
der Anzahl gelungener Anlegemanöver potenziert und durch die
Zahl der Segeltage dividiert wird, und die am Ende die
Maßeinheit „Paula“ trägt - statt
dessen beschränke ich mich auf die Vorsilben für die
Zehnerpotenzen jener Maßeinheit.
 Kilopaula, Megapaula, Gigapaula. 1000 Paula.
1.000.000 Paula. Und so weiter. Der Jungendslang lässt die
Maßeinheit weg und war vor einigen Jahren schon an dem Punkt,
zu sagen: „Das ist mega!“ Jenseits des Giga ist das
Terra von der Kapazität von Festplatten bekannt. Also sage
ich: Der Törn war nicht einfach intensiv - er war
terraintensiv. Denn Terra - die Erde - führt uns geradeaus zum
Wesentlichen zurück: Wenn der richtige Mensch und das passende
Boot zusammen unterwegs ist, hält jeder Quadratmeter ihrer
Oberfläche ein Quantum Glück für ihn bereit.
Kilopaula, Megapaula, Gigapaula. 1000 Paula.
1.000.000 Paula. Und so weiter. Der Jungendslang lässt die
Maßeinheit weg und war vor einigen Jahren schon an dem Punkt,
zu sagen: „Das ist mega!“ Jenseits des Giga ist das
Terra von der Kapazität von Festplatten bekannt. Also sage
ich: Der Törn war nicht einfach intensiv - er war
terraintensiv. Denn Terra - die Erde - führt uns geradeaus zum
Wesentlichen zurück: Wenn der richtige Mensch und das passende
Boot zusammen unterwegs ist, hält jeder Quadratmeter ihrer
Oberfläche ein Quantum Glück für ihn bereit.
 Dyreborg, 31. August: Paula und ich
genießen die Sonne. Das haben wir uns verdient nach
eineinhalb klaglos ertragenen Tagen mit mehr oder weniger Dauerregen.
Ein weiterer wunderbar prima gelungener Anleger unter Segeln bedeutet,
dass wir seit Kappeln, also seit fünf Tagen, den
Außenborder nicht mehr benötigt haben. Und weil wir
ein bisschen mit den befreundeten Großen aus dem Kappelner
Museumshafen um die Wette segeln, haben wir heute einen Logenplatz.
Dyreborg, 31. August: Paula und ich
genießen die Sonne. Das haben wir uns verdient nach
eineinhalb klaglos ertragenen Tagen mit mehr oder weniger Dauerregen.
Ein weiterer wunderbar prima gelungener Anleger unter Segeln bedeutet,
dass wir seit Kappeln, also seit fünf Tagen, den
Außenborder nicht mehr benötigt haben. Und weil wir
ein bisschen mit den befreundeten Großen aus dem Kappelner
Museumshafen um die Wette segeln, haben wir heute einen Logenplatz.
 Amazone
bemüht sich, eine vor
Avernakø festgekommene Yacht freizuschleppen. Das
haben wir im Blick - wobei es so aussieht, als sei es eine schwierige
Prozedur, weil sich das Schiff zwei Stunden lang nicht von der Stelle
bewegt. Endlich begreife ich, dass der Grundsitzer längst im
Hafen liegt, Amazone vor Anker. Ebenso im Blick hatten wir Fionia und
ein weiteres dänisches Schiff, die beide von Faaborg Richtung
Lyöö unterwegs waren. Als dann Fionia über
Funk die Fortuna vergeblich rief, konnte das nur bedeuten: Fortuna
liegt bereits auf Lyöö, die Dänen wollten
irgendwas bezüglich des Anlegens klären, aber Fortuna
hatte die Funke bereits aus. Leider auch der Bootsmann sein Handy,
sonst hätte ich helfend eingreifen können.
Amazone
bemüht sich, eine vor
Avernakø festgekommene Yacht freizuschleppen. Das
haben wir im Blick - wobei es so aussieht, als sei es eine schwierige
Prozedur, weil sich das Schiff zwei Stunden lang nicht von der Stelle
bewegt. Endlich begreife ich, dass der Grundsitzer längst im
Hafen liegt, Amazone vor Anker. Ebenso im Blick hatten wir Fionia und
ein weiteres dänisches Schiff, die beide von Faaborg Richtung
Lyöö unterwegs waren. Als dann Fionia über
Funk die Fortuna vergeblich rief, konnte das nur bedeuten: Fortuna
liegt bereits auf Lyöö, die Dänen wollten
irgendwas bezüglich des Anlegens klären, aber Fortuna
hatte die Funke bereits aus. Leider auch der Bootsmann sein Handy,
sonst hätte ich helfend eingreifen können.
Heute war wirklich alles dabei: Grau in Grau, Regen, Fockausbaumer.
Beim Ablegen - Paula hing nur an einer Vorleine, das Groß war
schon halb oben - noch schnell ein Buch verkauft und mir die Klagen
eines Nyborger Frührentners angehört, der den
Bürgermeister nicht mag und seinen Arzt verklagen will. Im
Svendborgsund die Brücke passiert, eine halbe Stunde bevor der
Strom kenterte. Dann riss nach eineinhalb Tagen die Wolkendecke auf,
der Wind drehte auf West, wir hoppelten ohne Druck in den Segeln in
einer enormen Welle, und ich hatte ein Fragezeichen auf der Stirn. Eine
Geduldsprobe später sah ich in der Nachmittagssonne die
Schaumkronen auf uns zurollen. Und Sekunden später befanden
wir uns in einer packenden Kreuz. Paula erledigte ihren Part wie immer
stoisch, souverän und schnell.
 Ich
muss zugeben, dass es mit dem Kreuz so eine
Sache ist: Beim Ankeraufholen in Troense stach mich dort ein Schmerz,
der mir seitdem einen Ausblick darauf gibt, wie das Segeln im Alter
sein wird. Ergebnis: Immer gut mit den Händen
abstützen. Langsam machen. Geht schon. Ein bisschen
sommerliche Wärme wäre hilfreich, aber die ist
für heute Abend ja geregelt. Ansonsten ist zu diesem
medizinischen Problem zu sagen: Solange es
dödelig-dümpelig vor sich hin läuft, tut
jede Bewegung ein bisschen weh. Wenn es gilt, an den Schoten zu
reißen, den Wellen zu trotzen, nebenbei den richtigen Weg
zwischen Tonnen und Untiefen zu finden und schließlich Paula
sanft und sicher an ihren Liegeplatz zu steuern, ist der
Rücken kein Problem.
Ich
muss zugeben, dass es mit dem Kreuz so eine
Sache ist: Beim Ankeraufholen in Troense stach mich dort ein Schmerz,
der mir seitdem einen Ausblick darauf gibt, wie das Segeln im Alter
sein wird. Ergebnis: Immer gut mit den Händen
abstützen. Langsam machen. Geht schon. Ein bisschen
sommerliche Wärme wäre hilfreich, aber die ist
für heute Abend ja geregelt. Ansonsten ist zu diesem
medizinischen Problem zu sagen: Solange es
dödelig-dümpelig vor sich hin läuft, tut
jede Bewegung ein bisschen weh. Wenn es gilt, an den Schoten zu
reißen, den Wellen zu trotzen, nebenbei den richtigen Weg
zwischen Tonnen und Untiefen zu finden und schließlich Paula
sanft und sicher an ihren Liegeplatz zu steuern, ist der
Rücken kein Problem.
So soll es ja auch sein - dies ist unser erster Urlaub dieses Jahr -
hurra! Soll heißen: Nach neunhundert Seemeilen
„Dienstreisen“ in Begleitung der Charterboote
dürfen Paula und ich endlich einmal tun und lassen, was wir
wollen. Eine Flottille ist träge: Wenn wir morgens ein
bestimmtes Ziel verabredet und uns navigatorisch darauf vorbereitet
haben, bedarf es guter Gründe, per Funk eine Änderung
zu verordnen, und wenn diese eine Änderung verbindlich
verabredet ist, muss dabei dann auch bleiben. Jetzt können wir
ablegen, ohne zu wissen, wo wir letztlich anlegen werden - mal sehen,
was der Wind so bringt. Und es beweist sich, was ich stets behaupte:
Kein Segeltag vergeht ohne Überraschungen.
 Wir
hatten ein vages Ziel, das wir auch
erreichten: Nachdem es mir im Juli dort so gut gefiel, wollte ich gerne
dieses Jahr nochmal nach Musholm. Ihr wisst schon: „Es ist
schrecklich da! Da gibt es NICHTS!“ Erstmal krankte der
Samstag daran, dass die letzten Charterer erst nachmittags kamen, sowie
an der beharrlichen Flaute. Letztlich passte das ganz gut zusammen, es
wäre ja eh kein Schlag nach Dänemark drin gewesen:
Schwach umlaufend nennt der Seewetterbericht die schlappen 1-2 Beaufort
aus wechselnden Richtungen. Björn, mit Jane gerade aus dem
Urlaub zurück, lud zum abendlichen Grillen ein.
Wir
hatten ein vages Ziel, das wir auch
erreichten: Nachdem es mir im Juli dort so gut gefiel, wollte ich gerne
dieses Jahr nochmal nach Musholm. Ihr wisst schon: „Es ist
schrecklich da! Da gibt es NICHTS!“ Erstmal krankte der
Samstag daran, dass die letzten Charterer erst nachmittags kamen, sowie
an der beharrlichen Flaute. Letztlich passte das ganz gut zusammen, es
wäre ja eh kein Schlag nach Dänemark drin gewesen:
Schwach umlaufend nennt der Seewetterbericht die schlappen 1-2 Beaufort
aus wechselnden Richtungen. Björn, mit Jane gerade aus dem
Urlaub zurück, lud zum abendlichen Grillen ein.
Der Sonntag krankte natürlich an den Nachwehen des Grillens,
Björn und ich konnten ja nicht früh zu Bett gehen,
nachdem wir wochenlang reichlich gesegelt waren, uns aber kaum gesehen
hatten, und auch die Regatta in Svendborg noch einmal diskutieren
mussten. Paula und ich schafften dann immerhin die
Zwölfuhrbrücke. Die Schlei nervte mit Abdeckung,
Winddrehern und quälend langsamer Fahrt - kaum waren wir am
Leuchtturm vorbei, begann die eigentliche Reise mit satten
fünf Knoten.
Ursprünglich war ich der Meinung, es deutlich über
Marstal hinaus schaffen zu müssen - da dachte ich aber auch
noch, ich müsse am Donnerstag zurück. Doch den
Samstag hatte ich genutzt, Frieda und Salty, die nichts zu fahren
hatten, segelklar für die nächsten Gäste zu
machen. Der Freitag stand also zur Verfügung als letzter
Reisetag. Und als wir dann bei Nordwest 4-5 die Rinne aufkreuzten,
hatte ich richtig Lust auf Marstal. Wir waren da, man höre und
staune, auch erst ein einziges Mal dieses Jahr - und wenn es einen
Hafen gibt, der mit Paula, mir, der Jonas, ersten Segelerfahrungen und
bleibenden Eindrücken zu tun hat, ist es Marstal.
 Fortuna
und Amazone gesellten sich zu uns,
reichlich bekannte Gesichter aus Traditionsseglervergangenheit und
-gegenwart, doch den Abend verbrachte ich anderweitig: Niels und Heike
Springer von CO-Segel saßen bei Fru Berg und luden mich zum
Biertrinken ein. Seit Jahren bin ich dort Kunde, laufe Niels auch immer
wieder in Arnis über den Weg oder lasse mir von ihm einen Satz
gebrauchte Segel vermitteln - aber so richtig miteinander gesprochen
hatten wir vorher eigentlich nicht. Das war also die
Überraschung am ersten Tag.
Fortuna
und Amazone gesellten sich zu uns,
reichlich bekannte Gesichter aus Traditionsseglervergangenheit und
-gegenwart, doch den Abend verbrachte ich anderweitig: Niels und Heike
Springer von CO-Segel saßen bei Fru Berg und luden mich zum
Biertrinken ein. Seit Jahren bin ich dort Kunde, laufe Niels auch immer
wieder in Arnis über den Weg oder lasse mir von ihm einen Satz
gebrauchte Segel vermitteln - aber so richtig miteinander gesprochen
hatten wir vorher eigentlich nicht. Das war also die
Überraschung am ersten Tag.
 Das
gemeinsame Reisen von See-Ewer und Folkeboot
holten wir am flautendödeligen Montag nach, indem wir kurz
nach Amazone ausliefen. Beide hatten wir als grobe Richtung das
Rudkööbing Lööb genannt, wohin es
letztlich gehen sollte, war offen. Wir überholten Amazone nach
einer Weile, sogar in Lee, weil das schwere Schiff ohne richtig Druck
in den Segeln alle Mühe hatte, sich der seitlichen
Strömung zu widersetzten und ins Fahrwasser zurück zu
segeln. In der anschließenden Flaute trieben wir, und Paula
bekam ihr Deck gewaschen, während Amazone vorbeituckerte. Als
dann wieder Wind war, zogen wir mit respektablen vier Knoten erneut
vorbei. „Wo wollt ihr denn hin?“ rief ich
rüber. Sönke meinte nur, Lohals sei wohl zu weit, und
ich hatte mich inzwischen mit Paula auf Troense verständigt.
„Auch ne Idee“, fand Sönke. Wir ankerten
schließlich im Pilekrog, und das ist immer spannend, weil man
in der alle sechs Stunden kenternden Strömung liegt anstatt im
Wind. Der Anker kam hinterher blitzsauber und kopfüber auf,
von seiner Kette mehrfach umwickelt, hatte also nur durch sein Gewicht
gehalten. Amazone lag am Anleger von Ausflugsdampfer Helge,
für den Klönschnack musste ich also rudern.
Das
gemeinsame Reisen von See-Ewer und Folkeboot
holten wir am flautendödeligen Montag nach, indem wir kurz
nach Amazone ausliefen. Beide hatten wir als grobe Richtung das
Rudkööbing Lööb genannt, wohin es
letztlich gehen sollte, war offen. Wir überholten Amazone nach
einer Weile, sogar in Lee, weil das schwere Schiff ohne richtig Druck
in den Segeln alle Mühe hatte, sich der seitlichen
Strömung zu widersetzten und ins Fahrwasser zurück zu
segeln. In der anschließenden Flaute trieben wir, und Paula
bekam ihr Deck gewaschen, während Amazone vorbeituckerte. Als
dann wieder Wind war, zogen wir mit respektablen vier Knoten erneut
vorbei. „Wo wollt ihr denn hin?“ rief ich
rüber. Sönke meinte nur, Lohals sei wohl zu weit, und
ich hatte mich inzwischen mit Paula auf Troense verständigt.
„Auch ne Idee“, fand Sönke. Wir ankerten
schließlich im Pilekrog, und das ist immer spannend, weil man
in der alle sechs Stunden kenternden Strömung liegt anstatt im
Wind. Der Anker kam hinterher blitzsauber und kopfüber auf,
von seiner Kette mehrfach umwickelt, hatte also nur durch sein Gewicht
gehalten. Amazone lag am Anleger von Ausflugsdampfer Helge,
für den Klönschnack musste ich also rudern.
 Neuer Tag, neuer Wind, alter Tatendrang trotz
stechendem Schmerz: Wir kreuzten aus dem Svendborg Sund, als noch kein
anderes Boot unterwegs war. Nordwärts lief es mal
mäßig, mal gut, nie exzellent, doch wir hatten genug
Zeit. Hinter der Store Belt Bro rannte Paula mit gut fünf
Knoten über den Tiefwasserweg, und kurz nach vier legten wir
in Musholm an. Wir hatten die Insel nicht ganz für uns
alleine, ein dänisches Ehepaar lag am Steg, eine
große Yacht ging an die nächste Mooring, aber ruhig
und idyllisch wie gewünscht war es allemal. Zwischen
Mittagsstunde und Kochen war Zeit für einen ausgiebigen
Landgang. Und dabei stellte ich fest: Musholm ist das bessere
Helgoland. Nunja - wer gerne Zollfrei Schnaps kauft, ist hier falsch.
Und Helgoland ist aus Sandstein, Musholm aus sandigem Lehm. Es wird
wohl nicht mehr ewig den Herbststürmen trotzen. Aber analog
zur „Langen Anna“, die den Deutschen an sich so
viel bedeutet, gibt es auf Musholm eine mindestens genauso
hübsche, völlig unterbewertete, wunderbar lehmige
„Kurze Anna“. Die physikalischen - oder soll ich
sagen: gemomorphologischen - Prozesse sind jedenfalls die Gleichen.
Abgesehen davon ist Musholm einfach schön, und es ist dicht am
Meer, in Sichtweise eines technokratischen Monsters wie der Store Belt
Bro, steht in markantem Kontrast zu ihr, lässt das Herz jedes
Ruhesuchenden höher schlagen, gar nicht zu reden vom Herz
eines Einhandseglers, den es hier her verschlagen hat.
Neuer Tag, neuer Wind, alter Tatendrang trotz
stechendem Schmerz: Wir kreuzten aus dem Svendborg Sund, als noch kein
anderes Boot unterwegs war. Nordwärts lief es mal
mäßig, mal gut, nie exzellent, doch wir hatten genug
Zeit. Hinter der Store Belt Bro rannte Paula mit gut fünf
Knoten über den Tiefwasserweg, und kurz nach vier legten wir
in Musholm an. Wir hatten die Insel nicht ganz für uns
alleine, ein dänisches Ehepaar lag am Steg, eine
große Yacht ging an die nächste Mooring, aber ruhig
und idyllisch wie gewünscht war es allemal. Zwischen
Mittagsstunde und Kochen war Zeit für einen ausgiebigen
Landgang. Und dabei stellte ich fest: Musholm ist das bessere
Helgoland. Nunja - wer gerne Zollfrei Schnaps kauft, ist hier falsch.
Und Helgoland ist aus Sandstein, Musholm aus sandigem Lehm. Es wird
wohl nicht mehr ewig den Herbststürmen trotzen. Aber analog
zur „Langen Anna“, die den Deutschen an sich so
viel bedeutet, gibt es auf Musholm eine mindestens genauso
hübsche, völlig unterbewertete, wunderbar lehmige
„Kurze Anna“. Die physikalischen - oder soll ich
sagen: gemomorphologischen - Prozesse sind jedenfalls die Gleichen.
Abgesehen davon ist Musholm einfach schön, und es ist dicht am
Meer, in Sichtweise eines technokratischen Monsters wie der Store Belt
Bro, steht in markantem Kontrast zu ihr, lässt das Herz jedes
Ruhesuchenden höher schlagen, gar nicht zu reden vom Herz
eines Einhandseglers, den es hier her verschlagen hat.
 Auf
dem Landgang gab es noch mehr zu sehen: Eine
echte Höhle, in der sich bei meiner Annäherung gleich
ein schnelles, scheues Tierchen verkroch. Man sagt, dass Musholm schon
sehr früh bewohnt war - vermutlich stellte damals diese
Höhle die bevorzugte Behausung dar. Jede Menge Vögel
- Schwalben, Kormorane, Möwen und bestimmt auch einige
seltenere Exemplare. Ein furchtbares Gemetzel - da hat eine
Möwe den Kürzeren gezogen, mutmaßlich wurde
sie von einem Seeadler gerupft. In der Steilküste gibt es
unzählige kleine Löcher, im Frühjahr
Brutstätte der Schwalben. Der Lehm schimmerte in der
Abendsonne rötlich, fürs Foto bot sich vor diesem
Hintergrund ein Büschel Margeriten dar. Ächzend, aber
ohne Widerspruch, begab ich mich in die Hocke und drückte auf
den Auslöser. Inzwischen humpelte ich mehr, als dass ich ging,
die Insel ist nämlich klein, aber keineswegs winzig, und
dennoch genoss ich jeden Blick und jeden Augenblick. Zum Essen gab es,
dem Rezeptvorschlag von Saltys vorletzten Gästen ein
Stück weit folgend und dann saisonal abbiegend, Nudeln mit
Pfifferlingen und Speck. Es war köstlich. Unter
monströsem Sternenhimmel und in Sichtweite der
prächtig illuminierten Hochbrücke über den
Großen Belt hörte ich bis spät in die Nacht
„Black Sabbath“ - warum ausgerechnet diese Band,
vermag ich nicht zu sagen, obwohl es eigentlich gut passt: Als ich mit
sechzehn die ersten Takte ihrer LP hörte, die ein Schulfreund
mir vorspielte, hörte ich den irren, , unverwechselbaren,
morbiden Gitarrensound, grinste und sagte:
„Cooooooool!“ Und genau so war nun meine Stimmung.
Auf
dem Landgang gab es noch mehr zu sehen: Eine
echte Höhle, in der sich bei meiner Annäherung gleich
ein schnelles, scheues Tierchen verkroch. Man sagt, dass Musholm schon
sehr früh bewohnt war - vermutlich stellte damals diese
Höhle die bevorzugte Behausung dar. Jede Menge Vögel
- Schwalben, Kormorane, Möwen und bestimmt auch einige
seltenere Exemplare. Ein furchtbares Gemetzel - da hat eine
Möwe den Kürzeren gezogen, mutmaßlich wurde
sie von einem Seeadler gerupft. In der Steilküste gibt es
unzählige kleine Löcher, im Frühjahr
Brutstätte der Schwalben. Der Lehm schimmerte in der
Abendsonne rötlich, fürs Foto bot sich vor diesem
Hintergrund ein Büschel Margeriten dar. Ächzend, aber
ohne Widerspruch, begab ich mich in die Hocke und drückte auf
den Auslöser. Inzwischen humpelte ich mehr, als dass ich ging,
die Insel ist nämlich klein, aber keineswegs winzig, und
dennoch genoss ich jeden Blick und jeden Augenblick. Zum Essen gab es,
dem Rezeptvorschlag von Saltys vorletzten Gästen ein
Stück weit folgend und dann saisonal abbiegend, Nudeln mit
Pfifferlingen und Speck. Es war köstlich. Unter
monströsem Sternenhimmel und in Sichtweite der
prächtig illuminierten Hochbrücke über den
Großen Belt hörte ich bis spät in die Nacht
„Black Sabbath“ - warum ausgerechnet diese Band,
vermag ich nicht zu sagen, obwohl es eigentlich gut passt: Als ich mit
sechzehn die ersten Takte ihrer LP hörte, die ein Schulfreund
mir vorspielte, hörte ich den irren, , unverwechselbaren,
morbiden Gitarrensound, grinste und sagte:
„Cooooooool!“ Und genau so war nun meine Stimmung.
 Die Rückreise begann wie berichtet
flautig und ging regnerisch weiter. Wir trieben beinahe
majestätisch vom Liegeplatz weg und setzten Segel. Seit
Kappeln war der Motor nicht mehr zum Einsatz gekommen. In Nyborg -
ehemals Fährhafen, jetzt wenig mehr als eine Abfahrt an der
Autobahn nach Kopenhagen - ist Anlegen unter Segeln gar keine Frage.
Und wir waren früh genug, um den nachmittäglichen
Regen erholsam in der Koje zu verbringen. Es legte noch die Johann
Smidt an - ein Traditionssegler nur dem Äußeren
nach, in Wahrheit erst 1974 gebaut, in meinen Augen nicht allzu
schön oder romantisch, dafür aber extrem seetauglich:
Die „Johnny“ ist mit Schulklassen in Ostsee,
Nordsee und Karibik unterwegs. Sie ist ein bisschen tiefgangbehindert,
deshalb musste ich Paula voraus zerren in den „nur“
3,50 tiefen Teil des Hafenbeckens. Dann kam zuerst der Skipper, um sich
für die Kooperation zu bedanken. Und anschließend
der Lehrer der mitreisenden Schulklasse, ein Bekannter aus
zurückliegenden Winterlagern - Eigner und Erbauer von
Folkeboot Wilde Charlotte. Ihm also drückte ich morgens um
sieben, als Paula nur noch an einer Vorleine hing und die Zeisinge
schon gelöst waren, ein Exemplar unseres Buches in die Hand
und kassierte, extra noch einmal an Land steigend, den Preis.
Die Rückreise begann wie berichtet
flautig und ging regnerisch weiter. Wir trieben beinahe
majestätisch vom Liegeplatz weg und setzten Segel. Seit
Kappeln war der Motor nicht mehr zum Einsatz gekommen. In Nyborg -
ehemals Fährhafen, jetzt wenig mehr als eine Abfahrt an der
Autobahn nach Kopenhagen - ist Anlegen unter Segeln gar keine Frage.
Und wir waren früh genug, um den nachmittäglichen
Regen erholsam in der Koje zu verbringen. Es legte noch die Johann
Smidt an - ein Traditionssegler nur dem Äußeren
nach, in Wahrheit erst 1974 gebaut, in meinen Augen nicht allzu
schön oder romantisch, dafür aber extrem seetauglich:
Die „Johnny“ ist mit Schulklassen in Ostsee,
Nordsee und Karibik unterwegs. Sie ist ein bisschen tiefgangbehindert,
deshalb musste ich Paula voraus zerren in den „nur“
3,50 tiefen Teil des Hafenbeckens. Dann kam zuerst der Skipper, um sich
für die Kooperation zu bedanken. Und anschließend
der Lehrer der mitreisenden Schulklasse, ein Bekannter aus
zurückliegenden Winterlagern - Eigner und Erbauer von
Folkeboot Wilde Charlotte. Ihm also drückte ich morgens um
sieben, als Paula nur noch an einer Vorleine hing und die Zeisinge
schon gelöst waren, ein Exemplar unseres Buches in die Hand
und kassierte, extra noch einmal an Land steigend, den Preis.
 Der
daran anschließende Segeltag war
viel besser, als es die Stichworte „bedeckter
Himmel“, „Regen“ und später
„gegenan“ nahelegen. Er war grandios. Er war
„mit alles“, wie ein perfekter Döner, nur
dass Segeln definitiv besser ist als Döner Essen. Und Dyreborg
- eigentlich nur eine Notlösung, ich wollte lieber nach
Bjørnø oder sonstwohin, besann
mich dann aber eines Besseren wegen der feinen Abdeckung und dem
ruhigeren Liegen - bildet einen wundervollen Abschluss eines feinen
Kurzurlaubes. Es bleibt noch der Rückweg, bei Westenwind
sollte er gelingen, und spätestens in Kappeln, notfalls
zwanzig Meilen vorher in der totalen Flaute, werden wir wohl mal wieder
den guten Mercury anwerfen.
Der
daran anschließende Segeltag war
viel besser, als es die Stichworte „bedeckter
Himmel“, „Regen“ und später
„gegenan“ nahelegen. Er war grandios. Er war
„mit alles“, wie ein perfekter Döner, nur
dass Segeln definitiv besser ist als Döner Essen. Und Dyreborg
- eigentlich nur eine Notlösung, ich wollte lieber nach
Bjørnø oder sonstwohin, besann
mich dann aber eines Besseren wegen der feinen Abdeckung und dem
ruhigeren Liegen - bildet einen wundervollen Abschluss eines feinen
Kurzurlaubes. Es bleibt noch der Rückweg, bei Westenwind
sollte er gelingen, und spätestens in Kappeln, notfalls
zwanzig Meilen vorher in der totalen Flaute, werden wir wohl mal wieder
den guten Mercury anwerfen.
Es lief inzwischen noch eine kleine Yacht ein, die genau in die
Lücke vor Paula und hinter den Locals passte, „extra
für euch freigehalten“, wie ich beim Leinen Annehmen
behauptete. Die Konstellation an Bord ist so, dass die Frau skippert,
der Mann ist der Trainee - schade, dass dies nach wie vor bemerkenswert
ist und lobend hervorgehoben werden muss. Bemerkenswert ist auch, dass
der Mann Nicolas heißt wie ich. Ich habe sie dann nur noch
gefragt, ob sie womöglich Paula heißt. Dann
hätte ich auf der Stelle ein weiteres Buch verkauft.
weiter: Silverrudder?
Ohne uns!

