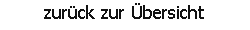| Die
dreizehnjährige
Paula besucht in den
Ferien ihren Vater, den sie kaum je gesehen hat. Nur aus Briefen kennt
sie ihn als überzeugten Einzelgänger und
leidenschaftlichen
Segler. Doch mit seinem Alleinsein ist es nun vorbei, denn Paula
möchte bei ihm bleiben. Beiden, Vater und Tochter,
fällt es
schwer, sich zurecht zu finden in einer Welt, die das Mädchen
als
eine einzige, große Ungerechtigkeit empfindet. Erst die
Begegnung
mit einigen bemerkenswerten Persönlichkeiten, vor allem aber
eine
abenteuerliche Segelreise, ermöglicht es ihnen, sich von einer
belastenden Vergangenheit zu befreien. Das Segeln - ständige Auseinandersetzung mit Kräften, die stärker sind als wir - ist die Bühne, auf der sich die Vater-Tochter-Beziehung entfaltet. Eine humorvolle Geschichte, eine traurige Geschichte, letztlich aber doch eine hoffnungsvolle Geschichte, die der Frage nachgeht: Was ist Freiheit, und warum muss man auf dem Weg dorthin gelegentlich den Anker werfen? Über Feedback freut sich: Nicolas Thon Eine Leseprobe: Kapitel eins Tiefe Zufriedenheit erfüllt mich beim Betrachten meines schönen Zimmers. Wie ordentlich es ist! Und so geräumig! Strahlendes Licht und sommerliche Wärme strömen durch das geöffnete Fenster. Markante Dachschrägen verleihen ihm eine treffliche Gemütlichkeit, die es aus seiner Einrichtung nicht zu beziehen vermag, denn von einem sauberen Teppich abgesehen ist es vollkommen leer. Ein Papagei flattert herein, gefolgt von einer Katze. Ihre Flügel schlagen heftig, ihr Ausdruck ist grimmig, ihr Anblick furchteinflößend. Der Papagei schlägt Haken, um ihren Angriffen auszuweichen, und krächzt: „Katzä! Katzä!“ Geistesgegenwärtig schnappe ich die Angreiferin aus der Luft, werfe sie in einer beherzten Bewegung aus dem Fenster wie einen alten Lappen, dann schließe ich es in aller Eile, sperre die Katze aus und rette auf diese Weise dem Papagei das Leben. Von meinem eigenen Lachen erwache ich. Es ist ein seltener Moment völliger Unbeschwertheit, für Sekundenbruchteile nur, bevor ich mich frage, wo ich mich befinde. Ich muss intensiv nachdenken, doch nach kurzer Zeit fällt es mir ein: Ich liege in der Geborgenheit von "Paulas" Koje. Wir sind in Faaborg. Ein ausgiebiger Sommertörn geht zuende. Jeden Tag ein anderer Ort, ich habe wohl ein bisschen den Überblick verloren. Ich stecke den Kopf aus dem Schiebeluk und sehe nach, wie der Wind ist. Dann setze ich Kaffeewasser auf. Als der dampfende Becher vor mir auf dem Cockpittisch steht, drehe ich eine Zigarette, zünde sie genüsslich an, nehme einen ersten Schluck. Jeder Tag beginnt unabänderlich auf diese Weise. Ich brauche solche Rituale. Sie geben mir Sicherheit. Ein Schwan kommt angefahren, in der Hoffnung auf ein paar Brotkrümel. Schwäne scheinen „Paula“ zu mögen, vielleicht liegt es daran, dass sie ihr über die Kante gucken können, weil sie soviel niedriger ist als die meisten Boote. Sie besitzt, davon bin ich überzeugt, eine Persönlichkeit. Einen Charakter. Ich kenne ihre Tücken und Eigenarten. Ich weiß mit ihnen umzugehen. Mit mir an der Pinne stürzt "Paula" sich wie ein Delfin in jede noch so hohe Welle. Wir sind ein Team, sie und ich, gemeinsam erarbeiten wir uns jede Seemeile. Wir gehen gemeinsam durchs Leben, Wende um Wende, Halse um Halse. Sie ist zuverlässig wie meine Rituale. Das "Nordische Folkeboot", der ganz große Wurf der Bootsbaugeschichte. Wieder einmal war es eine Abenteuerreise. Mit "Paula" passiert an einem einzigen Tag mehr, als an Land in einer ganzen Woche. Was zum Beispiel war gestern? Richtig, wir ankerten im Thurø Bund. Die Wurzeln des üppigen Seegrases, in dem sich der Anker verhakt hatte, anstatt sich tief und fest in den Schlick zu graben, waren wirklich zäh, hielten in einer frischen Brise durch, bis es ohnehin Zeit zum Aufstehen wurde. Der ungewöhnliche Klang des Plätscherns an der Bordwand, auf welche die kleinen Wellen nunmehr seitlich aufprallten, weckte mich rechtzeitig, bevor wir dem Ufer gefährlich nahe kamen. Ich sagte mir: Wer ankert, sollte den Grund kennen. Heute also kein Plätschern, dafür lautes Lachen. Amüsiert den Kopf schüttelnd, denke ich wieder an meinen Traum, versuche aus seinen Bildern - krächzendem Papagei, fliegender Katze und mir als Held - schlau zu werden. Das flatterhafte Fabelwesen, ist das meine Mutter? Oder ist das nur der erste Eindruck, bevor die Grimmigkeit des Gesichtes und die Heimtücke der Katzenflügel auf Jule verweisen, meine große Liebe vergangener Tage? Und nahm nicht die fauchende, schnappende Katze in meiner Hand die Gesichter aller Liebschaften, Freunde und Bekannter, und überhaupt aller Menschen um mich herum an, bevor ich sie - misstrauisch, enttäuscht, angewidert - mit einer energischen Handbewegung aus meinem Zimmer, aus meinem Leben, fegte und aussperrte? Dann wäre ich auch der Papagei, dem es im letzten Moment gelungen ist, sich vor einer gefährlichen Welt voll fliegender Katzen in die Ruhe und Stille eines leeren und doch schönen Zimmers zu flüchten. Schade, gerne hätte ich zuende geträumt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die Träume für Prophezeiungen halten. Aber wenn doch, vielleicht hätte ich im weiteren Verlauf nicht nur mein bisheriges Leben erkannt, sondern auch die Ereignisse der nächsten Monate vorausgesehen, verschlüsselt in dieser seltsamen Bildsprache. Vielleicht hätte sich der dankbare Papagei auf die Schulter einer kleinen Piratin gesetzt, wäre, wie das in Träumen vorkommt, mit ihr zu einer einzigen Person verschmolzen, hätte schließlich im Verlauf dramatischer Sequenzen eine sagenhafte Gestalt angenommen, von der ich bisher nichts ahne. Endlich, nach Stunden intensiven Träumens, hätte sich womöglich die Szenerie entspannt, die Gestalt sich wieder in eine papageiengeschmückte Piratin zurückverwandelt, der alle fliegenden Katzen und sonstigen Ungeheuer der Welt so sehr nichts anhaben konnten, dass ich mir erlaubte, mein Fenster zur Welt von Neuem zu öffnen. Nein, denke ich, der Traum passt nicht zu mir. Ein helles, aufgeräumtes Zimmer, ein helles, aufgeräumtes Leben, das trifft die Sache nicht. Zu mir würde ein kleines, altes Segelboot passen, unter Deck vollgestopft mit einem Chaos von Ausrüstung und schmerzlichen, halb verdrängten Erinnerungen an vergangene Zeiten. Damit läge ich in einer einsamen, nach allen Seiten geschützten Bucht vor Anker, die Füße ins Wasser baumelnd, umgeben von schroffem Fels. Ankern ist toll: Es birgt von vornherein das Versprechen zum Weiterfahren. Spätestens wenn der Wind dreht und es in der vorher so geschützten Bucht ungemütlich wird, oder auch sonst jederzeit, könnte ich den Anker lichten, die Segel setzen und mir einen neuen Platz suchen. Diese Möglichkeit beruhigt mich, aber vorerst bleibe ich, wo ich bin, denn es gefällt mir hier. Alle dürfen kommen, um ebenfalls in dieser Bucht zu ankern und mir Gesellschaft zu leisten: Papageien, Piratinnen oder irgendwelche metaphorischen Segler, die zu dieser Stelle abseits der üblichen Routen gefunden haben. In so einem Traum würde ich mich wiedererkennen. Der Gedanke an die kleine Piratin reißt mich aus Träumen und Deutungen und bringt mich in die Gegenwart zurück. Ich bin nicht zufällig in Faaborg. Sobald der kleine Schiffsausrüster aufmacht, begebe ich mich in den dunklen, bis in den letzten Winkel vollgestopften Laden, wo an Haken von der Decke hängt, was nicht in den staubigen Regalen Platz findet. Es riecht nach Öl und nach Fisch, und der bärtige, alte Mann, der den Laden betreibt, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Mitten im Gespräch geht er erstmal raus, um ein Schiff mit Diesel zu betanken, ständig erweckt er den Eindruck, auf jeden Fall genau das vorrätig zu haben, was ich brauche, und es bald auch zu finden. Ich könnte Stunden in diesem Geschäft verbringen, so wohl fühle ich mich. Ich kaufe eine Garnitur Ölzeug in der kleinsten Größe. Der mäßige Nordwestwind treibt ein paar Schäfchenwolken über die offene See und verhilft „Paula“ zu gemächlicher Fahrt Richtung Schlei. Er scheint sich darin zu gefallen, ein solches Postkartenmotiv zu schaffen, ein Szenario, wie es Nichtsegler im Sinn haben, wenn sie von der totalen Entspannung und der absoluten Freiheit des Segelns schwärmen. Mir ist das fast ein bisschen zu langweilig. Schlaff und träge sitze ich an der Pinne, vermisse Ruderdruck, Schräglage und Geschaukel, und es spielt nicht einmal eine Rolle, ob ich mich auf Kurs und Kompass konzentriere oder verträumt den unverstellten Blick bis zum Horizont genieße. Auch besteht kein Anlass, mich voller Nervosität auf das Anlegen vorzubereiten. In der heimatlichen Box wird es reibungslos gelingen, keine Chance also, mich meiner Erfahrung und Geschicklichkeit zu erfreuen, wenn das knifflige Manöver bewältigt ist. Nervös werde ich allmählich trotzdem, wenngleich aus einem anderen Grund. Drei Wochen habe ich mein Zuhause nicht gesehen: Die alte Windmühle in Grödersby. Es ist toll, eine Veranda zu haben, die einmal ringsum geht, man kann immer auf der Sonnenseite stehen. Meine Junggesellenbude möchte aufgeräumt und vom Staub befreit werden. Denn morgen kommt Besuch, von niemand Geringerem als meiner Tochter. Oh je, wie ungewohnt sich das anhört: „Meine Tochter.“ Für drei Wochen zu Besuch in den Ferien. Bisher war ich ihr ein miserabler Vater. Oder treffender: überhaupt kein Vater. Ich habe keine Ahnung, was sie von ihren Ferien erwartet. Wie das wohl sein wird, mit ihr zu segeln? Was, wenn sie sich zu Tode langweilt? Seekrank wird? Vielleicht wird sich sie von vornherein weigern, eine schaukelnde, klaustrophobe Holzkiste auch nur zu betreten. Nur ein paar Mal sind wir uns begegnet. Was uns verbindet, ist eine Art Brieffreundschaft. Bei unseren seltenen Begegnungen haben wir uns bestens verstanden, hat sie mich mit ihrer Fröhlichkeit angesteckt, mit einem Blick ihrer tiefen, dunklen Augen um den Finger gewickelt und voller Elan dafür gesorgt, dass wir eine Menge zu lachen hatten. Doch das ist lange her. Sie spricht von sich als Piratin, seit ihr seltsamer Papa ihr dieses Kinderbuch geschenkt hat, in dem es um ein Findelkind geht, das unter Piraten aufwächst, bevor sich herausstellt, dass es in Wirklichkeit eine totgeglaubte Prinzessin ist. Seit dem Umzug nach Irland klingt sie alles andere als glücklich. Ihre Briefe handeln beinahe von einem einzigen Thema. Zu ihrem dreizehntem Geburtstag schrieb ich ihr diese eine Zeile: Liebe Paula! Was ist Freiheit? Fragt sich: Dein Papa. Ihre Antwort kenne ich beinahe auswendig, so oft habe ich sie gelesen. Lieber Papa! Scheiße, Du hast recht. Ich weiß auch nicht, was Freiheit ist. Ich muss gestehen, dass ich überhaupt nicht begeistert war von Deinem Brief. Ich hab mich wohl für ziemlich klug gehalten, und dann zeigst Du mir mit einem einzigen Satz, was für ein dummes, kleines Kind ich in Wirklichkeit bin. Leider musste ich diese Erkenntnis in einem gigantischen Wutanfall verarbeiten, den das ganze Haus zu spüren bekam. Ist vielleicht ein bisschen ungerecht. Statt Geburtstagsfeier gab es verheulte Gesichter, ich bin heiser vom Brüllen, Shauns letzte Worte waren, dass er jetzt in die Stadt fährt, um sich zu betrinken, und Mama redet immer noch nicht wieder mit mir. Ich bin Dir trotzdem unendlich dankbar: Die anderen haben sich, als wir schonmal dabei waren zu streiten, endlich mal um die Ohren geknallt, was ihnen aneinander schon immer auf den Zeiger ging - die idyllische heile Welt von Bunowen liegt in Trümmern, und was daraus wird, kann auf jeden Fall nur besser sein als der letzte Versuch. Und schließlich habe ich dank Deiner Frage endlich eine Aufgabe: Ich muss herausfinden, was Freiheit ist! Es freut sich (ehrlich!) Deine Paula. Was ich ihr daraufhin schrieb, hat wohl dazu beigetragen, dass ihr lange geplanter Besuch nun endlich Realität wird. Liebe Paula! Ich behaupte nicht, ich wüsste, was Freiheit ist. Ich erzähle Dir nur eine Geschichte, die vielleicht damit zu tun hat und vielleicht auch nicht. Ich bin heute richtig früh aufgestanden, um nach Dänemark zu segeln, und dann war morgens um fünf schon ein solcher Wind, und die Vorhersage für den Rest des Tages so dramatisch, dass ich es lieber bleiben ließ. Wie ich schonmal wach war, bin ich mit der Kamera zum Noor geschlendert, um meine Mühle in der Morgensonne zu fotografieren. Gänse im Formationsflug sausten über die Schlei hinweg und machten Geräusche wie ein ungeölter Block auf einem alten egelschiff. Ein Bussard kreiste über den Feldern, ein Entenpaar zog schnatternd seine Bahnen. Ich nehme mir endlich mal wieder Zeit, Dir zu schreiben. Auch ohne Segeln ist das jetzt schon ein gelungener Tag. Meine Pläne ändern zu können und mich eines anderen Vorhabens als des ursprünglich geplanten erfreuen zu können, anstatt enttäuscht zu sein: ist das nicht Freiheit? Grüße, Papa. Aus einem späteren Kapitel: „Alles Gute zum Geburtstag“ sage ich feierlich und überreiche ihr eine Flasche tiefroten Kirschsaft und ein Buch: Die Entdeckung der Langsamkeit von Nadolny. Eine wahre Geschichte. Eine Segelgeschichte. Ich habe die Hoffnung, dass Paula sich inspirieren lässt von John Franklins Entdeckergeist und seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit. Außerdem bekommt sie eine Postkarte: Wenn Ihr meint, Ihr müsst diese Sache durchziehen, werde ich Euch nicht davon abhalten. Sei so nett und lass mich aus dem Spiel. Ich mache nicht mit. Wenn Phase eins beendet ist und Du wieder ansprechbar bist, werde ich Dir beweisen, dass ich mich keineswegs in einer Idylle einrichte. Papa. Sie liest es mit wohlwollendem Gesichtsausdruck. "Danke" sagt sie, gibt mir einen Kuss und wedelt bedeutungsvoll mit der Postkarte. Ich serviere ihr mein bestes Rührei, mit Lauchzwiebeln und grüner Paprika, und sie stürzt sich darauf, als hätte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht so etwas Tolles gegessen. Ich bekomme keinen Bissen runter. Als sie in der Schule ist, knabbere ich lustlos auf einem Brötchen vom Vortag herum, dann stopfe ich mir eine Tafel Schokolade rein. Ein Schneeschauer geht auf die Krokusse im Vorgarten nieder, als die Post kommt. Für Paula ein Päckchen von Jule. Später trägt sie es vorsichtig in ihr Zimmer, verstaut es irgendwo. Es bleibt ungeöffnet. Merle schleppt sich mit einem gigantischen Strauß roter Rosen ab, der kaum durch die Tür passt. Ich bin beeindruckt, Paula grinst. "Merle, Merle, die Rosen!" sagt sie aufgeregt, "genau die richtige Farbe." Merle lächelt. "Die gleiche Farbe wie der blutrote Blutrubin des Verderbens", erklärt sie mir. Ach ja: Seeräuber-Moses. Ich bekomme ein ungutes Gefühl, als ich die gleiche Farbe in dem Kirschsaft wiedererkenne. "Soso", sage ich, "der blutrote Blutrubin des Verderbens. Und du bist also die Prinzessin und rechtmäßige Besitzerin?" "Türlich", antwortet Paula stolz, "denn ich bin ja auch ein Findelkind und du der Seeräuberkapitän, der mich an Bord nimmt." "Das heißt, du wirst den Menschen Glück und Gerechtigkeit bringen?" "Genau", nickt sie eifrig, "aber jetzt noch nicht. Erst muss ich ja noch ein paar Abenteuer bestehen, und vor allem den Rubin erstmal finden." Ich fasse mir theatralisch an den Kopf. Paula steht langsam auf, gibt mir einen Kuss mit ihren rubinroten Lippen, dann zieht sie sich mit Merle und dem Rosenstrauß in ihr Zimmer zurück. "Papa, komm mal bitte" ruft sie kurz danach. Ich stecke mutig meinen Kopf durch die Tür. Die Mädchen liegen nackt im Bett, über und über von roten, duftenden, dornigen Rosen bedeckt. "Mach mal n Foto" gebietet meine Tochter. Ich zögere. „Mann, Papa“ stöhnt sie, „Merle braucht ne Vorlage für ihre Zeichnung." Merle lächelt geheimnisvoll. Ich halte also die Szene in einer Fotoserie fest. Üppige Blumenpracht auf der reinen, blassen Haut zweier verliebter Mädchen, es ist wahrhaftig zutiefst romantisch. Hm. Die Rose, dornig wie sie ist, symbolisiert die Nähe von Liebe und Schmerz nicht einfach nur. Nachdenklich unternehme ich einen Spaziergang... |
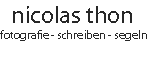 |
|||||
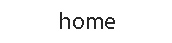 |
 |
 |
 |
 |

|
Wer ankert, sollte den Grund kennen