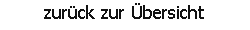| Das Plakat Vielen geht es so: Sie nehmen alles einfach so hin. Bis es zu spät ist. Über Feedback freut sich: Nicolas Thon Vollständiger, überarbeiteter Text:Ein zehnjähriges Mädchen. Große, dunkle Augen, entwaffnendes Lächeln, niedliche Grübchen, dunkles, schulterlanges Haar. In ihrer ausgestreckten kleinen Hand eine riesige Erdbeere. Man ahnt, wie überwältigend süß und saftig sie sein muss. Die Erdbeere ist leuchtend rot wie die Lippen des Mädchens. Gleich wird das Mädchen hineinbeißen, gierig, unersättlich, das Geschmackserlebnis durchzieht seinen ganzen Körper. Vorläufig gibt sie sich der Vorfreude auf den bevorstehenden Genuss hin. Sie betrachtet nicht die Erdbeere. Sie sieht mich an. Ein unwiderstehliches Bild. Ich kann mich nicht losreißen. Ich stehe vor der Littfassäule, seit einer Viertelstunde schon, und betrachte das riesige Plakat. Ich nehme nicht wahr, wofür es wirbt, Erdbeeren vermutlich, ich sehe nur das Mädchen. Unfähig, mich abzuwenden. Sie lebt vollkommen im Hier und Jetzt, strahlt wilde Entschlossenheit aus, den Augenblick zu genießen, ohne über den Moment des Genusses hinauszudenken - und dabei sieht sie aus dem Plakat heraus mich an. Das fasziniert mich. Ich möchte nichts weiter tun als sie betrachten. Jemand spricht mich an. Ein Mann in meinem Alter. „Süß, die Kleine, nicht wahr?“ „Wie bitte?“ „Sagen Sie nicht, es ist wegen der Erdbeere. Ich habe Sie beobachtet. Es ist das Mädchen, weswegen Sie hier stehen.“ „Hm. Tja. Also.“ Ich räuspere mich. Komme ein Stück weit zur Besinnung. „Und wenn schon. Ist doch ein. Schönes Foto. Wer sind Sie überhaupt?“ Er legt mir vertrauensselig die Hand auf die Schulter. „Das Mädchen ist meine Nichte.“ Mir bricht der Schweiß aus. Der Typ hat mich dabei erwischt, wie ich seine kleine Nichte auf einem Plakat anhimmle. Es ist mir höchst unangenehm. Was wird er jetzt von mir denken? Unter Hunderten von Menschen, die vorbeigegangen sein müssen, seit er in Sichtweite ist, hat er mich gefunden, und nun stellt er mich zur Rede. Oder? „Haben Sie ein bisschen Zeit? Ich möchte Ihnen etwas zeigen.“ Sein gepflegtes Äußeres, sein gewinnendes Lächeln, das ich jetzt erst wahrnehme, beruhigen mich. Er macht nicht den Eindruck, ein Sadist oder Erpresser oder Psychopat zu sein. Ich folge ihm, um drei Straßenecken, in einen Innenhof, eine Wendeltreppe empor. „Ernst Lustig. Fotographie“ steht auf dem Messingschild neben der Stahltür, durch die wir sein Atelier betreten. „Ein Künstlername“ erklärt er, „und gleichzeitig mein Programm.“ Er drückt mir Bildbände in die Hand. Ich blättere den ersten durch: Aufnahmen aus Operationssälen, hautnah fotografiert, schreiend grelles Licht fällt auf gesichtslose Ärzte in Dunkelgrün, fällt auf bläulich verfärbte Patienten, deren Leben in der Hand der Mediziner liegt. Dramatisch leuchtet das frische Blut. Danach halte ich einen Band mit dem Titel „ultimate b.e.a.u.t.y“ in den Händen. Riesiges Format, hochwertiger Hochglanzdruck. Auf dem Titelbild: ein vielleicht zwölfjähriges Mädchen und ein Junge im gleichen Alter, sie in einem Kleid, er in einem Anzug, wie es um 1900 herum modern gewesen sein mag, sie sehen aus wie ein zu klein geratenes Hochzeitspaar und stellen stolz und glücklich ihre Kostüme zur Schau. Im Inneren: spielende und tobende Kinder in verschiedenen Verkleidungen, mal unschuldig in der Hocke, das eigene Spiegelbild in einer Pfütze betrachtend, ein anderes Mal mit windzerzausten Haaren auf einem kahlen Felsen stehend, im Hintergrund die glitzernde See, schließlich in der Luft eingefangen beim wagemutigen Sprung von einem Trampolin. Einer Doppelseite zeigt fünf Jungen und Mädchen, über und über schlammverschmiert, der Albtraum auf Sauberkeit und Ordnung bedachter Eltern. Die Kinder strahlen unglaublich viel Spaß und Lebensfreude aus, gekonnt eingefangen von diesem seltsamen Mann mit dem ausgefallenen Namen. Ernst. Lustig. Sein Programm, ich verstehe. Was kommt als Nächstes? Als Nächstes kommt ein Buch, bei dessen Betrachten mir endgültig der Mund offen steht. Da ist sie: Anna. Ich blättere mich durch eine Sammlung von Werbeaufnahmen. Anna in grünem Kleid mit einem saftigen Apfel, kleinere Fotos am Rand zeigen, wie sie nach dem Genuss der sauren Frucht ulkig das Gesicht verzieht. Anna in einem schlammigen, weißen Kleid vor einer Waschmaschine, sie scheint im Begriff, hineinzusteigen. Sie wirbt für Staubsauger und Kindermode, geräumige Autos und funktionale Möbel. Als ich noch mit staunenden Augen in dem Buch blättere, drückt er mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Er zündet sich eine Zigarette an, hält mir auch eine hin. Rauch breitet sich in dem großen, hohen Raum aus, zusammen mit dem gespanntesten Schweigen, seit der Mensch gelernt hat, die Klappe zu halten und seine Umgebung im Ungewissen zu lassen. Was will dieser Mann von mir? „Sie wohnt auf dem Land. Ein Bauernhof. Ich könnte Sie hinbringen.“ „Sie sprechen in Rätseln, mein Freund. Warum wollen Sie mich zu ihrer Nichte bringen?“ „Das werden Sie erfahren. Sie wird es Ihnen erklären.“ Ich bin selbst überrascht über meine Antwort: „Also gut. Gehen wir.“ (2) Eine endlose Fahrt im Cabrio über schmale Alleen. Ein Ensemble grasgedeckter Holzhäuser, um einen Innenhof gruppiert. Dort sind die Kinder, drei Jungs, vier Mädchen. Sie spielen. Sie tragen Shorts, dreckige T-Shirts, Gummistiefel. Ernst Lustig betätigt die Hupe, die Kinder drehen neugierig ihre Köpfe, eines springt auf und rennt auf das ihr vertraute Auto zu. „Onkel Malte! Onkel Malte!“ ruft sie. Ich erkenne sie wieder. Wie klein sie ist, geradezu winzig! Und wie hübsch! „Wen hast du denn da mitgebracht, Onkel Malte?“ Ihre Stimme ist klar und rein, erfüllt von Fröhlichkeit, unterlegt mit einer Spur Ironie. Ihr aufgeregt hüpfender Körper, voll kindlicher Energie, verrät ihre ständige Bereitschaft zu lachen. Ernst Lustig sagt etwas zu ihr, ich kann es nicht hören, und dann sieht sie mich an, ihr Mund verzieht sich zu einem verzückten, entzückenden Lächeln. Sie geht auf mich zu. In einem Meter Abstand bleibt sie stehen. Betrachtet mich eingehend von oben bis unten. „Einverstanden?“ fragt Onkel Malte. „Und ob!“ verkündet sie. Langsam streckt sie eine Hand aus, berührt vorsichtig meinen Arm. Dann nimmt sie mich bei der Hand und führt mich zu den anderen. „Das ist er! Den hat Onkel Malte mir versprochen, und jetzt hat er ihn endlich hergebracht!“ verkündet sie stolz. Die anderen Kinder wirken ernst. Sie nicken anerkennend. Darf ich jetzt endlich erfahren, was hier vor sich geht? Sie führt mich in eines der Häuser. Ich folge ihr, ohne Fragen zu stellen, ohne nachzudenken, ohne Widerstand. Das Haus besteht aus einem einzigen Raum, die Einrichtung aus einem breiten Bett aus rustikalen Eichenbalken, einem kleinen Schreibtisch und dazu gehörigem Stuhl, einem schönen, alten Bauernschrank, einem Holzofen. Ein türloser Durchgang führt zu einem winzigen Badezimmer. „Hier wohne ich“ sagt Anna. „Willkommen zuhause.“ Sie zeigt auf ihr Bett. „Setz dich doch.“ Ich setze mich vorsichtig auf die rosa Bettwäsche. „Möchtest du was trinken?“ fragt sie und zaubert, ohne meine Antwort abzuwarten, eine Flasche zwischen dem Chaos von Schulsachen unterm Tisch hervor, nimmt das einzige Glas von der Fensterbank und drückt es mir, randvoll mit dem blutroten Kirschsaft, in die Hand. Bei aller Abgeklärtheit, die sie mir vorspielt, klopft ihr Herz erkennbar heftig vor Aufregung. Ich nehme einen kräftigen Schluck Saft. Erwartungsvoll starre ich sie an. Sie zieht ihre dreckigen Gummistiefel aus, wirft sie in die Ecke neben der Eingangstür, Schlamm spritzt an die Wand. „Es kommt dir bestimmt eng vor. Du wirst dich dran gewöhnen. Wir spielen immer draußen, weißt du, und Essen gibts da drüben.“ Sie zeigt aus dem einzigen Fenster, durch die helle Nachmittagssonne erkenne ich auf der anderen Seite des Hofplatzes ein etwas größeres Gebäude. „Das hier ist nur zum Schlafen.“ Ich erinnere mich an das Plakat. Niemand, mich eingeschlossen, könnte nach dem Betrachten dieses Plakates widerstehen, eine Schale Erdbeeren zu kaufen, wenn sie einem gereicht würde. Mir hat man jedoch keine Erdbeeren angeboten, sondern Anna, oder besser gesagt, man hat mich in ihr karges Heim verschleppt, wie auch immer. Ich lasse mich auf ihr Kinderbett fallen. Es ist aus rauhem Holz getischlert, die Matratze ist weich und biegsam, die Decke flauschig und warm. Zu zweit passen wir nur mit Mühe hinein, jeden Zipfel, der nicht von unseren Körpern eingenommen wird, füllt Anna mit quirliger Lebensfreude. Sie beginnt mich zu kitzeln. Kindliche Freude ist ein wundervoller Anblick. Das wusste ich bereits, zum Beispiel hatte ich einmal einem kleinen Mädchen, dessen Taschengeld nicht reichte, eine Packung leuchtend roter Erdbeeren gekauft, und das Strahlen in ihrem Gesicht hatte mich für den kleinen Betrag mehr als entschädigt. Ich versuche mich zu wehren gegen die Kitzelattacke, doch es ist vergebens: All meine Kraft reicht nicht aus, diesen gelenkigen Wirbelwind zu bändigen, sie ist überall und nirgends über meinem Körper, saust von einer Ecke des schmalen, quietschenden Bettes in die andere, und wenn es mir gelingt, ihrer flinken Finger von mir fernzuhalten, schlägt mich ihr freches, entzücktes Grinsen so hoffnungslos in seinen Bann, dass ich mich dem nächsten Angriff willenlos geschlagen gebe. Als sie schließlich von mir ablässt, schließt sie selig die Augen und seufzt leise vor sich hin in ihrem eigenen Reich vollständiger Glückseligkeit. (3) Auf dem Hofplatz werden mir die anderen Kinder vorgestellt, mit denen ich - so ist wohl der Plan - von nun an auf diesem Bauernhof ohne Bauern zusammenleben soll. Die dünne, große Blonde heißt Jana, die Rothaarige Jule, die jüngste der Gruppe mit den kinnlangen braunen Haaren Judith. Die Jungs heißen Jonas, Justus und Johannes. „Und das hier ist Karlsson“ verkündet Anna und zeigt auf mich. „Ähm, aber ich heiße doch...“, beginne ich zu protestieren, aber sie unterbricht mich. „Ist doch egal, ab heute heißt du Karlsson.“ „Leihst du mir den mal?“ fragt Jana. „Du spinnst ja“ reagiert Anna gereizt, „der gehört mir! Naja...vielleicht irgendwann mal darfst du ihn vielleicht mal haben, weiß ich jetzt noch nicht.“ „Darf er denn mit uns spielen?“ will Jule wissen. „Natürlich, was soll er denn sonst die ganze Zeit machen?“ „Was spielt ihr denn immer so?“ erkundige ich mich. „Och, alles mögliche. Fangen, verstecken, Schnitzeljagd....“ „Gummitwist...“ „Fußball, und manchmal auch mit Puppen...“ „Hey, cool“ meinen die Jungs einstimmig, „wir wollen ein Baumhaus bauen, da kannst du uns bestimmt helfen.“ „Wollen wir noch was spielen? Machst du mit, Karlsson?“ fragt Judith, aber im gleichen Moment ertönt eine Glocke, und die Kinder rennen in den Speisesaal. Anna bleibt stehen, dreht sich zu mir um und nimmt mich bei der Hand. „Ach ja, du kannst das ja noch gar nicht wissen, wie das hier bei uns alles läuft. Bestimmt ist da, wo du herkommst, alles ganz anders geregelt. Hast du vielleicht sogar selbst Essen gemacht, stimmt’s?“ Das alles ist höchst amüsant, aber auch zutiefst verwirrend. Die Glocke hat eine alte Frau betätigt. Sie serviert uns das Essen, das sie gekocht hat, dann verschwindet sie hinter einer Holztür, wo ich die Küche vermute, und zeigt sich erst wieder, als wir fertig sind, um die Teller abzuräumen. Sie spricht kein Wort und verzieht keine Miene. Nach dem Essen gehen die Kinder brav in ihre Betten, jedes in seinem Holzhäuschen. Anna nimmt wieder meine Hand und sagt: „Schlafenszeit.“ Mir steht der Sinn nach einem Glas Wein und einer Zigarette, aber dergleichen ist nicht in Sicht. Ich lege mich unsicher zu ihr ins Bett. Sie kuschelt sich an mich, zögernd und vorsichtig, als gälte es zu prüfen, ob ich und das Kuscheln ihren Vorstellungen entsprechen. Ihre Nähe ist warm und sanft, aber etwas stimmt nicht daran. Sie scheint es auch so zu sehen, sie rückt ein Stück von mir ab und sagt: „Das ist toll, dass du endlich gekommen bist. Ich will jeden Tag mit dir spielen, weißt du, morgens vor der Schule und abends vorm Einschlafen. Als Mindestes.“ Gähnend fügt sie hinzu: „Aber jetzt möchte ich meine Gute-Nacht-Geschichte hören. Du bist nämlich ja ein weltbester Geschichtenerzähler. Hat Onkel Malte dir das gesagt? Ja? Dann ist es ja gut.“ Damit klappt sie die Augen zu und schläft ein. Ich muss wohl gar nicht erwähnen, dass ich eine extrem unruhige Nacht habe. Ich liege an der Seite eines Kindes, das mich vorhin noch von einem Plakat aus angelächelt und auf seltsame Weise fasziniert hat, und niemand macht Anstalten, mir zu erklären, was das alles zu bedeuten hat. Ich mag Anna, keine Frage, aber trotzdem verspüre ich Heimweh. Ich habe ja auch solche Dinge zu tun wie zur Arbeit gehen und die Blumen gießen, morgen Abend bin ich zum Kino verabredet, und plötzlich bin ich mir ganz unsicher, ob ich den Herd ausgeschaltet habe. Und dann, gerade bin ich ein bisschen eingedöst, dämmert mir die unbarmherzige Wahrheit: ich werde meine geliebte, kleine Wohnung nie wieder sehen! Irgendwann entspanne ich mich, als wartete ich geduldig darauf, aus dem Albtraum zu erwachen. Ich erwache tatsächlich, als ein Schatten den glitzernden Schein der Morgensonne verdeckt. Es ist Annas Schatten. Sie ist schon vollständig angezogen, mit Faltenröckchen und T-Shirt und Gummistiefeln. „Du hast das Frühstück verpasst, du hast so schön geschlafen, da wollte ich dich nicht wecken. Ich muss leider jetzt zur Schule. Da kannst du nicht mit. Hoffentlich langweilst du dich nicht ohne mich“ wispert sie besorgt. Ist sie nicht rührend? „Wenn ich wenigstens was zu lesen mitgebracht hätte...“ überlege ich. Ihre Miene hellt sich auf. „Ach, das ist kein Problem, ganz unten im Schrank sind lauter Bücher. Such dir welche aus!“ Dann schnappt sie ihre Schultasche und läuft nach draußen, wo die anderen sie schon erwarten. Ich werfe einen Blick in den Schrank. Zehn Bücher finde ich dort: Hanni und Nanni, Die wilden Hühner, Drei Fragezeichen, Die Schatzinsel. Ich gebe den Plan mit dem Lesen auf. Auf dem Tisch hat Anna ein Käsebrötchen und den Kirschsaft bereitgestellt, hungrig mache ich mich über die spärliche Mahlzeit her. Die Sonne scheint warm und hell, Vögel zwitschern, in der Ferne höre ich eine Kuh. Zögernd gehe ich über den Hofplatz. Ich fühle mich wie in einem Gefängnis und erwarte, das Gelände von einer hohen Mauer oder einem dichtmaschigen Zaun umgeben zu finden, auch wenn ich gestern bei der Ankunft nichts davon gesehen habe. Ich laufe in immer größeren Zirkeln herum, in der Hoffnung jemanden zu treffen, der mir das Ganze hier erklären kann, aber da ist niemand. Da ist aber auch kein Zaun und keine Mauer. Erleichtert stelle ich fest, dass mich nichts davon abhalten kann, ins nächste Dorf zu laufen und von dort nach Hause zu fahren. Vielleicht gibt es dort einen Bäcker, wo ich meinen knurrenden Magen vollstopfen kann - ein einziges Brötchen ist nicht gerade eine sättigende Mahlzeit für einen ausgewachsenen Mann. Wie sehr freue ich mich auf meine chaotische Junggesellenbude, wie sehr vermisse ich meine Arbeit, die ich immer so langweilig und öde empfand, wie sehr fehlt mir der Lärm und die Hektik der Großstadt. Was ist das noch für ein Film, den ich mir heute Abend ansehen werde? Dann denke ich an Anna. An ihr enttäuschtes Gesicht, wenn sie aus der Schule käme, und der langersehnte Mann, den Onkel Malte ihr gebracht hat, wäre verschwunden. Ich denke an Baumhausbauen und Schnitzeljagd. Nach einem kurzen Spaziergang kehre ich zurück. (4) Ich liege auf dem Rücken im Bett und starrte die Decke an, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, als ich auf dem Hofplatz Kinderstimmen höre. Durchs Fenster sehe ich Anna mit langsamen, unsicheren Schritten auf ihr Haus zukommen. Ihr Gesicht verrät große Anspannung. Sie wirkt geradezu verschwommen. Es scheint mir, obwohl ich das auf die Entfernung nicht erkennen könnte, vollkommen plausibel, dass sie vor Nervosität am ganzen Körper zittert. Selbst ihr ist wohl der Gedanke gekommen, ihr geliebter Karlsson könnte in der Zwischenzeit auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein, den ganzen Vormittag mochte dieser entsetzliche Gedanke Besitz von ihr begriffen haben, erfolglos hat sie ihn zu verdrängen versucht, statt dessen ist aus der bloßen Möglichkeit schon schreckliche Gewissheit geworden. Sie öffnet die Tür, als wollte sie den schlimmsten Moment ihres Lebens hinter sich bringen, endlich den traurigen Blick in ihr leeres Zimmer werfen und die trügerische letzte Hoffnung beenden, ich könnte doch noch da sein. Es ist ein Anblick, für den allein es sich schon gelohnt hätte, zu bleiben. Mit leerem Blick und zusammengepressten Lippen schiebt sie ihren Kopf ins Zimmer, ihre müden Augen blinzeln einmal, zweimal, ein Dutzend Mal, ihr Mund öffnet sich zu einem großen, runden, erstaunten Loch, dann geht die Öffnung in die Breite, formt ein Lächeln von kaum beschreiblicher Erleichterung und Freude, ihr ganzes Gesicht, ihr ganzer Körper hellen sich auf und beginnen zu leuchten und zu strahlen. So hält sie inne, die Augen weit aufgerissen, einen Moment unsicher, ob sie glauben soll, was sie sieht, obwohl es doch das ganze Gegenteil von dem ist, was sie erwartet hat zu sehen, und dann wirft sie jubelnd die Ärmchen in die Höhe. „Karlsson!“ ruft sie. „Oh mein Karlsson!“ und damit hüpft sie eine Runde durchs Zimmer, bevor sie sich mit einem Sprung auf mich fallen lässt und beginnt, mich zu knuddeln wie einen Schoßhund. „Mein lieber Karlsson!“ flüstert sie immer wieder. Und ich knuddele sie auch, schlinge meine Arme um ihren schmächtigen, beinahe winzigen Leib, erwidere ihre Freude, voll Dankbarkeit, dass sie mir die Gelegenheit gegeben hat, ein süßes, kleines Mädchen unendlich glücklich zu machen. Ich vergesse die dringenden Fragen, die ich zu stellen hätte, eingeleitet mit „Wie war’s in der Schule?“ Ich will, ich muss wissen, wo ich hier gelandet bin, in was für einer seltsamen Kindergruppe, wo Annas Familie ist und ob sie sich vorstellt, ich würde den Rest meines Lebens mit ihr in dieser Bretterbude hausen. Ich vergesse es, und statt dessen freue ich mich mit ihr. „Oh Karlsson“, singt sie und streichelt meine Wangen. Im dem Moment ertönt die Glocke, und wir beeilen uns zum Mittagessen. Meinen Hunger nach dem spärlichen Frühstück hatte ich schon wieder vergessen, aber jetzt knurrt mein Magen in den höchsten Tönen. Gierig mache ich mich über die dünne Suppe her, dann über den fade gewürzten Brei aus Stampfkartoffeln und weich gekochtem Gemüse. Meine Portion ist nicht größer als die der Kinder. Ich versuche die Aufmerksamkeit der schweigsamen Alten zu erlangen und bitte um einen Nachschlag. Die Kinder lachen. „Tante Käthe ist taubstumm“ erklärt Judith, „du kannst sagen was du willst, sie hört dich sowieso nicht.“ „Ich hab aber noch Hunger.“ Ich jammere in dem weinerlichen Tonfall eines enttäuschten Kindes. Da ist nichts zu machen, aber Anna weiß Rat. Sie führt mich an der Hand zu einem Apfelbaum, den ich auf meinem morgendlichen Spaziergang übersehen habe. Seine Früchte sind unreif, kein Wunder mitten im Sommer, aber das kümmert mich nicht. Ich beiße mit aller Kraft in die kleinen, grünen, steinharten, krachsauren Äpfel, bis mein Magen einen halbwegs gefüllten Eindruck macht. „Jetzt ist aber genug“ mahnt Anna, „sonst kriegst du Bauchweh.“ Als wir zurück zum Hofplatz kommen, wo die anderen Kinder beratschlagen, was sie spielen wollen, fährt das Cabrio vor. „Onkel Malte! Onkel Malte!“ ruft Anna erfreut und wirft sich dem rätselhaften Fotografen in die Arme. Langsam gehe ich auf die beiden zu. „Ich hab dir was mitgebracht, für Karlsson“ höre ich ihn sagen, als er ihr eine große Reisetasche in die Hand drücke. Anna dreht sich um und gibt sie mir. „Guck mal, das ist für dich. Von Onkel Malte“ erklärt sie überflüssigerweise. Ich krame darin und finde neben zahlreichen Kleidungsstücken Rasierzeug und Zahnbürste. Ich wende mich an Onkel Malte, den ich als Ernst Lustig kenne, obwohl das ja auch nur ein Künstlername ist. Dieser ominöse Mensch mit seiner schleierhaften Identität ist, das begreife ich jetzt, meine einzige Verbindung zur Außenwelt, meine einzige Kontaktperson außer den Kindern. Ich muss mit ihm reden, jetzt sofort, ihn fragen, was das alles zu bedeuten hat. Ich räuspere mich, beginne einen Satz. Anna unterbricht mich. „Onkel Malte. Karlsson wünscht sich so gerne was zum Lesen, damit er keine Langeweile hat, weil ich doch morgens in der Schule bin“ erklärt sie ihm. „Außerdem hat er Appetit wie ein ausgewachsenes Schwein, aber Tante Käthe weiß das nicht.“ Ernst Lustig tätschelt ihr beruhigend den Kopf, gibt ihr einen Kuss auf die Stirn und verspricht, sich darum zu kümmern. Bevor ich noch irgendetwas sagen kann, steigt er ins Auto und braust davon. Wir spielen Versteck. Wir spielen Fußball, Jungs gegen Mädchen, wobei ich die Mädchenmannschaft verstärke. Dann zeigen mir die Kinder den Baum, wo sie ihr Baumhaus errichten wollen, und wir suchen in einer alten Scheune Bretter, Nägel, Seile, Werkzeug, und was man sonst noch gebrauchen kann. Die Kinder sind entzückend. Sie behandelten mich wie Ihresgleichen, wie einen willkommenen, etwas ungeschickten Neuankömmling, dem man die einfachsten Dinge erklären muss, aber sie tun es freundschaftlich und zuvorkommend, und immer wieder lassen sie mich wissen, wie froh sie alle seien, dass ich jetzt zu ihnen gehöre, weil ich durch meine Größe und Kraft eine ziemliche Hilfe sein könne. Auf die Idee, dass sie auch von meiner Lebenserfahrung in irgendeiner Weise profitieren könnten, kommen sie nicht. Ich gehe ganz in unserem Spiel auf. Während ich auf der Schulter ein paar Bretter aus der Scheune schleppe, halte ich kurz inne in meinem Spielfieber. Ich spüre, dass ich mich wohl fühle. Ich genieße es, denn Tag im Grünen zu verbringen und zu spielen, anstatt mich durch den Lärm und die Hektik der Großstadt ins Büro zu quälen, und meine neue Aufgabe, das weltcoolste Baumhaus zu bauen, scheint mir plötzlich viel erfüllender und sinnvoller als der Job, mit dem ich in der Vergangenheit mein Geld verdient habe. Ja, ich fühle mich wohl in meinem neuen Leben. Dann ist es Zeit fürs Abendessen. Es gibt reichlich Brot und Käse und Schinken und dazu Tee, diesmal in Mengen zum Sattessen. Ich esse und esse, stopfe Mengen in mich hinein, die die Kinder zum Staunen bringen, bringe sie damit zum Lachen, dass ich in nur drei Hapsen eine ganze Brotscheibe samt Käse vertilgen kann. Anna sitze neben mir kerzengerade mit triumphierendem Lächeln auf den Lippen, sie wirkt mächtig stolz, dass sie dies für mich organisiert hat. Jana versucht hin und wieder meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich beobachte sie. Wenn ihr Blick Annas trifft, weicht sie ihm aus. Ich erkenne keine Missbilligung in ihrem Blick, aber sie wirkt enttäuscht und ein wenig neidisch, dass Anna nun einen tollen Karlsson hat und sie nicht. Ich erinnere mich an ihre Frage, „leihst du mir den Mal?“ Ich frage mich, was Anna den Anderen erzählt hat über den Karlsson, den sie sich gewünscht hat. Was Onkel Malte ihr über mich behauptet hat, über denjenigen, den zu bringen er ihr versprechen musste. Ich verstehe die mir zugedachte Rolle überhaupt nicht: Soll ich ein Vater sein? Ein großer Bruder? Oder ihr kleines Kind? Ein verlässlicher Freund? Ein Statussymbol? Oder eine Phantasiegestalt, die ein bisschen von all diesen Personen enthält? Ich mag sie. Ich will sie nicht enttäuschen. Aber - huiuiui - das ist alles ein bisschen viel verlangt so aus dem Stehgreif. Später wird mir bewusst, wie diszipliniert die Kinder sind. Ruhig und gesittet stopfen sie ihr Essen in sich rein, niemand albert herum, es gibt keinen Streit wie unter Geschwistern in allen Familien, die ich kenne. Und das, obwohl diese Kinder hier völlig auf sich allein gestellt sind, verköstigt von einer buckligen, stummen, alten Frau. Die Sache wird wirklich immer rätselhafter. Ja, Onkel Malte sieht regelmäßig nach dem Rechten, aber er scheint wirklich nur wegen Anna zu kommen. Vermutlich gibt es in der Schule irgendwelche Lehrer, aber ich halte es auch für möglich, dass diese Schule kein bisschen so ist, wie ich sie mir vorstelle. Davon abgesehen bin ich der einzige Erwachsene, aber das zählt auch nicht, denn sie behandeln mich nicht wie einen Erwachsenen. Wer hat ihnen die Regeln beigebracht, an die sie sich ohne Murren halten? Wo haben sie diesen tadellosen Respekt untereinander gelernt? Und wie ist Anna auf die Idee gekommen, sich statt eines Haustieres einen Mann, einen Karlsson, zu wünschen? Der Schlüssel zu dieser letzten Frage ist wiederum Onkel Malte, nicht nur hat er mich ausgesucht und entführt, er ist es auch, der diese Fotos von Anna gemacht hat. Fragen über Fragen, aber keine Zeit zum weiteren Grübeln, denn Anna hat es eilig, ungeduldig zieht sie mich mit kleinen Trippelschritten in ihre Hütte. "Was macht ihr denn?" ruft uns Jana hinterher, Anna dreht sich kurz um und grinst. Dann zieht sie mit großer Geste eine staubige Holzschachtel unter dem Bett hervor. Darin befindet sich eine Sammlung Brettspiele: Halma, Schach, Mühle und Backgammon. Vor allem die Figuren sind beeindruckend. Sie müssen von Hand gedrechselt und geschnitzt worden sein - jede einzelne hat ein bis ins kleinste Detail ausgearbeitetes Gesicht, hinter dem sich ein starker, eigenwilliger Charakter zu verbergen scheint. Anna leuchtet geradezu vor Ergriffenheit, als sie würdevoll die Halmafiguren in Position bringt. Sie muss mir gar nicht erklären, dass diese Spielesammlung eine ganz besondere Bedeutung für sie hat, und dass mir die unermessliche Ehre zukommt, von nun an ihr Spielpartner zu sein. Plötzlich empfinde ich es als höchstes, größtes Glück, in diese Situation gekommen zu sein. Satt zu essen und ein Ehrenplatz an der Seite einer Zehnjährigen, die ich so in mein Herz geschlossen habe, dass man sagen könnte, ich sei verliebt - liegt nicht ein sorgenfreies, erfülltes Leben vor mir? Ich beschließe, mich bei Onkel Malte zu bedanken, dass er mich ausgewählt hat. (5) Am nächsten Morgen versäume ich das Frühstück nicht. Nach einer erholsamen Nacht schlage ich die Augen im gleichen Moment auf wie Anna. Wie richtig sich das anfühlt! Gerne würde ich noch ewig so an ihrer Seite liegen und in den Tag hinein dösen, doch sie drängelt zum Frühstück. Da ist sie wieder, diese unerklärliche Disziplin. Die Schule gibt mir dann doch die Gelegenheit, mich zurück ins Bett zu legen. Die Fragen kehren zurück, und mit ihnen die innere Unruhe. Gerade habe ich mich für Spazierengehen und gegen langes Grübeln entschieden, als es klopft. Ohne auf eine Antwort zu warten, tritt ein kleiner Mann im Blaumann ein, eine Werkzeugkiste und Holzstücke in der Hand. Statt eines Grußes nickt er nur kurz und beginnt damit, aus dem Holz ein Regal zu bauen und es an der Wand zu befestigen. Ist das ein weiterer Stummer, oder ein ganz normaler Handwerker aus dem Dorf, oder könnte er mir meine vielen Fragen beantworten, die mir plötzlich wieder vollkommen präsent sind? Ich spreche ihn an. Er zuckt die Schultern, schüttelt den Kopf. So oft ich versuche, mich mit ihm zu verständigen, wiederholt er immer nur diese Gestik, bis er mit seiner Arbeit fertig ist und verschwindet, ohne sich auch nur mit Blickkontakt zu vergewissern, dass ich mit seinem Werk zufrieden bin. Zum Mittagessen gibt es einen herrlich frischen Salat zu dem kartoffelhaltigen Brei von der Farbe und dem Geschmack zermatschter Rote Bete. Diesmal bekomme ich statt eines Tellers eine riesige Schüssel vorgesetzt, und sie ist so voll, dass ich danach pappsatt bin. Zufrieden sehe ich mich um und lecke mir die Lippen, als ich die erstaunten Blicke der anderen bemerke. 'Wie kann ein einzelner Mensch soviel essen?' sagen diese Blicke. Als wir den Speisesaal verlassen, sehen wir gerade noch Onkel Maltes Cabrio durch die Hofeinfahrt verschwinden, eine Staubwolke hinterlassend, und Anna macht ein enttäuschtes Gesicht. Im Zimmer erwartet mich ein prall gefülltes Bücherregal, er hat eine reichhaltige Auswahl von Klassikern der Weltliteratur hinterlassen, manches kenne ich schon, das meiste noch nicht, und dazwischen ragen Exemplare von „ultimate b.e.a.u.t.y“ und dem Band mit den Werbefotos heraus. Für Anna liegt ein Brief auf dem kleinen Schreibtisch. „Liebe Anna“, schreibt Onkel Malte, „leider bin ich furchtbar in Eile. Sei nicht traurig, ich komme bald wieder, vielleicht schon morgen.“ Anna wirkt besänftigt, scheinbar kennt sie das von Onkel Malte, dass er manchmal zu wenig Zeit mitbringt, obwohl ihr ansonsten die Hektik der Welt außerhalb dieses Bauernhofes vollkommen fremd zu sein scheint. Ich frage mich, wo Ernst Lustig die Aufnahmen von ihr gemacht hat, hier auf dem Hof oder womöglich in seinem Studio. Gerade bin ich im Begriff, den Hintergrund ihrer Bilder in dem Buch nach einem Hinweis abzusuchen, als es aufgeregt an die Tür poltert. „Kommt endlich, das Baumhaus wartet!“ rufen die Jungs. Also toben wir alle zusammen zu unserem auserwählten Baum. Der Stamm ist auf den unteren drei Metern vollkommen astfrei, wir überbrücken sie mit einer Holzleiter. Ab der obersten Sprosse hilft nur Klettern. Justus geht als erster hinauf, geschickt und schnell wie eine Katze. Er befestigt ein Seil, das es uns anderen erleichtert, ihm zu folgen. Zunächst nehmen wir die Gabelung des Stammes in bestimmt sechs, sieben Metern Höhe in Augenschein, die die Kinder als Bauplatz vorgesehen haben, und befinden sie für bestens geeignet. Dann bauen wir einen Flaschenzug, mit dem wir uns und das Material hinauf befördern können. Als wir eine solide Plattform errichtet haben, auf der sich gut die Bodenbretter werden befestigen lassen, gehen uns die Nägel aus. Jonas weiß, wo es noch jede Menge gibt, aber die anderen finden, wir hätten für heute genug geleistet und wollten lieber noch etwas anderes spielen. Wir stehen unterm Baum im Halbschatten. „Was spielen wir denn?“ frage ich. Es ist mir beinahe egal, zu welchem Ergebnis die kurze lebhafte Diskussion führt - Hauptsache spielen. Die Kinder einigen sich auf eine Runde Versteck und eine Runde Fangen. Letzteres wird eine schweißtreibende Sache. Als wir aufhören, rennen die Kinder los, alle auf einmal, Anna und Jana bleiben plötzlich stehen, drehen sich zu mir um, rennen zurück, nehmen mich bei den Händen und zerren mich zu einer riesigen Wanne aus Kupferblech zwischen zwei windschiefen Stallgebäuden. Sie mag einmal als Pferdetränke gedient haben, jetzt ist sie unsere Badewanne, in die Justus und Johannes mit einer antiken Handpumpe Brunnenwasser einlassen. Das Wasser ist bitterkalt und die Situation auch sonst ein wenig unangenehm. Während die Kinder sich unbefangen die Kleider vom Leib reißen, in die Tränke springen und prustend, lachend, kreischend und plantschend eine Menge Spaß haben, kommt es mir schon nicht korrekt vor, sie und ihre Nacktheit dabei zu beobachten, obschon oder eben weil sich vor mir der Inbegriff kindlicher Unbefangenheit und unverdorbener Schönheit entfaltet. Schon gar nicht kann ich mir vorstellen, es ihnen gleichzutun, mich zu ihnen zu gesellen, vergnügt und gedankenlos mit ihnen zu plantschen. Es hilft nicht, dass sie genau dies selbstverständlich von mir erwarten. Anna wirkt ungeduldig, die Anderen werfen mir fragende Blicke aus dem Augenwinkel zu, und irgendjemand tuschelt so laut, dass ich es hören kann: „Ich glaube, Karlsson wäscht sich nie!“ Ich falle schließlich in eine Art Trance, in der es mir gelingt, mich in die mir zugedachte Rolle fallen zu lassen: Ich bleibe angezogen stehen, doch gleichzeitig bade ich nackt, und endlich höre ich auch aus meiner Kehle fröhliches Kichern wie das eines Kindes, bis mir der Schweiß ausbricht und die Zähne klappern. Als wir uns abtrocknen, jeder mit seinem von Tante Käthe bereitgelegten Handtuch, zittere ich vor Kälte und innerer Aufregung. Anna zwinkert mir aufmunternd zu und sagt verständnisvoll:„Du Armer! Was du heute alles mitmachen musst!“ Als wir zu Bett gehen, ist Anna nicht schläfrig wie bisher. Vielleicht ist sie so aufgedreht, weil es auch für sie ein aufregender, aufwühlender Tag war. Jedenfalls besteht sie diesmal auf ihrer Geschichte. Das habe ich befürchtet - ich bin, anders als ihr versprochen wurde, ein miserabler Geschichtenerzähler. Oder besser gesagt: Ich habe noch nie auch nur versucht, jemandem eine Geschichte zu erzählen. „Äh. Ähm. Also“, stottere ich und räuspere mich. In der vagen Hoffnung auf spontane Inspiration beginne ich: „Es war einmal ein Mädchen, das hieß...“ „Anna. Kenne ich schon“, unterbricht sie mich. „Aha. Okay. Also, ähm. Naja.“ Sie rollt bereits mit den Augen, und mir fällt immer noch nichts Besseres ein als: „Es war einmal ein Junge, der hieß...“ „Karlsson“, gähnt sie demonstrativ. „Kenne ich auch schon. Ich will eine neue Geschichte. Eine aufregende Geschichte. Onkel Malte hat gesagt, du bist der weltbeste Geschichtenerzähler, und nun lass mal hören.“ Vor meinem geistigen Auge sehe ich nicht eine gute Geschichte, sondern eher ein schönes Glas trockenen Weißweins. Ich frage, was sie denn gerne hören möchte. Sie rollt wieder mit den Augen und seufzt: „Ich möchte die Geschichte von dem Mädchen, das Pilotin wird und zum Mond fliegt. Oder besser noch die Geschichte von den beiden Jungs, die eine Rakete bauen und zur Sonne fliegen, und als sie dort ankommen, schmilzt die Rakete, weil es auf der Sonne so heiß ist, und dann beschließen die beiden, einfach ohne Rakete zurück zur Erde zu fliegen, und das war eine ganz schön gute Idee von dem einen, findet der andere. Oder die Geschichte von dem Skorpion, der auf Wanderschaft geht, weil es ihm in seiner Steppe so langweilig wurde, und der an einen Fluss kommt, den er nicht überqueren kann, aber er trifft ein Krokodil und fragt, ob es ihn rüberbringt, doch das Krokodil hat Angst, dass der Skorpion es totsticht mit seinem Gift, also sagt der Skorpion, dass er doch nicht verrückt ist, weil sie dann doch beide tot wären, wenn das Krokodil unterwegs stirbt und abgluckert, und so wird der Skorpion von dem Krokodil auf den Rücken genommen, aber auf halber Strecke zum anderen Ufer sticht er das Krokodil tot, und während es stirbt, sagt es noch, Skorpion, warum hast du das gemacht? Und der Skorpion antwortet...“ Anna fallen die Augen zu, ihre Lippen formulieren noch träge und unverständlich die letzten Worte der Geschichte, die ich mir niemals hätte ausdenken können und von der ich mich frage, woher sie sie kennt, bis sie zu meiner Erleichterung einschläft. (6) Der nächste Tag ist ein Samstag. Ich habe zwar jegliches Zeitgefühl verloren, aber die Kinder müssen nicht die Schule. Wir verbringen das Wochenende damit, unser Baumhaus fertigzustellen, und es ist grundsolide, wunderschön und absolut gelungen. Stolz betrachten wir, einander an den Händen haltend, unser Werk von unten, genießen die Aussicht über Felder und Wiesen von oben, und Tante Käthe entpuppt sich als weit weniger mürrisch und griesgrämig, als ich bisher angenommen habe, denn sie schickt uns das komplette Abendessen in einem Korb per Flaschenzug ins Baumhaus, komplett mit Kartoffelchips und Kirschsaft, und erst kurz vor Sonnenuntergang mahnt sie mit erhobenem Zeigefinger, dass die Party jetzt zuende ist, weil kleine Schulkinder nun ins Bett gehören. Am Montagvormittag habe ich endlich Zeit, einen näheren Blick auf meine Bücher zu werfen, und als Erstes wende ich mich Onkel Maltes Bildbänden zu. Die Aufnahmen der Kinder sind fast ausnahmslos draußen entstanden, hier und da ist deutlich ein Strand, eine Düne oder ein Baum zu erkennen, meistens löst sich der Hintergrund, bloße Untermalung kindlicher Schönheit, in völliger Unschärfe auf. Es kann gut sein, dass die Fotos von Anna hier auf dem Hof entstanden sind, schemenhaft sehe ich ein Gebäude, vielleicht die Scheune oder einer der Ställe, aber sicher ist das nicht. Und dann fällt beim Umblättern ein Brief zwischen den Seiten hervor. „Verehrter Freund!“ lese ich, „Ich bin sicher, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Sie werden sich fragen, warum Sie durch mein Handeln aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen und in eine gänzlich neue gebracht wurden. Sie werden sich fragen, was es mit diesem Bauernhof und diesen Kindern auf sich hat. Ich verspreche Ihnen, zu gegebener Zeit all diese Erklärungen abzugeben und ihre Neugier umfassend zu befriedigen. Vorerst muss ich mich damit begnügen, die Gründe zu beschreiben, warum ich Sie ausgewählt habe für dieses Schicksal. Es ist ganz simpel - erstens wusste ich sofort, dass sie nicht abgeneigt sein würden, sondern durchaus aufgeschlossen, den Dingen gegenüber, die Anna mit ihnen zu tun gedachte. Ein biederer, mürrischer, verstockter, konservativer Knochen kam genauso wenig in Frage wie ein besorgter Familienvater, der sich um seine eigenen Kinder zu kümmern hat. Nein, es brauchte einen Mann, der schmachtend vor einem Plakat steht, auf dem ein kleines Mädchen in eine Erdbeere beißt, der sich verzaubern lässt von diesem Plakat, und der sich verzaubern lassen würde von dem tatsächlichen Mädchen. Und zweitens merkte ich schnell: Sie haben ein gutes Herz. Niemals, unter keinen Umständen, würden Sie Anna weh tun, sie benutzen, sie enttäuschen, und darin besteht Ihre Aufgabe, eine Aufgabe, die sie zweifellos so gut erfüllen werden wie kein zweiter, eine Aufgabe, die sie wie gesagt später in vollem Umfang begreifen werden, wenn die Zeit reif ist für Erklärungen. Was Ihr früheres Leben betrifft, da kann ich Sie beruhigen, es ist alles geregelt. Ich habe mir erlaubt, Ihre sämtlichen Verträge zu kündigen, einschließlich des Mietvertrags, mit Ausnahme der Krankenversicherung, deren Kosten ich ab sofort trage für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie trotz der heilsamen Wirkung des Landlebens einmal ärztliche Hilfe benötigen. Ihre gesamte Habe ist verkauft, den Erlös habe ich auf ein separates Konto eingezahlt, das Geld kommt Ihnen und Anna zugute, und was in späteren Jahren davon übrig bleibt, steht Ihnen beiden in vollem Umfang zur Verfügung. Außerdem kann ich berichten, dass ich Ihren Arbeitgeber aufgesucht habe, er war alles andere als begeistert, nachdem Sie bereits mehrere Tage unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben waren, ließ allerdings durchblicken, dass er ohnehin mit Ihren Leistungen unzufrieden und über ihr Verschwinden halbwegs erleichtert war. Er bat mich auszurichten, Sie mögen sich in seinem Betrieb nicht wieder blicken lassen. Wie Sie der prompten Beschaffung dieser kleinen Bibliothek, die sicherlich Ihren Geschmack trifft und Ihrer intellektuellen Erbauung förderlich sein wird, entnehmen können, wird es Ihnen an nichts mangeln, was Anna zu Ihrer Zufriedenheit für nötig befindet. Ich bin sicher, nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung werden Sie ihre Stellung mit niemandem in der Welt tauschen wollen. In tiefer Verbundenheit grüßt: Ihr Ernst Lustig.“ Ich lese den Brief mehrere Male. Erst jetzt wird mir so richtig bewusst, dass ich mich nicht in einem Ferienlager befinde, nicht zu Besuch hier bin, sondern dass jemand mich zwingt, für immer auf diesem primitiven Bauernhof mit einer Gruppe Kinder zu hausen. Als nächstes überkommt mich eine grenzenlose Wut auf diesen Ernst Lustig, angesichts der schier unfassbaren Anmaßung, die dazu gehört, mich hierher zu verfrachten und dann mein komplettes bisheriges Leben in Stücke zu schlagen und zu entsorgen wie einen Haufen Müll, und mir das dann auch noch in der Form mitzuteilen, dass ich beruhigt sein könne, alles sei geregelt. Eines Tages soll er mir das büßen. Für den Moment beschließe ich, zu retten, was noch zu retten ist von meinem Leben. Eines hat er nicht entsorgen können: meine Freundschaften. Es ist völlig klar, ich muss weg von hier, ich muss meine Freunde besuchen, einen nach dem anderen, ihnen erzählen, was passiert ist, auf ihre Hilfe hoffen, wenn es darum geht, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen, nachdem ich unverschuldet obdachlos, arbeitslos und mittellos geworden bin. Ernst Lustig ist ein Betrüger, er muss meine Unterschrift gefälscht haben, ich werde rechtlich gegen ihn vorgehen. Er hat Recht, wenn er davon ausgeht, dass ich Anna nicht enttäuschen, ihr nicht wehtun will, aber nun beherrscht der dringende Wunsch, mich seinen Machenschaften zu entziehen, meine eigene Existenz zurückzugewinnen und ihn dann die volle Härte meiner Rache spüren zu lassen, mein Denken. Ich überarbeite meinen bereits einmal entworfenen Fluchtplan. Anna kommt aus der Schule, stürmt glücklich ins Zimmer, wirft sich aufs Bett, in dem ich immer noch liege und grübele. „Karlsson! Mein lieber Karlsson! Ich bin so froh, dass ich dich habe!“ jubelt sie. Ich erwidere ihre Freude nicht. Statt dessen richte ich mich auf und sehe sie ernst an. Sie merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Ich habe einen fetten Kloß im Hals, und mein Herz klopft wild, als ich mit matter Stimme sage: „Ich muss gehen, Anna. Ich kann nicht länger bei Dir bleiben. Meine Freunde erwarten mich, sie machen sich Sorgen, ich werde zu ihnen gehen.“ Noch nie hat mir etwas solche körperlichen Schmerzen bereitet, nicht einmal der Fahrradunfall vor etlichen Jahren, wie Annas Reaktion auf meine Worte. Mit unbeschreiblicher Fassungslosigkeit im Gesicht wirft sie sich aufs Bett, rollt sich zusammen und beginnt zu schluchzen und hemmungslos zu weinen. Ihr Körper zuckt, ihr Wimmern ist herzzerreißend. Ich lege ihr eine tröstende Hand auf die Schulter, sie schüttelt sie ab. Ich spüre, dass sie mich gerne aus voller Kehle anschreien würde, um ihrer Wut und Enttäuschung Luft zu machen, aber der fürchterliche Weinkrampf, der von ihr Besitz ergriffen hat, lässt es nicht zu. Die Glocke läutet zum Essen, wir ignorieren sie. Ich rede auf sie ein, versuche ihr die Unausweichlichkeit meiner Entscheidung begreiflich zu machen, ohne ihren geliebten Onkel Malte zu erwähnen, es gelingt nicht, in ihrem Tränennebel hört sie mich nicht einmal. Ich bin hin und hergerissen zwischen Gehen und Bleiben, zwischen Annas Welt und meiner. Jemand klopft an die Tür, wirft einen Blick durchs Fenster, zieht sich ratlos und kopfschüttelnd zurück. Im allerletzten Moment, bevor sich die Waage für alle Zeiten zum Bleiben geneigt hätte, nehme ich alle Kräfte zusammen, gebe mir einen Ruck und verlasse, innerlich überzeugt, die richtige Entscheidung zu treffen, das Holzhaus. Das gleißende Sonnenlicht blendet mich, vor meinen feuchten Augen, denn auch ich weine und schluchze, verschwimmt der Hofplatz, auf dem irgendwo die anderen Kinder sein müssen, zu einem grellen Brei aus Lichtreflexen. Unbeholfen taumele ich vorwärts, bis ich mich auf der schmalen, kurvigen Straße befinde, von der ich hoffe, sie wird mich ins nächste Dorf, in die Zivilisation bringen. Ich schleppe mich mehr, als dass ich zielstrebig voranginge. Die Gedanken rotieren in meinem Kopf in immer schnelleren Kreisen, einem Wirbelsturm ähnlich. Die orkanartige Wut auf Onkel Malte wechselt mit der relativen Ruhe der Vorfreude auf ein Treffen mit guten, hilfsbereiten Freunden ab, beides drängt die Erinnerung an die schluchzende, am Boden zerstörte Anna in den Hintergrund, so dass ich aufhören kann zu heulen. Ich konzentriere mich auf mein weiteres Vorgehen. Überlege, an wen ich mich als erstes wenden werde, sobald ich die Stadt erreiche. An Mark, den unerträglichen Wichtigtuer? Jürgen, der sich für nichts anderes interessiert als Fußball? Den Angeber Klaus mit seinen ständig wechselnden Geliebten, denen zweierlei gemeinsam ist, nämlich große Oberweite und kleines Hirn? Peter, der ständig ein langes Gesicht zieht und sein ereignisloses Leben so schwer nimmt, als bestünde es aus Blei? Jochen, der sein Alkoholproblem leugnet und niemandem eine Hilfe sein kann? Georg muss inzwischen aus dem Urlaub zurück sein, Surfen in Australien, oder ist es Snowboarden im Himalaya, er kann von allen am besten zuhören, aber ich habe schon lange den Verdacht, dass er mich in seiner Oberflächlichkeit einfach deshalb nicht unterbricht, weil er eben nicht zuhört, weil er sich kein Stück für seine Mitmenschen interessiert. Oder soll ich auf dem direkten Weg zu Luise gehen, mit der mich einmal eine große Liebe verband, die unter entsetzlichen Eifersuchtsszenen zerbrach, bevor wir unter großem Aufwand eine Basis schufen, auf der wir uns um der alten Zeiten willen gelegentlich zu einem Glas Wein treffen? Oder Helena, mit der ich mich nächtelang prima unterhalten kann, von einem Thema zum nächsten kommend, mit der mich eine wunderbare Übereinstimmung in unserer Sicht auf die Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft verbindet? Niemand kann besser als sie aussprechen, was auch ich empfinde, nämlich dass die Menschen bei allem Individualismus einander immer ähnlicher werden, dass jeder tut was alle tun, dass die ganze Selbstinszenierung eines Klaus oder Georg oder Mark ein einziger großer Selbstbetrug ist, und solche Gespräche beginnen wir mit einem vorzüglichen Essen und spülen den unvermeidlichen Frust mit zwei Flaschen Wein herunter, und dann hören wir wieder wochenlang nichts voneinander, so sehr sind auch wir mit unserer eigenen Selbstinszenierung beschäftigt. Die ganze Sinnlosigkeit meines Vorhabens, mich diesem erbärmlichen Freundeskreis hilfesuchend anzuvertrauen, wird mir in dem Moment noch nicht bewusst, denn ich nähere mich dem Zentrum meines inneren Wirbelsturms, und dort gibt es nur noch einen einzigen Gedanken. Er lautet „Anna!“ „Anna! Anna! Anna!“ denke ich. Ich bleibe stehen. Ich kehre um. Tue zögerlich einen Schritt, einen zweiten. Es fühlt sich ein bisschen besser an, so als hätte ich bisher gegen den Wind angekämpft und hätte ihn nun im Rücken. „Anna!“ denke ich wieder, und nun wird mir in vollem Umfang klar, in welchem Zustand sie sich meinetwegen befindet. Ich renne los. Wie der Teufel lege ich Kilometer um Kilometer zurück. Als ich in vollem Sprint den Hofplatz überquere, nehme ich im Augenwinkel die entgeisterten Blicke von fünf besorgten Kindern wahr. Als ich die Tür erreiche, spüre ich für den kurzen Moment, den ich dazu Zeit habe, mit voller Intensität: dies sind meine Freunde, und niemand sonst, und ich darf nicht zulassen, dass die Machenschaften eines unmöglichen Kerls wie Onkel Malte einen Keil zwischen uns treiben. Ich reiße die Tür auf, völlig erschöpft, außer Atem, dem Kollaps nahe. Welch ein Glück, sie liegt noch da, immer noch weinend, aber regungslos und ruhig atmend. Vielleicht habe ich das gebraucht. So ungeheuerlich ist die Situation, in die ich so plötzlich geraten bin, dass ich einen ernsthaften Versuch unternehmen musste, sie zu verlassen, um wahrhaftig zu begreifen, dass ich nirgendwo so glücklich sein werde wie hier, an Annas Seite. Schwerfällig dreht sie den Kopf, als wolle sie doch mal sehen, wer es da jetzt schon wieder gut mit ihr meint und ihr Tee anbietet, ohne ihr doch eigentlich in ihrem unendlichen Kummer helfen zu können. Und dann ist da wieder dieses ungläubige Blinzeln ihrer Augen, wieder öffnet sich ihr Mund weiter und weiter vor Erstaunen, den Rest kann ich nicht sehen, weil mir die Tränen in die Augen schießen und ich mich auf sie werfe und sie mit aller Kraft in die Arme schließe. Es fühlt sich an, als hätte in Wirklichkeit sie mich verlassen und sei nun zurückgekehrt. Sie kuschelt sich an mich und gluckst. Wir weinen und weinen, alle beide, nicht aus Traurigkeit, es sind Tränen der Rührung und der Fassungslosigkeit und der Freude und wasweißich. Es ist nicht nötig, ihr zu versprechen, dass ich sie niemals wieder verlassen werde, sie weiß es auch so. Es ist nicht nötig, sie um Verzeihung zu bitten, weil ich ihr so weh getan habe, sie versteht es auch so. Als sie mit ihren kleinen Händen zärtlich meine Tränen abwischt: da bin ich ein glücklicher Mensch. Trotzdem schulde ich ihr eine Erklärung. Ich gebe ihr Onkel Maltes Brief. Ich erwarte nicht, dass sie meine Empörung in gleicher Weise nachvollziehen kann, zu wenig weiß sie über mein Leben oder überhaupt das Leben der Erwachsenen in der Stadt, aber dennoch hoffe ich, sie würde mein Verhalten in Ansätzen verstehen. Und das tut sie. Sie liest den Brief mehrmals, wie auch ich ihn mehrmals gelesen habe, mit gerunzelter Stirn und missbilligendem Blick. Dann wirft sie ihn achtlos weg und sieht mich an. Ernst. Nüchtern. „Du bist nur gekommen, weil Onkel Malte dich belogen hat? Weil er dich gezwungen hat?“ Ich nicke. „Und deswegen bist du fortgegangen? Weil du nicht wolltest, dass Onkel Malte dich belügt und dich zwingt und deine Wohnung ausräumt?“ Ich nicke wieder, tief befriedigt über soviel Verständnis. „Aber du bist zurückgekommen.“ Erneut nicke ich. „Aber diesmal nicht wegen Onkel Malte. Jetzt bin ich deinetwegen hier. Weil ich dich gern habe. Weil ich die anderen gern habe. Weil ich gemerkt habe, dass es bei euch viel besser ist als woanders.“ Und dann kuscheln wir uns aneinander und haben uns schlicht und einfach gern, bis die Glocke zum Abendessen schlägt. Hand in Hand schlendern wir über den Hofplatz, und nichts außer unseren vom vielen Weinen immer noch roten Augen erinnert noch an den entsetzlichen Kummer, den wir durchlitten haben. Tante Käthe stellt wieder einmal ihr Einfühlungsvermögen unter Beweis, sie mag weder hören noch sprechen können, aber sie beobachtet genau und liest unsere Stimmungen und Gedanken, denn sie serviert ein wahres Festessen einschließlich der köstlichsten Lasagne, die ich je gegessen habe, zur Nachspeise gibt es Tiramisu, wir trinken Traubensaft und stoßen damit an, als wäre es Wein, und allen ist bewusst, dass heute ein besonderer Tag ist, wenn nach all dem zermatschten Gemüse ein solch exquisites Mahl serviert wird. Als wir fertig sind, erscheint Tante Käthe in der Tür, um den Tisch abzuräumen. Sie ist nicht mürrisch wie sonst immer. Sie lächelt. Umso mehr, als sie sieht, dass ich begonnen habe, die Teller zusammenzustellen und die Kinder eifrig das Besteck in die Dessertschale legen und die Gläser ineinanderstellen und wir den ganzen Krempel in die Küche tragen, neben der Spüle abstellen und auch gleich noch gemeinsam den Abwasch erledigen. Anschließend geben wir alle Tante Käthe einen Kuss, dann gehen wir brav zu Bett. „Sag mal wie heißtn du eigentlich in echt?“ fragt Anna. „Ich mein, ich sag immer Karlsson zu dir, aber vielleicht gefällt dir das gar nicht so gut.“ Ich bin gerührt. Überlege einen Moment. Winke ab. „War am Anfang nicht mein Lieblingsspitzname, aber ich hab mich dran gewöhnt. Vor allem weil es aus deinem Mund wirklich gut klingt. Also wenn du willst, bin ich für den Rest des Lebens dein Karlsson.“ (7) Wir schlafen nicht sofort, Anna und ich. Wir reden. Ich liege auf dem Rücken, erschöpft von den Anstrengungen des Tages, den Kilometern, die ich fortgegangen und wieder zurück gerannt bin, den Emotionen, den Tränen der Verzweiflung, den Tränen der Freude. Ich bin erschöpft und gleichzeitig so entspannt wie selten zuvor, denn hier werde ich bleiben, ohne mir jemals wieder Gedanken zu machen, was anderswo auf mich warten mochte, und das ist doch allemal ein guter Grund, sich entspannt zurückzulehnen. Anna kuschelt sich an mich und versucht sich mein Haar um den Finger zu wickeln. „Sag mal wo kommst du eigentlich her? Also wo wolltest du denn hin, als du noch hier weg wolltest? Bevor du zum Glück gemerkt hast, dass du am liebsten hier bleibst, bei mir, und mein lieber, lieber Karlsson bleibst? Wie war das denn da, wo du vorher gelebt hast?“ Wie soll ich ihr das Leben in der Großstadt beschreiben, dieser hupenden Glitzerwelt totaler Reizüberflutung und der grenzenloser Rücksichtslosigkeit, aber auch der Welt der Kultur, der Museen, Theater, Kinos und spontanen Begegnungen, aus denen sich jederzeit etwas ganz neues ergeben kann, wo Intimität aus Anonymität erwächst, wo sich Menschen aus der ganzen Welt begegnen, und wo am Ende doch wenig übrig bleibt, dem es sich nachzutrauern lohnt, sobald man dieses Leben aufgegeben hat? Wie soll ich das in Worte fassen, die sie versteht, die nicht so klingen, als schilderte ich ihr das Leben auf einem fremden Planeten? „Früher“, beginne ich, „als ich noch jung war, älter als du zwar, aber noch ein junger Mann, gerade mit der Schule fertig: da war alles noch sehr aufregend. Ich ging in die Stadt, um zu studieren.“ „Studieren?“ „Ja, an einer Universität. Das ist wie eine riesige Schule, wo die Menschen weiterlernen, wenn sie mit der eigentlichen Schule fertig sind. Sie haben dann aber nur noch ein Fach, zum Beispiel nur Mathe oder nur Englisch oder nur Technik, und darüber lernen sie alles, was man darüber lernen kann. Danach ist das dann ihr Beruf.“ „Wie, ‚Englisch’ ist doch kein Beruf.“ „Ja, aber Englischlehrer ist einer. Oder Techniker. Oder Fotograf, so wie Onkel Malte, wobei man das nicht an der Universität studiert, sondern in einer kleinen Firma lernt.“ „Und was ist dein Beruf?“ Es ist wie erwartet mühsam. Kaum hat Anna begriffen, dass man seinen Beruf an der Uni studiert, schon erkläre ich ihr, dass die meisten Leute heutzutage etwas ganz arbeiten, als sie studiert haben, Hauptsache sie können mit dem Computer umgehen und haben ein bisschen Organisationstalent. Anna weiß nicht, was ein Computer ist, und so gerät die Schilderung meiner Karriere schnell in eine Sackgasse. Anna stutzt schon wieder, als ich ihr weismachen will, meine Arbeit sei ganz und gar langweilig gewesen und habe überhaupt keinen Spaß gemacht, aber ich habe sie ja machen müssen, um Geld zu verdienen. Auch das ist schwer zu vermitteln mit dem Geld und seiner Notwendigkeit, meine Beschreibung der Mietwohnung in dem großen Haus zwischen anderen großen Häusern, die alle einem anderen gehören, der dafür eben Miete kassiert - das alles ist ihr viel zu abwegig, um es zu glauben. Ich versuche das Thema zu wechseln, bevor sie noch den Eindruck gewinnt, mein früheres Leben sei so schrecklich gewesen, dass ich doch froh sein musste, als Onkel Malte mich befreite. Ich erzähle ihr von meinen Reisen in ferne Länder, wo alles schon wieder ganz anders war, anders als hier auf dem Hof, anders als in meiner Großstadt. „Also hast du ganz schön viel verschiedenes gesehen, ne? Aber was nützt dir das alles, jetzt bist du ja hier und musst nichts weiter können als Spielen und Baumhäuser bauen“, fasst sie zusammen. „Ja, und gerade das habe ich in der ganzen Zeit leider nicht gelernt. Ich lerne es jetzt.“ „Hihi, was für eine Zeitverschwendung. Du hättest schon viel früher herkommen müssen“ triumphiert sie. „Schade, dass du schon mit der ganzen Schule fertig bist, sonst könnten wir da zusammen hingehen. Unsere Schule ist echt toll!“ „Vielleicht kann ich ja mal für einen Tag mit hingehen...nur um mal zu sehen, wie es da ist.“ Sie ist begeistert. „Au ja! Das machen wir! Versprochen? Ich frag gleich morgen die Lehrerin, ob ich dich mitbringen darf!“ „Hast du eigentlich immer schon hier gelebt? Und was ist mit deinen Eltern?“ Immerhin, sie weiß, was Eltern sind. Und sie wird ernst. „Onkel Malte sagt, dass ich mal eine Mama hatte. Einen Papa auch, aber keiner weiß, wer das ist und er weiß nicht, dass er mein Papa ist. Vielleicht gibt es ihn auch gar nicht mehr, so wie Mama, die gibts nämlich nicht mehr, sie ist...“ „Gestorben?“ Sie nickt. „Onkel Malte sagt, da war ich noch ganz klein, so klein, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. Kann ich nämlich auch wirklich nicht. Onkel Malte sagt, ich hab mit ihr in der Stadt gelebt, das war wohl so eine komische Stadt wie wo du herkommst, dann hatte Mama einen Unfall und war weg. Onkel Malte sagt, er hat mich hierher gebracht, und das ist alles, was ich weiß.“ „Wie, du warst noch so ganz klein und hast schon allein hier in diesem kleinen Häuschen gelebt? Von wem hast du denn das alles gelernt, was kleine Kinder noch nicht können? Laufen, sprechen...“ Sie stützt sich auf die Ellbogen und sieht mich an. „Da waren doch damals noch die anderen Kinder. Die waren älter. Naja, sie sind jetzt weg, in die Stadt gegangen oder so, keine Ahnung. Die waren damals vielleicht so groß wie ich jetzt, und die haben uns Kleineren ganz viel beigebracht.“ Sie zuckt mit den Schultern. „Du wunderst dich über so viele ganz normale Sachen“, stellt sie fest. „Ja, das kommt, weil ich ganz anders groß geworden bin. Mit meinen Eltern, und mit lauter anderen Erwachsenen um mich herum. Ihr hier seid die ersten Kinder, die ich kenne, die ohne Erwachsene aufwachsen. Darum wundert mich so vieles, weil das alles neu für mich ist, obwohl es für dich völlig normal ist.“ „Du bistn komischer Kerl, Karlsson“ sagt sie, „aber vor allem n ganz toller Kerl! Und und übrigens weißt du was? Du bist auch doch ein weltbester Geschichtenerzähler. Du darfst nur nicht anfangen mit 'Es war einmal...'“ Wir reden noch eine ganze Weile. Als Anna schon ganz müde aussieht und auch mir beinahe die Augen zufallen, kommt mir doch noch eine ganz drängende Frage in den Sinn. „Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dir von Onkel Malte einen Karlsson zu wünschen? Ich meine, die anderen Kinder hier haben das ja wohl nicht.“ Anna seufzt. „Da muss ich dir erstmal von Maria erzählen“ sagte sie matt, „aber nicht jetzt. Von Maria kann man nur erzählen, wenn man ausgeschlafen ist und ganz viel Zeit hat.“ Und damit dreht sie sich um uns schläft ein. (8) Am nächsten Tag, kurz nach dem Mittagessen, kommt Onkel Malte. Ich beobachte Anna aufmerksam. Sie hat ihm eine Menge zu verdanken, ihr Leben auf diesem Hof, mich, und er hat ihr nie etwas Böses getan. Aber seit sie weiß, wie er mich ausgetrickst hat, ist sie ungnädig. Sie ist mehr als reserviert. Anstatt zu ihm zu laufen, kaum dass er aus dem Auto gestiegen ist, und ihm aufgeregt um den Hals zu fallen, bleibt sie vor dem Haus stehen und verschränkt die Arme. „Na so was“, ruft er, mit seinem schmierigen Grinsen auf sie zukommend, „will meine kleine Prinzessin mir denn gar nicht guten Tag sagen?“ Anna schweigt und spuckt voller Verachtung auf den staubigen Boden. Onkel Malte sieht mich an, und da begreift er wohl, dass sein unverschämter Brief ein schwerer Fehler war. Anna geht ins Haus. Die anderen Kinder wenden sich wieder dem zu, womit sie gerade beschäftigt sind. Ich zucke die Schultern, dann folge ich Anna. Sie schnieft. Ich lege ihr eine Hand in den Nacken. Ich kraule sie, tröstend, wie ich meine, aber sie ist gefasst. "Es ist eine schwer wiegende Entscheidung", sagt sie nur. Auf dem Hof liegt ein einsamer Strauß Rosen, zu schön und zu wohlriechend, um ihn mitsamt der hübschen Karte, auf der Onkel Maltes Entschuldigung in geschwungenen Lettern formuliert ist, achtlos liegen zu lassen. Sie hebt ihn nicht auf. Sie tritt mit gummibestiefelten Füßchen wütend darauf herum, bis seine Schönheit restlos dahin ist. Nun kann er wahrhaftig liegen bleiben. Am folgenden Tag sitzen wir im Baumhaus und lassen die Füße baumeln. Über uns flattern aufgeregt zwitschernde Vögel. Wir hören das Cabrio nicht, hören nicht die Schritte, also sehen wir auch nicht Onkel Maltes Gesicht, als er die verdörrten Rosenreste findet. Was mag er als erstes empfinden - Enttäuschung? Trauer? Einen Kloß im Hals? Was immer es ist - als er von unter dem Baum Annas Namen ruft, klingt seine Stimme verbittert. Anna muss nichts weiter tun, als die Strickleiter aufholen und ihn ignorieren. "Willst du dich nicht wieder mit ihm vertragen?" schlage ich in meiner Naivität vor. Sie schüttelt den Kopf. "Wir brauchen ihn", insistiere ich. "Es ist eine schwer wiegende Entscheidung", wiederholt sie und wirkt so ernst, wie ich sie noch nie erlebt habe. Die Vögel zwitschern, als wäre nichts geschehen. Anna kuschelt sich an mich und schläft ein. "Maria", sagt sie lächelnd, als sie die Augen aufschlägt. "Ich will dir von Maria erzählen." "Maria hat hier gewohnt. Sie war toll. Sie hat mir alles erklärt und gezeigt, alles. Sie hat sich immer um mich gekümmert, immer." "Die Holzkiste mit den Spielen ist von ihr?" Anna nickt aufgeregt. "Wir haben immer zusammen gespielt, ohne die anderen. Das war toll. Und dann hat sie mir ihr Geheimnis verraten: Sie hatte einen Freund. Sie hat sich oft heimlich weggeschlichen, um ihn zu treffen. Er war älter. Viel älter. Er war ihr bester Freund, und ein bisschen auch ihr großer Bruder und ihr Vater und ihr Opa. Er versprach, sie zu sich zu nehmen. Aber sie musste lange warten. Man geht hier nicht so einfach weg. Man muss erst alt genug sein. Maria tat mir so leid. Sie wollte so gerne zu diesem Mann, doch sie wollte auch uns nicht aufgeben. Ihre Freunde. Mich. Es machte sie traurig, zwei schöne Sachen nicht gleichzeitig haben zu können. Jede Nacht habe ich geträumt, wie es wäre, einen Freund zu haben, so wie Maria. Einen der mit mir spielt. Einen, der mir hilft, wenn ich von hier fortgehe. Einen, der dann zu mir hält. Irgendwann ging sie dann doch. Aber ihr Freund, der hatte nicht gewartet. Der war einfach verschwunden. Weg. Trotzdem ging Maria, denn man kann nicht einfach für immer hier bleiben. Wenn man alt genug ist, dann muss man los. Zum Abschied sagte sie mir: 'Wenn du einen Freund hast, wie ich einen hatte, dann warte nicht so lange.' Da wusste ich, dass mein Freund hier bei mir wohnen musste. Ich sprach mit Onkel Malte darüber. Und jetzt bist du hier." (9) Selten bin ich eine so sonderbare Erscheinung begegnet wie diesem Fräulein Lehrerin. Sie ist klein und trägt ein grünes Kostüm, das in einem längst vergangenen Jahrzehnt der letzte Schrei der Pariser Frühjahrsmode gewesen sein muss. Ihr blasses Gesicht kontrastiert mit dem brüllend roten Lippenstift, den sie großflächig über Mund und Schneidezähne geschmiert hat. Ihre Stimme ist schrill und nasal und von leidlich unangenehmen Ton, doch gleichzeitig verrät sie einen ehrlichen Enthusiasmus, wenn es um den Lernstoff geht. In der Tat scheint nichts anderes sie zu tangieren. Von den Kindern nimmt sie kaum Notiz, es entgeht ihr völlig, dass jemand Neues in der Klasse sitzt (nämlich ich), hingegen schwärmt sie geradezu von der unübertrefflichen Schönheit der Kreise und Kreisbögen, aus denen sie blumenartige Muster zusammenzirkelt, die, so ist ihre Hoffnung, die Kinder mit ähnlicher Begeisterung nachvollziehen werden. Während das Fräulein versonnen die Tafel betrachtet, meldet sich gelegentlich eines der Kinder zu Wort, um eine ungehörte Frage zu stellen oder eine unverlangte Antwort zu geben. Sie heben den Arm, warten, ob noch ein anderer etwas mitzuteilen hat, dann sprechen sie. Nach dieser Farce von Unterrichtsstunde geht es weiter mit deutscher Grammatik. Das gleiche Fräulein trägt ein Kleid von identischem Schnitt, doch diesmal ist es von blauer Farbe. In diesem Fach lässt sich sprachliche Interaktion nicht vollständig vermeiden, doch die Lehrerin erfreut sich der lebhaften Zuordnungen von Subjekt, Prädikat, Objekt, Wem-Fall und Wes-Fall, ohne es jedoch mit der Korrektur von Fehlern auch nur im Entferntesten genau zu nehmen. Ich beteilige mich, rufe willkürlich "Wurmfall" und "Wurmfortsatz", meine Freundinnen und Freunde sehen mich nur kurz erschrocken an, ehe sie das Spiel mit immer absurderen Kreationen zu höchster Lebhaftigkeit treiben, und unsere Lehrerin ist überglücklich ob dieser ungeahnten Aktivität. Lediglich die vier Schüler aus dem Dorf beteiligen sich nicht. Sie sitzen ein wenig abseits am Fenster, tuscheln untereinander und schreiben eifrig jedes gesagte Wort in ihre Hefte. (10) Wir sitzen auf der Mauer, die das Grundstück umgibt, alle acht nebeneinander, essen Pflaumen frisch vom Baum und spucken die Kerne auf die Straße. Wann immer ein Auto vorbeikommt, nicht öfter als einmal jede Stunde, versuchen wir es zu treffen; eben ist mein Kern unter großem Jubel der Kinder durch das offene Seitenfenster geflogen. Ich erzähle, wie ich früher, in meinem Leben in der Stadt, vom Balkon im ersten Stock Kirschkerne in die Cabrios spucken konnte, am liebsten dem Angeber am Steuer auf seinen hellen Smoking. Es geht auf den Herbst zu, aber noch ist es warm und sonnig. „Was machen wir eigentlich, wenn es demnächst kalt wird und in Strömen gießt?“ erkundige ich mich. Es beruhigt mich, dass wir in der Scheune spielen können und uns nachher in unseren Häusern aufwärmen, es gibt reichlich Brennholz, auch der Speisesaal wird beheizt, und das Wasser für die Dusche wird ebenfalls warm sein. Ich gehe völlig darin auf, mit den Kindern zu spielen und herumzualbern. Anna liest gerade Hemingways „Wem die Stunde schlägt“ aus meinem vom unsäglichen Onkel Malte gestifteten Bücherregal und hat das dringende Bedürfnis, sich mit mir über den spanischen Bürgerkrieg zu unterhalten anstatt über Johannes’ Gesicht, als Jule ihm den Regenwurm in die Hose steckte. Als ich sie frage, was sie sich zum Geburtstag wünscht, zischt sie: „Dass du ausnahmsweise mal nicht ganz so albern bist.“ Ich muss ein ziemlich betroffenes, fast erschrockenes Gesicht machen, denn sie besänftigt mich gleich mit einer liebevollen Umarmung, bevor sie fröhlich hinzufügt: „Naja, war nicht so gemeint. Ich denk nur grad so oft an Maria. Wo die wohl jetzt ist?" Seufzend fügt sie hinzu: "Problem ist auch, ich weiß nicht, wann ich Geburtstag hab.“ Wir einigen uns auf ein Weihnachtsgeschenk. Eine Limousine kommt die Straße herauf, Pflaumenkerne fliegen aus unseren Mündern und verfehlen ihr Ziel, dann bremst der Wagen zu unserem Schrecken und biegt in den Hofplatz ab. Wir sehen, wie ein Mann im Anzug aussteigt und sich umsieht. „Was will der Typ nur? Wir haben ihn doch nichtmal getroffen“, protestiert Justus. Ich sage, „ich glaube, der ist nicht wegen den Pflaumenkernen hier“, und die anderen stimmen zu, denn jetzt steigt ein Mädchen von vielleicht zehn Jahren aus. Sie trägt enge Jeans, ein schlichtes, weißes T-Shirt, und drückt krampfhaft einen Teddy an ihre Brust. Ihre langen, braunen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ihr rundes Gesicht sieht schon aus der Entfernung megatraurig aus. Anna und Jana springen als erste von der Mauer und rennen hin. Als wir alle den Mann und das Mädchen umringen und die Traurigkeit in ihrem, den Ernst in seinem Gesicht aus der Nähe sehen, sagt der Typ im Anzug: „Das ist Leonie. Sie hat ihre Eltern verloren und wird ab heute bei euch wohnen. Ihr werdet doch nett zu ihr sein, oder?“ Seine Stimme klingt überzeugend: warm und freundlich und dabei doch bestimmt und fest, und es genügt ein einziger Blick auf Leonie, um sie für alle Zeiten ins Herz zu schließen. Die Jungs beeilen sich, ihr Gepäck aus dem Kofferraum zu hieven, die Mädchen nehmen sie bei der Hand, und ich gehe voran, um die Tür zu dem Häuschen zu öffnen, in dem Leonie wohnen wird. Der Mann, überzeugt, dass sie es gut bei uns haben wird, winkt ihr ein letztes Mal aufmunternd zu, steigt in den Wagen und braust davon. So sehr sich alle um sie bemühen, Leonie spicht in den ersten Tagen kein Wort. Bei den Mahlzeiten bringt sie keinen Bissen runter, obwohl sie freundlich lächelnd am Tisch erscheint. Wir leisten ihr Gesellschaft, wir lassen sie in Ruhe, wir reden auf sie ein, wir schweigen, aber nichts lockt sie aus der Hülle ihrer Trauer. Anna spricht aus, was wir alle denken: "Sie hat Dinge erlebt, von denen wir anderen nichts ahnen." (11) Das Laub beginnt sich zu verfärben, und die Kinder holen ihre Wollpullover, ihre dicken Socken und ihre Strumpfhosen aus den Schränken. Anna strickt mir einen Pullover, er ist dunkelgrau, fast schwarz, mit einem leuchtend roten Herz auf der Vorderseite. "Damit mein geliebter Karlsson nicht friert", sagt sie, als ihn mir freudestrahlend überreicht. Sie könnte hinzufügen, "damit mein geliebter Karlsson genauso angezogen ist wie alle Kinder hier." Warme Kleidung habe ich als einziger genug, aber ich trage nur noch diesen Pullover, Annas Pullover, das schönste Geschenk, das ich je erhalten habe. Mit der Strumpfhose hilft mir Tante Käthe aus. Ihrem traurigen Lächeln, mit dem sie sie mir gibt, entnehme ich, dass sie einst ihrem Mann oder Sohn gehört hat. Ich habe mich durch Onkel Maltes Büchersammlung gelesen. Nachschub ist ja nun nicht zu erwarten. Ich säge zum Zeitvertreib Brennholz und baue aus alten Balken und einer Plane, die ich in der Scheune fand, einen Regenschutz über dem Hofplatz, während Anna in der Schule ist. Wir spielen jetzt manchmal in einem der Häuser, und ich helfe nicht mehr nur Anna, sondern allen bei den Hausaufgaben. Alle strahlen eine seltsame Vorfreude aus. Auf den Winter, aufs Schlittenfahren, auf Weihnachten, darauf, dass später dann der Frühling kommt. Der erste Schnee fällt schon im November, und es bleibt soviel liegen, dass wir um die Wetter Schneemänner bauen: Annas und meiner ist der größte, Justus' und Janas hat das originellste Gesicht, Jules und Judiths der lustigste, Jonas' und Johannes' der kleinste, so haben wir alle gewonnen. Beim Abendessen ist Tante Käthe blass und bewegt sich schwerfällig. Ich will sie fragen, ob alles in Ordnung sei, ob sie sich nicht gut fühle, aber wie fragt man das eine taubstumme alte Frau? Am nächsten Morgen stehen wir ratlos um den Esstisch herum. Kein Frühstück. "Tante Käthe ist tot", spricht Johannes aus, was alle denken. "Mausetot", sagt Judith. "Aber sowas von", fügt Jana hinzu. Jule öffnet die Küchentür. Da sitzt Tante Käthe, auf ihrem Schaukelstuhl ausgestreckt, das fassungslose Entsetzen ihres letzten, mühevollen Atemzugs noch im Gesicht. Ihr lebloser Körper ist kalt, die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Wortlos vergraben wir sie am Waldrand. Wir sprechen nicht darüber, was nun wird. Jede und jeder für sich gehen wir davon aus, dass man uns eine neue Tante Käthe schicken wird, ganz bald schon, wenn nicht morgen, dann eben am folgenden Tag. Bis dahin machen wir unser Essen selbst. Die Speisekammer ist einigermaßen voll, Brennholz gibt es genug, und in der Scheune finden wir einen riesigen Vorrat an Klopapier. Als es an Weihnachten weder Geschenke noch den üblichen Gänsebraten gibt, sondern nur das kärgliche Mahl, das wir aus unseren zur Neige gehenden Vorräten zusammenstellen, da wird uns bewusst, dass man uns vergessen hat. Oder besser gesagt, dass niemand weiß, dass Tante Käthe nicht mehr bei uns ist, dass es außer ihr ohnehin niemanden gibt, der sich um uns kümmert. "Das ist ja mal eine schöne Scheiße", sagt Judith, und niemand widerspricht, obwohl man sowas doch eigentlich nicht sagen darf. Anna und Jana ziehen los, um Tannenzweige zu suchen. Jonas findet in der Küche ein paar Kerzen. Und ich entdecke das kleine Haus, das schon halb im Wald steht und in das sich noch nie eines der Kinder hinein gewagt hat, weil nicht sicher war, ob da Tante Käthe wohnt oder doch eher der Böse Wolf, oder vielleicht ganz jemand Fremdes oder die Geister von jemand ganz totes Fremdes. Das Haus steht weitgehend leer, doch in der Küche schnurrt ein Gefrierschrank. Darin finde ich zwei gefrorene Hähnchen, drei Stück Butter und eine Packung Schokoladeneis. So können wir doch noch anständig Weihnachten feiern, mit Grillhähnchen und Apfelkuchen nach frei erfundenem Rezept und einer richtigen Nachspeise. Leonies Augen leuchten. "So schön war Weihnachten früher nie", flüstert sie, und dass sie überhaupt etwas sagt, und dann noch etwas so Tolles, ist für uns Geschenk genug. An Neujahr malen Anna und Judith auf unser letztes Papier einen Kalender. "Damit wir wissen, wann nächstes Mal Weihnachten ist", erklären sie eifrig, aber aller Eifer kann nicht ihre Nachdenklichkeit verbergen. "So geht es nicht weiter", spreche ich aus, was alle denken. Sieben Augenpaare sehen mich erwartungsvoll an, doch eine richtige Lösung weiß ich nicht. "Könnt ihr nicht mit eurer Lehrerin sprechen? Ihr sagen, in was für eine Misere wir stecken?" (12) Wir liegen unter der zu kurzen Decke im viel zu kleinen Bett, Anna und ich, und wärmen einander, so gut wir es vermögen. Die seltsame Reaktion der Kinder, als ich nach der Lehrerin fragte, geht mir nicht aus dem Kopf. Ich frage Anna. "Aber die Lehrerin kommt doch schon seit Monaten nicht mehr!", empört sie sich. Mir steht der Mund offen, während ich nach Worten suche. Fragen über Fragen: Was ist mit ihr geschehen? Warum erfahre ich davon nichts? Warum gingen die Kinder dennoch jeden Tag zur Schule, bis die Weihnachtsferien begannen? Anna erklärt mir geduldig, dass die Lehrerin nicht mehr gekommen ist, seit Tante Käthe gestorben ist. Auch die vier aus dem Dorf sind seither nicht mehr erschienen. Es ist aber doch gar keine Frage, dass Kinder in die Schule müssen, also gingen sie jeden Morgen hin und blieben bis mittags, auch wenn es ein wenig langweilig war, wenn niemals Unterricht stattfand. Und warum mir das erzählen? Ich habe mit der Schule nichts zu schaffen und genügend andere Sorgen im Kopf. "Meinst du, das hat etwas miteinander zu tun?", frage ich vorsichtig, "Tante Käthes Tod und das Verschwinden der Lehrerin?" "Natürlich hat es das", flüstert Anna. Sie nimmt Onkel Maltes Bildband, in dem ich schon lange nicht mehr geblättert habe, und schlägt eine der hinteren Seiten auf. Tatsächlich, da sind sie: Tante Käthe, die Lehrerin, die vier Kinder aus dem Dorf. (13) Der Schnee türmt sich meterhoch. Er ist schön anzusehen in der kalten, klaren Wintersonne, doch bald lassen sich unsere Türen nur noch mit Mühe bewegen, so sehr presst sich das weiße Kleid von außen dagegen. Den Schnee zu entfernen, vermögen wir nicht. Einen nach der anderen verlässt die Kraft. Justus liegt mit seit Tagen im Bett, geplagt von Schüttelfrost und Schweißausbrüchen. Auch bei Judith beginnt das Fieber. Leonie und Johannes zittern vor Kälte und jammern vor Hunger. Anna und ich haben es noch am besten, Tag und Nacht wärmen wir einander und lenken uns mit Geschichten von unserem Kummer ab. Doch selbst Anna strahlt längst nicht mehr die Willenskraft und den unerschütterlichen Optimismus aus, den ich von ihr kenne. Es ist lange her, seit sie mir zum letzten Mal ihr überwältigendes Lächeln geschenkt hat, so lange, dass ich den Anlass vergessen habe, doch die Erinnerung ist stark genug, um mich vor meinem geistigen Auge immer wieder daran zu erfreuen, wenn der Kummer und die Angst vor der Zukunft mich verzweifeln lassen. Mit unserer unbeschwerten Kindheit ist es unzweifelhaft vorbei. Nun gilt es zu verhindern, dass auf sie der sichere Tod folgt. Nur einer kann uns noch helfen, oder besser gesagt, meine Ersparnisse, meine Identität, und die liegen in seiner Hand, in der Hand des in Ungnade Gefallen, dessen Name in Annas Anwesenheit nicht erwähnt werden darf. Einmal habe ich es bereits gewagt und sie dadurch so sehr verstimmt, dass man von unserem ersten und einzigen Streit sprechen kann. Es widerspricht ihrem Stolz, sich einzugestehen, dass sie, dass wir alle, von ihm abhängig sind. Doch ich habe nicht vor, Ernst Lustig anzuflehen und um Almosen zu betteln. Es ist hingegen unumgänglich, ihn aufzusuchen und zu nehmen, was mir von Rechts wegen ohnehin zusteht, was er sich auf heimtückische Weise angeeignet hat, verbunden mit jener selbstgerechten Erklärung, die Anna schließlich so gegen ihn aufgebrachte. Unser Beschluss fällt einstimmig aus. Und so mache ich mich an einem trüben Tag, an dem der Schnee zu schmelzen beginnt und die dunklen Wolken so gar nicht hoffnungsvoll stimmen, auf den langen, beschwerlichen und mir völlig unbekannten Weg in die Stadt. Es ist der Akt einer Verzweiflung, die meinem von Hunger und Kälte geschwächten Körper ungeahnte Kräfte verleiht, jedoch um den Preis, dass ich laufe und laufe, ohne mir auch nur die vagesten Gedanken darüber zu machen, wie ich Onkel Malte zur Herausgabe des Geldes überreden werde. Gelegentlich treffe ich Menschen, die, in dicke Kleidung gepackt und missmutigen Blickes in diese oder jene Richtung hasten. Ich frage sie nach dem Weg, doch sie murmeln unverständliche Dinge und eilen davon. Es scheint ihnen wohl absurd, bei diesem Wetter hinauszugehen, ohne das Ziel, geschweige denn den Weg dorthin, in allen Details genauestens zu kennen. Gegen Abend friert es wieder, und ein grimmiger Wind setzt ein. Der Schnee knirscht unter meinen Füßen, und meine Haut möchte beinahe zerplatzen von der eisigen Luft, die mir wie die Klaue eines zornigen Raubtieres ins Gesicht schlägt. Einzig der Gedanke an Anna hält mich aufrecht in dieser schlimmsten aller Nächte. Ich sehe sie vor mir in ihrer kindlichen Freude an dem Tag, als Onkel Malte mich zu ihr brachte. Ich sehe ihre traurige Mutlosigkeit, die in den letzten Tagen doch endlich auch von ihr Besitz ergriffen hat. Ihretwegen setze ich meinen Weg fort und immer weiter fort, ohne ein einziges Mal am Sinn meines Tuns zu zweifeln in dieser stockfinsteren Nacht, in der ich kaum einen Schritt weit voraus sehen kann, denn ich weiß, ich werde Anna wiedersehen, wenn ich nur in die Stadt komme und von dort wieder zurück, mit oder ohne Ersparnisse. Gegen Morgengrauen sehe ich deutlich den Lichtschein der Großstadt. Bis zum Mittag noch muss ich laufen, dann befinde ich mich in den einst vertrauten Straßen, die mir jetzt vorkommen wie Schluchten auf einem fremden, unwirtlichen Planeten. Die Eisluft ist meinen Lungen nicht gut bekommen, das merke ich jetzt, als ich versuche, kurz vor dem Ziel einige tiefe Atemzüge zu tätigen. Keuchend, mit einem Stechen in der Brust und einem Pochen im Schädel, erreiche ich die Freitreppe zum Atelier. Meine Kraft schwindet mit jeder Stufe, und dann lese ich statt des vertrauten, verhassten Namens auf dem Messingschild einen anderen, "Mies und Schlecht, Unternehmensberatung" steht da, und ich fühle mich mies, und mir wird schlecht, ich würde mich übergeben, wenn mein Magen einen Inhalt hätte, den ich emporwürgen und ausspucken könnte. Zunächst nehme ich an, ich hätte mich geirrt, der einstmals vertrauten Umgebung so entwöhnt, dass ich zielstrebig in einen gänzlich falschen Innenhof abgebogen sei, in der verkehrten Straße, in einem vollkommen anderen Teil der monströsen Stadt. Dann wieder zweifle ich an einem solchen Irrtum, und schließlich besinne ich mich darauf, dass sich alles aufklären würde, wenn ich nur nachfragte bei den klugen Leuten in diesem Büro. Drinnen ist es unerträglich hell und irrsinnig heiß. Eine Reihe fleißiger Menschen geht vor meinen blinzelnden Augen Verrichtungen nach. Ihre farbenfrohe Kleidung wirkt ununterscheidbar, in ihren eifrigen Bewegungen verschwimmen sie zu Schemen, sie sind kaum anders als die tiefen Wolken, die der Nordwind durcheinanderschiebt, in Fetzen reißt und neu zusammensetzt, und dabei unaufhörlich vorantreibt, auf ein von niemandem hinterfragtes Ziel zu. Eine junge Frau an einem Empfangstresen sieht mich erwartungsvoll an, ihr künstliches Lächeln ist abschreckend, und die Sorgenfalte auf ihrer Stirn verrät den Zwiespalt, in dem sie sich befindet: Sicher ist sie angehalten, jeden Besucher mit der gleichen, routinierten Freundlichkeit zu empfangen, doch selbst ihr scheint es zweifelhaft, ob das Geheiß auch für diesen Besucher gilt, dessen Kreislauf dem Kollaps nahe ist und dessen verschlissene, verschmutzte Kleidung wohl kaum den Abschluss eines lukrativen Geschäftes erwarten lässt. Gleichwohl holt mich diese Begegnung auf eigentümliche Weise in die Gegenwart zurück, wie ich feststelle, als ich diese Überlegungen zu den Beweggründen der jungen Frau anstelle. So merke ich bereits, dass die Schemen innehalten und mich misstrauisch anstarren, bevor ich auf die Frage "Kann ich Ihnen helfen?" eine Antwort gebe. "Ich suche den Fotografen, dessen Atelier sich hier befunden hat", sage ich mit einer Stimme, die in meinen eigenen Ohren fremd klingt. Das Lächeln der jungen Frau gefriert, für ein solches Anliegen ist sie nicht trainiert, doch ein anderer erbarmt sich ihrer und antwortet an ihrer Statt: "Fotografen kommen und gehen", sagt er lapidar und reibt sich nachdenklich das Kinn. "Dieser zum Beispiel ist gegangen, und niemand weiß wohin. Ich bin versucht, meine Geschichte zu erzählen in der Absicht, doch wenigstens ein klein wenig Unterstützung zu erbitten, ein Almosen vielleicht, doch einen vagen Hinweis, wo es lohnen könnte, nach Ernst Lustig zu suchen, oder eine Fahrt in einer edlen Limousine zurück zu Anna und den Kindern. Doch meine Geschichte ist so außergewöhnlich, dass ich sie, wie mir rechtzeitig bewusst wird, eine ganze Weile selbst nicht glauben mochte. Sie dürfte kaum dazu angetan sein, das Vertrauen dieses Mannes zu gewinnen, der gleichwohl von einer Alltäglichkeit schon gar nicht aus seiner geschäftigen Routine zu reißen wäre, denn längst hat er sich wieder abgewandt, um seine begonnene Tätigkeit fortzusetzen. Inzwischen hat sich im Hintergrund eine gewaltige Frau erhoben. Sie trägt einen feinen, grauen Anzug aus grün glitzerndem Samt und schüttelt ihre Mähne, so heftig, dass der goldene Glanz hinausgeschüttelt wird und schlohweiße Bitternis bleibt, als ihre ungeduldige Stimme ertönt: "Veronika - gibt's Ärger da?" Ich bleibe Veronika, die ihr gequältes Lächeln wiedergefunden hat, einen Gruß schuldig. Hinaus in die Kälte ist das Beste, das mir einfällt. Und dann gehe ich den ganzen, langen Weg zurück, über verschneite Felder und durch blattlose Wälder, entlang schlammiger Wege und brüchiger Straßen, durch die Nacht und durch den Winter, um mit leeren Händen vor den Kindern zu erscheinen. Bisweilen taumelnd und stolpernd, gelegentlich schlitternd und beinahe fallend, das unausweichliche Ende dicht vor Augen, setze ich einen kraftlosen Fuß vor den nächsten, und was mich als Einziges dabei noch antreibt, ist der Gedanke an Anna, an die Wiedersehensfreude, an die Erleichterung. Je näher ich dem Hof komme, um so klarer wird mir bewusst, dass sie sich nicht für eine Sekunde an die Hoffnung geklammert hat, ich könnte in der Stadt unsere Rettung finden, und so wird sie auch nicht enttäuscht sein, wenn sich ihre Erwartung bestätigt. Als ich dann vor ihr stehe, ausgemergelt, aber lebendig, vollbringt sie das Wunder, auf das wir alle gewartet haben, denn ihr Leuchten hüllt die Welt in hellen Schein, und ihre Wärme bringt den Schnee zum Schmelzen, und unter seiner Erbarmungslosigkeit sprießt das frische Grün des Versprechens darauf, dass es weitergeht, wenngleich anders als bisher. Der Bach beginnt von Neuem zu fließen, gierig springen die Forellen an die Angelhaken, ein Wirbelwind bläst Mehl in die Küche und bäckt es zu kräftigendem Brot, das die Kranken gesunden lässt und die Gesunden vor Freude ins Baumhaus treibt, um die wiedererstandene Welt von oben betrachten zu können. Wir fassen uns an den Händen. Krokusse sprießen in allen vier Ecken des Hofplatzes, leuchtend gelb und üppig violett. Es sind kräftige Farbkleckse, zwischen denen wir aufsammeln, was der Schnee verborgen hatte, was von der Unbeschwertheit des Sommers, was von unserer Kindheit übrig geblieben ist, verwitterte Papierschnipsel und rostige Nägel. * "Geht es Ihnen nicht gut?" Erschrocken rappele ich mich auf von der Bank, auf der ich wohl eingeschlafen sein muss, und vor mir, an der Littfasssäule mit dem magischen Plakat, auf dem ein zauberhaftes Mädchen eine köstliche Erdbeere nascht, steht ein anderes Kind und sieht mich sorgenvoll an. "Doch", sage ich, "ich habe geträumt." |
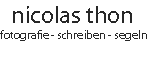 |
|||||
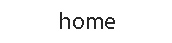 |
 |
 |
 |
 |

|
Das Plakat