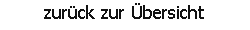| Die Ente Eine Geschichte, die von fast keiner Ente handelt. Ich habe mich kurz gefasst, damit kein Roman daraus wird, nun fehlen die Tempowechsel - das könnt Ihr kompensieren, wenn ihr langsam lest! Über Feedback freut sich: Nicolas Thon Vollständiger Text:Franks freier Freitag beginnt mit der Frage, ob er zuerst die wenigen Erledigungen erledigen und sich anschließend entspannen soll, oder umgekehrt, was automatisch überleitet zu der Überlegung: Wie entspannt man? Indem man etwas Schönes tut, etwas für sich? Aber was könnte das sein? Mittags ist Frank den Antworten kein Stück näher gekommen. Missmutig verzieht er das Gesicht, atmet tief ein und ballt eine Faust. In hektischen Zügen schiebt er den Staubsauger durch die Wohnung, dann springt er ins Auto und braust los. An der Paketstation muss er warten. Beim Bäcker kauft ihm jemand das letzte Stück Kuchen vor der Nase weg. Im Blumenladen agiert die junge Aushilfe im Tempo einer Schildkröte. Auf dem Rückweg findet der Fahrer vor ihm das Gaspedal nicht. Zu guter Letzt watschelt auch noch eine Ente auf seiner Fahrspur herum. Das Vieh geht und geht nicht zur Seite! Endlich wieder zu Hause, wirft er sich mit rasendem Puls und finsterer Miene aufs Sofa, um sich dort nun ausgiebig zu....was? Entspannen? Hat er nicht eben eine Ente angebrüllt? Eine Ente! Er sieht ein: Die Beziehungskrise verschwindet nicht mit Juliane, die übers Wochenende ihre Affäre besucht. Und Timos Depressionen bekümmern seinen Vater auch, wenn der Drittklässler den Nachmittag bei einer Schulfreundin verbringt. Dieses mürrische Spiegelbild! Er wollte sich doch...jaja, entspannen, haha, ein guter Witz, über den er aber nicht lachen kann. Nicht in dieser Stimmung. Er denkt an die Ente und wie er sie angebrüllt hat, und dabei beobachtet er, wie seine Mundwinkel sich ein Stück heben und seine Lippen sich seltsam in Falten legen. Zumindest sieht das schon halbwegs neutral aus, und dann bekommt es den angestrengten Ausdruck von jemandem, der mühsam ein Grinsen unterdrückt, bis er sich schließlich schmerzhaft auf die Lippen beißt, um nicht unkontrolliert loszuprusten, was er schließlich doch nicht verhindern... - ist da nicht eben die Wohnungstür zugeschlagen? Frank vergisst völlig, sich zu wundern, warum Timo jetzt schon zurückkommt. Er dreht sich um und erklärt seinem Sohn: "Ich übe, neutral zu gucken. Also nicht mürrisch zu gucken wie eben noch, aber auch nicht gleich loszulachen, weil es ja gar nichts zu lachen gibt, sondern einfach normal. Neutral eben." "Papa, ich muss dir was sagen", schluchzt Timo. Er sagt: "Papa, ich möchte ein Mädchen sein. Halt, falsch: Ich bin ein Mädchen." Es ist einer jener Momente, auf die einen nichts - keine Erziehung, keine Bildung, keine Lebenserfahrung - angemessen vorbereitet; ein Moment, in dem man nicht wagt, nach unten zu gucken aus der Befürchtung heraus, es könne dort wirklich kein Boden mehr unten den Füßen sein. Ein Moment wie im Kino, nur dass man sich nun selbst auf die Leinwand projiziert sieht. Aber auch ein Moment, in dem Verstand und Gefühl eisern zusammenhalten. Frank antwortet: "Okay. Gib mir eine Minute Zeit, in der ich die Augen schließe und mir das vorstelle." Er atmet mit geschlossenen Augen eine Minute lang tief und regelmäßig. Währenddessen versucht er Timo, wie er vor ihm steht, in das Bild eines Mädchens mit seinem Gesicht zu morphen. Ergebnis: Der Boden unter den Füßen hält zuverlässig. Es war auf Anhieb vielleicht ein bisschen schwer zu glauben, aber es stimmt. Es passt. Timo kann mühelos wie ein Mädchen aussehen, wie ein ausgesprochen hübsches Mädchen, und was er so macht, was er mag, was ihn interessiert - das entsprach fraglos dem üblichen Bild eines neunjährigen Mädchens. Und nun macht sein Kummer, seine Verzweiflung, seine Ratlosigkeit einen vollkommen plausiblen Sinn. Frank öffnet die Augen und lächelt. Bevor sie von Google das Wort transgender lernen, sagt er: "Ein Mädchen kann nicht Timo heißen. Wie willst du heißen?" * Lilly die Retterin ist stundenlang durch die Stadt geskatet. Keine Not-, Un- oder Überfälle, die ihren Einsatz erforderten - wieder einmal eine enttäuschende Mission. Kurz vor Zuhause, schon in ihrer kleinen Sackgasse, erregen immerhin ein Mann und ein Mädchen ihre Aufmerksamkeit. Gehören die zu den Hippies? "Ich will da nicht hin", hört Lilly das Mädchen jammern, "ich zieh sowieso nicht bei denen ein, also was soll ich da?" "Ich weiß, ich weiß - aber wir müssen uns das doch wenigstens mal angucken. Ihnen eine Chance geben. Mama zu Liebe." "Pff. Mama liebt mich ja gar nicht mehr." "Das stimmt nicht, und das weißt du." "Jaja, es ist ja alles so schwer für Mama undsoweiter. Warum kann sie nicht einfach bei uns wohnen bleiben?" "Das geht nicht, und das weißt du. Juliane und ich streiten uns doch nur noch, das kann doch so nicht weitergehen." "Dann hört halt auf damit, euch zu streiten." "Und sie will eben unbedingt mit vielen Menschen zusammenwohnen und nicht nur mit uns. Deshalb ist sie so unzufrieden." "Und von jedem von denen Kinder kriegen." "Das eine kriegt sie jedenfalls. Und wenn es dann da ist, möchte es ja bestimmt auch bei seinem Papa sein und bei seiner Mama. Wir haben das doch besprochen: Wir gehen da jetzt rein, hören uns an, was die zu erzählen haben, und wenn es uns nicht gefällt, gehen wir wieder nach Hause." Juliane hat nach ihrem Wochenende nur eines im Sinn gehabt: Frank und Timo zu berichten, dass sie schwanger ist von Klaus. Dass sie mit ihm in diese Kommune ziehen will - mit ihm und am liebsten auch mit Frank und Timo. Leben in Gemeinschaft - davon träumt sie seit Langem. Doch was sie vorfand, war ein Kind mit Zöpfen im kurzen Sommerkleid. "Du hast mir meinen Sohn weggenommen", brüllte sie, nahm ihre Sachen und verschwand. Tabea hat die Fröhlichkeit und den Lebensmut zurückgewonnen, die Timo so lange gefehlt haben. Doch der Weg vom Jungen zum Mädchen ist lang und beschwerlich. Sie hat Ärzte und Psychologen und Sachbearbeiter kennengelernt. Sich erklären müssen vor Lehrern, Mitschülern, Nachbarn und entsetzten Großeltern. Sie sehnt sich nach einer intakten Familie. Und nach Leuten, die sie einfach so akzeptieren, wie sie ist. Frank zwängt sich mit gemischten Gefühlen durch das quietschende Gartentörchen. Juliane hat die Kommune als Hort der Vielfalt, des Miteinanders und der Toleranz gepriesen - genau, was Tabea braucht. Er befürchtet, es werde der Kleinen so gut gefallen, dass sie gar nicht wieder gehen will. Und das würde ihn vor eine unmögliche Entscheidung stellen. Die beiden verschwinden im Hippie-Haus. Lilly hockt sich auf ihr Board. Nachdenklich knüpft sie ein Freundschaftsbändchen fertig. Wenn es da nun ein Mädchen gibt, werden sie dann womöglich beste Freundinnen? Knüpfend träumt sie sich zurecht, wie sie zusammen spielen und Menschen retten. Kann sie überhaupt skaten? Wenn nicht, wird sie es ihr beibringen. Und Erste Hilfe muss sie sicher auch erst lernen. Lilly als Lehrerin - das wird fein! Doch ach! Mama und Papa werden nicht begeistert sein. Sie halten wenig von den Leuten, die sie Hippies nennen. Ein Auto biegt in die Straße. Gegenüber geht die Tür auf, das Mädchen rennt durch den Vorgarten. Ein Aufprall, das Mädchen wirbelt über die Kühlerhaube. In Lillys Kopf leuchtet ein rotes Lämpchen, die innere Stimme ruft: "Einsatz!" Sie sprintet los. Das Mädchen liegt auf der Straße und regt sich nicht. Der rechte Oberschenkel macht eine verräterische Kurve. Der Fahrer steht betroffen neben seinem Wagen. Lillys Stimme ist laut und klar und energisch: "Nehmen Sie ihr Handy, Notruf 112. Und haben sie eine Decke im Wagen? Die brauchen wir hier." Sie kniet sich lächelnd neben das Mädchen. "Hallo! Ich bin Lilly, deine Ersthelferin", sagt sie leise, "Was tut dir weh?" Sie fühlt den Puls. Sie hat tausendmal geübt, den Puls zu fühlen, aber immer nur bei ihrem gesunden, topfitten Papa. Der Unterschied ist massiv. "Alles", jammert die Patientin mit schwacher Stimme. "Wie heißt du denn?", fragt Lilly. "Timo", flüstert die Patientin. Kalter Schweiß auf ihrer Stirn. "Ach Quatsch, ich heiß ja Tabea." Lilly rauft sich die Haare. "Äh - was für ein Tag ist heute?", vergewissert sie sich. Tabea zuckt die Schultern und verzieht das Gesicht. Der Fahrer räuspert sich und sagt: "Ist die Verunglückte ansprechbar und bei Bewusstsein? Die wollen das wissen." Lilly schnappt sich sein Mobiltelefon. "Hallo? Ich bin die Ersthilferin", spricht sie hinein, "die Patientin ist weiblich, cirka neun oder zehn Jahre alt. Ansprechbar, aber desorientiert. Femurfraktur, Puls schwach und rasend schnell. Wir brauchen hier bitte sofort und dringend einen Notarzt." Tabeas Gesicht wird blasser. Der Mann tapert unbeholfen mit einer Wolldecke um sie herum. "Einen Nooooootarzt", wiederholt Lilly. Wenn bloß Papa schon angeflogen käme! Sie zieht das Freundschaftsbändchen aus der Hosentasche und bindet es Tabea ums Handgelenk. "Es gibt dir Kraft", verspricht sie, "du musst nämlich jetzt stark sein. Und tapfer. Eine Kämpferin! Bist du eine Kämpferin?" Sie legt die Decke über sie. "Weiß nich...", murmelt Tabea und schließt die Augen. Lilly schnipst ihr an die Wange. "Nee, nich einschlafen jetzt, lass uns ein bisschen plaudern." Tabea guckt sie aus den Tiefen ihrer Verletzungen an. Der Fahrer steht daneben, hilflos und ein bisschen beeindruckt. Lilly registriert es mit einem gewissen Stolz, aber sie muss ihre Mission nun auch zu einem erfolgreichen Ende führen. "Ich hab in zwei Wochen Geburtstag. Du bist eingeladen. Versprich mir, dass du kommst." Tabea murmelt ihr Versprechen beinahe mit letzter Kraft. Ihr Puls hüpft kräftig und unregelmäßig zwischen Lillys Fingern hindurch. Ihr Bauch schwillt an. Erleichtert hört Lilly das Martinshorn. Kein Hubschrauber diesmal. Sekunden später stehen Papa und ein Sanitäter neben ihr. Stetoskop und geübte Hände bestätigten, was Töchterchen bereits diagnostiziert hatte. Der Notarzt legt Tabea einen Zugang. Flößt ihr Medikamente ein, die ihren Kreislauf stabilisieren. Als sie in den Rettungwagen geschoben wird, ruft Lilly ihr nach: "Sei stark, kleine Kämpferin." Tabea zeigt den Daumen nach oben. Dann schläft sie ein. Die Polizei trifft ein. Lilly geht zu Frank, der nun seine Tochter vergeblich sucht, und sagt: "Wenn sie überlebt, hab ich sie gerettet." Sofort bereut sie diesen Satz, aber zu spät, der Mann taumelt bereits zurück ins Haus. * Ausreichend Besucherparkplätze, Wegweiser von vorbildlicher Übersichtlichkeit. Die Tür des Fahrstuhls schließt exakt und lautlos, ohne Verzug setzt sich der Mechanismus in Bewegung. Hinter einer doppelflügeligen Milchglastür - "Intensivstation" steht darauf in schnörkellosen weißen Lettern - ein langer, makellos getünchter Korridor. Helles Neonlicht, intensiver Geruch von antiseptischer Seife, leises Piepen und Summen elektronischer Geräte, Türen wechseln ab mit Bilderrahmen, sie enthalten Drucke von Kandinsky und illustrierte Bibelverse. Robert findet nichts auszusetzen an der Gestaltung. Ganz am Ende des Korridors eine Bank. Darauf sitzt Juliane. Neben der Bank ein Fenster, dahinter ein Raum: Apparate blinken, flackern, piepen. Menschen in grünen Kitteln gruppieren sich um den OP-Tisch. Das blutige Etwas darauf, das muss Tabea sein. Juliane schluchzt. Zwischen ihnen wabert die Schuldfrage, unausgesprochene Vorwürfe hüllen sie ein wie eine Wolke. Wie ruhig Frank das alles betrachtet! Beinahe gelassen. Scheinbar emotionslos. Selbstgerecht wie immer. Zum Kotzen! Der Chefarzt, eine imposante Erscheinung: Gesunde Bräune, überzeugender Blick, rigoroser Händedruck - Kompetenz und Sachlichkeit von Kopf bis Fuß. Er spricht von Beinbruch, Schädel-Hirn-Trauma, innerer Blutung im Bauchbereich, Koma. Juliane möchte nun doch nicht streiten. Sie hat genug damit angerichtet. Als die Anderen damit anfingen, wie toll es für das Projekt sei, ein Transgenderkind dabeizuhaben, als Tabea aufsprang und weinte und schrie, "lasst mich doch einfach in Ruhe", und dann zur Tür rannte und Frank hinterher wollte - da hätte sie ihn laufen lassen sollen, anstatt ihm vorzuwerfen, er habe das Kind beeinflusst und manipuliert und gegen sie aufgehetzt. Der Arzt erklärt: "Die gute Nachricht: Leber, Milz und andere Organe sind nicht betroffen. Wir beobachten die Blutung, gegebenenfalls müssen wir operieren. Dann der Kopf - ein Hirnödem, also eine Schwellung, kann von selbst wieder verschwinden. Das warten wir ab. Morgen wissen wir mehr. Ich würde sagen: Die gute Ersthilfe und die schnelle Versorgung haben ihre Tochter gerettet." Frank weint. Juliane holt aus der Cafeteria grausamen Automatenkaffee, überreicht ihm den bitteren Kelch und ist gar nicht mehr wütend. Sie lieben sich nicht mehr, aber sie haben eine gemeinsame Mission: Fasziniert die Tapferkeit ihrer als Sohn geborenen Tochter zu beobachten, die jenseits der Plexiglasscheibe um ihr Leben kämpft. "Tabea ist kein Entenküken, das immer seiner Mama hinterherschwimmt", stellt Juliane fest. Auch wenn es diesmal besser gewesen wäre - eigentlich möchte sie lieber einen Dickkopf als ein braves Küken. "Wie kommst du jetzt auf Enten?", murmelt Frank. Gegen Morgen, nach dem Schichtwechsel, sieht eine andere Schwester nach Tabea. "Sind Sie die Eltern?" fragt sie. "Die ist zäh, die ist tapfer. Eine Kämpferin." Frank und Juliane sehen sich müde an. Sie gehen nach Hause. * Tabea geht es viel besser. Sie dreht das Freundschaftsbändchen um ihr Handgelenk. "Wir müssen uns bei dem Mädchen bedanken", sagt Frank. "Ja! Sie ist meine Freundin. Du musst sie unbedingt finden", schärft Tabea ihm ein. Der Arzt kommt zur Visite. "Sie haben den doofen Penis nicht weggemacht", schimpft die kleine Patientin. "Tut mir leid", schmunzelt der Doktor, "das haben wir in der Aufregung wohl vergessen." Die Tür geht auf, ein Bett wird hereingeschoben. "Hallo! Besuch ist da", ruft eine Mädchenstimme. "Da ist sie ja", jubelt Tabea. Lillys Skateboard lehnt an ihrem Gipsbein. "Eigentlich wollte ich ja skaten statt im Krankenwagen fahren", sagt sie mit breitem Grinsen, "aber da war diese Ente im Weg." |
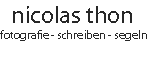 |
|||||
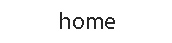 |
 |
 |
 |
 |

|
Die Ente