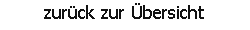| Dorfleben Es ist nichts Autobiographisches an dieser Geschichte! Auch Sie wären verstört, wenn Sie so etwas während des Nachmittagsschlafs träumten. Über Feedback freut sich: Nicolas Thon Vollständiger Text: Robert legte die Heckenschere beiseite, wischte sich den Schweiß von der Stirn und nahm einen großen Schluck Limonade. Unterdessen betrachtete er sein Werk und befand es für gelungen. Ein überkritischer Nachbar mochte hier oder da eine kleine Delle erkennen, doch im Großen und Ganzen sah die Hecke gerade und ordentlich aus. Darauf kam es an. In einem Dorf wie diesem beurteilte man den Wert eines kürzlich Zugezogenen zuerst nach dem Zustand seines Vorgartens, und Robert plante, hierbei keinen Kredit zu verspielen. Ein Haus mit Garten fernab der Großstadt: Für manche mochte dies das Paradies sein, das ersehnte Ziel, ein Traum; für andere allein die Vorstellung die Hölle bedeuten: Der Garten eine Bürde, die Nachbarn eine Qual, die Ruhe bloße Eintönigkeit. Roberts Fall lag anders. Er hatte es schlicht in der Stadt nicht mehr ausgehalten - all der Lärm, die unablässige Hektik - und dies war die einzige Alternative, die ihm in den Sinn kam. Er fegte die abgeschnittenen Zweiglein zu einem Haufen zusammen. Dann begab er sich zu einem Gang durch die Gemeinde. Das Dorf zählte kaum drei Dutzend Häuser und lag idyllisch in einer kleinen Senke. Robert wohnte am Anfang einer von ordentlichst getrimmten Hecken gesäumten Sackgasse mit beinahe identischen Häuschen. Einzig das Letzte in der Reihe unterschied sich von denen der Nachbarn. Es war niedriger und verwinkelter, an der Garage vorbei gelangte man durch einen Torbogen zur Haustür. Jenseits des Grundstücks verlief ein kleiner Bach, von dessen anderem Ufer eine Wiese recht steil anstieg bis zur Landstraße, die oberhalb des Dorfes entlang führte. Es sah nach Umzug aus: Im Garten stand kreuz und quer eine Ansammlung von Kartons. Eine geheimnisvolle Aura umgab die alleinstehende Frau, deren Hab und Gut sich in diesen Kisten befinden musste. Ihr wirres, weißes, stets ungebürstetes Haar und ihre unmodische, gräulich-verwaschene und nach Mottenpulver riechende Kleidung trug sicher dazu bei. Zwar zeigte niemand mit dem Finger auf sie und nannte sie eine Hexe, aber es war doch auffällig, dass im Gegenteil niemand über sie sprach und auch niemand mit ihr. Nicht einmal Otto, der doch ansonsten stets zu einem ausgelassenen Klönschnack aufgelegt war, wobei er nicht davor zurückschreckte, seine Nachbarn gehörig durch den Kakao zu ziehen. Dabei passte Otto der Erscheinung nach gut zu dieser Frau: Auch er war alleinstehend, kleidete sich recht schlampig und besaß struppiges graues Haar, einen noch struppigeren Bart und eine farblich angepasste, verbrauchte Gesichtshaut. Seine einzige Beschäftigung schien darin zu bestehen, auf seinen Streifzügen durch die Gemeinde nach Mitmenschen Ausschau zu halten, die ihn für ein paar Minuten eines nichtssagenden Gespräches aus seiner Isolation zu holen bereit waren. Als Robert gerade eingezogen war, hatte Otto ihn zu einem Bier in die einzige Kneipe im Ort eingeladen und ihn dabei auch mit weiteren traurigen Gestalten bekannt gemacht. Er fand, diesen ernüchternden Abend bravourös durchgestanden zu haben, doch danach betrachtete Otto ihn unverkennbar als seinen Freund, rückte ihm auf die Pelle bis auf eine Distanz, die ihm seinen traurigen Blick über Gebühr nahebrachte. Es folgten Einladungen zum Essen und große Pläne, wie sie gemeinsam das verschlafene Nest mit unerwartetem Leben füllen würden. Robert erfand allerlei Ausreden, um das ersehnte Alleinsein zurückzugewinnen, dessen wegen er hier her gekommen war. Die Frau verfolgte offenbar den Plan, ihre Sachen über den Fluss hinweg auf die Wiese zu verfrachten und dort in ihren Wagen zu laden. Zumindest kurvte sie damit am Fuß der Böschung herum. Der Vorteil dieser Maßnahme erschloss sich Robert keineswegs, vielmehr stellte es sich jetzt als Fehler heraus, denn die Reifen gruben sich tief in den vom letzten Regen noch aufgeweichten Grund, bis der Wagen hilflos im Schlamm feststeckte. Jemand würde der rätselhaften Dame helfen müssen, doch Robert war nicht sicher, ob sich dazu jemand bereitfände. Ihm selbst war dies allemal nicht geheuer, und so kehrte er um und ging die Gasse zurück zur Kreuzung, um in die bergauf verlaufende Dorfstraße einzubiegen. Er begegnete niemandem. Die Tür der Kneipe stand offen, doch es waren um diese Uhrzeit noch keine Gäste da. Schaumflocken auf dem Fußboden verrieten, dass gerade saubergemacht wurde. Ein unangenehmer Geruch abgestandenen Bieres und kalten Rauchs waberte aus dem Dunkel des Inneren. Robert ging weiter. Von der Landstraße aus hatte man einen schönen Blick über den ganzen Ort. Nur wenige Häuser standen direkt an der Straße, eines davon in der Kurve oberhalb der Wiese. Dort manövrierte ein Auto ungelenk auf dem Seitenstreifen hin und her, geriet schließlich mit den Hinterrädern über den Rand der Böschung und begann damit, langsam den Hang hinab zu rutschen, um zu guter Letzt neben dem Wagen der alten Dame am Flussufer zum Stehen zu kommen. Robert konnte von Weitem keine Details erkennen, aber es war ihm intuitiv klar, dass die Alte ein zweites Fahrzeug aufgetrieben hatte, um das erste freizuschleppen, doch dieses Unterfangen hatte nun als gescheitert zu gelten. In der anderen Richtung befand sich ein paar Meter weiter die Bushaltestelle. Hier stand eine wartende junge Frau. Ihr sauber geflochtener, strenger Zopf war Robert ein vertrauter Anblick: eine frühere Nachbarin aus der Großstadt. Nun hätte er sich wundern müssen, ihr hier zu begegnen, doch ihre Kleidung sagte alles: Sie trug Reithosen und Reitstiefel, und im nächsten Ort befand sich ein großer Ponyhof. Robert und Tabea hatte keine intensive Freundschaft verbunden, aber doch immerhin eine gute Bekanntschaft, wie sie in der Anonymität der Großstadt selten war. Wann immer sie sich zufällig auf der Straße begegnet waren, hatten sie füreinander zumindest ein Lächeln übrig gehabt, und sich oft genug auch Zeit genommen für ein kurzes Gespräch. Jetzt schoss dem zwei Jahrzehnte Älteren durch den Kopf, wie wenig er über Tabea wusste. Und dennoch schien es nach einer überaus herzlichen Begrüßung nur natürlich, dass sie ihn, ihren Reitplänen zum Trotz, beim Rest seines Spazierganges begleitete. Sie näherten sich der Kurve, wo eben der Wagen der Frau ins Rutschen gekommen war. Mit hoher Geschwindigkeit brauste ein Fahrzeug heran, man hörte es lange, bevor es in Sicht kam. Wieder saß die gleiche Frau am Steuer, doch dieses Mal kam sie in voller Fahrt und zweifellos in purer Absicht von der Fahrbahn ab. Auf dem unkontrollierten Weg hangabwärts hüpfte und sprang der PKW jämmerlich, drohte mehrmals, sich zu überschlagen, drehte sich um die eigene Achse und krachte zu guter Letzt in einen der beiden bereits auf der Wiese befindlichen Wagen. Robert und Tabea rannten entsetzt hinterher, auf das Haus zu, das auf halber Höhe des Hanges stand und dessen Bewohner im Garten ein Kaffeekränzchen abhielten. „Wir brauchen einen Krankenwagen“, keuchte Robert, und Tabea wollte bereits weiter rennen, um nach der Fahrerin zu sehen. Der Hausherr schüttelte den Kopf. „Geht da lieber nicht hin, Kinder“, sagte er. „Mausetot“, ergänzte seine Frau und deutete auf einen Findling, der gleich neben der Kaffeetafel aus der Wiese ragte. Er trug deutliche Spuren eines harten Aufpralls: Kratzer, Lacksplitter, Blut. Notarzt und Polizei wurden gleichwohl verständigt. Sie trafen ein, als die beiden Spaziergänger sich längst wieder über die Landstraße zurück zum Ort begaben. Dem Impuls folgend, einmal im Haus der Frau nach dem Rechten zu sehen, gingen sie zum Ende der Sackgasse. Dort trafen sie Otto. Heute war er gewiss zu keinem Klönschnack zu haben. Er ging schnellen Schrittes geradewegs in das Durcheinander im Inneren, dessen Verursacherin sich soeben keine fünfzig Meter entfernt zu Tode gefahren hatte. Robert und Tabea folgten ihm in den halbdunklen Vorraum. Der Hausbesitzer - eben noch wäre Robert das undenkbar erschienen, jetzt wirkte es aus unerfindlichen Gründen absolut plausibel - bahnte sich laut schimpfend einen Weg durch ein Durcheinander, wie es jedem noch so toleranten Vermieter missfallen musste. In seiner Aufregung übersah er die Landstreicherin, die zwischen Marmeladengläsern, Farbeimern und allerhand rostigem Krimskrams auf dem großen Tisch des Vorraums aus ihrem Schlummer erwachte. Fahrig erhob sie sich aus ihrer liegenden Position und rieb sich die Augen. Robert kannte sie bereits, auch wenn er nicht sagen konnte, bei welcher Gelegenheit er ihre Bekanntschaft gemacht hatte. Gleichwohl war er überrascht, sie noch immer - oder schon wieder - hier im Ort anzutreffen. Die Landstreicherin war in etwa in Tabeas Alter und ebenso schlank, wenngleich sie mit ihren Dreadlocks und schludrigen Klamotten gänzlich anders wirkte als das aus behütetem Hause stammende Pferdemädchen. In ihrer Ruhe gestört, nahm sie das Bündel ihrer Habseligkeiten, das ihr als Kopfkissen gedient hatte, und verließ gemeinsam mit Robert und Tabea das Haus der Toten. Vor Roberts Heim fanden sie seinen eigenen Vermieter, der sich durch jedes einzelne Fenster ebenfalls einen Eindruck dessen zu verschaffen suchte, was im Inneren seines Eigentums für eine Wirtschaft betrieben wurde. Robert glaubte nicht, dass es an seiner Haushaltsführung etwas auszusetzen gäbe. Freundlich grüßte er den kräftigen Hünen, der jeden im Dorf wenigstens um einen halben Kopf überragte. Immer, und auch jetzt wieder, hatte er ein von guter Laune zeugendes Augenzwinkern für Robert übrig. Sein Gesicht wirkte jedoch gequält und schmerzverzerrt, und das Zwinkern kam aus einem üblen Veilchen. Die drei Freunde bogen wieder in die Dorfstraße ein. Unterwegs begegneten sie zwei weiteren, Robert bisher fremden, Männern ähnlicher Statur, die ebenfalls kürzlich ein blaues Auge davongetragen hatten. Etwas daran hätte Robert zutiefst verwunderlich vorkommen können, womöglich sogar ein wenig beunruhigend. Doch die jungen Frauen verhielten sich völlig normal, und dann blieb ihrem älteren Begleiter auch gar keine Zeit mehr, sich zu verwundern, denn sie gelangten zur Kneipe, die sich inzwischen gefüllt hatte. Man erkannte dicht gedrängte Leiber im Schummerlicht, und den herausdringenden Gesprächsfetzen ließ sich entnehmen, dass wenigstens das halbe Dorf zugegen war und erregt die Ereignisse der letzten halben Stunden diskutierte. Tabea und die Landstreicherin warfen einen Blick hinein, kehrten jedoch alsbald zurück und berichteten, dass man da drin das eigene Wort nicht verstehe und kaum Luft zum Atmen sei. Der Rettungswagen stand immer noch mit blitzendem Blaulicht in der Kurve oberhalb der Unfallstelle. Ein Abschleppdienst gesellte sich hinzu. Der Bus kam angetuckert - nicht der, der Tabea zum Ponyhof bringen würde, sondern derjenige in Gegenrichtung zurück in die Stadt. Das Mädchen verabschiedete sich eilig und stieg ein. Die Landstreicherin zögerte einen Moment, betrachtete den Bus und blickte in beiden Richtungen die Landstraße entlang. Schließlich fasste sie ihren Entschluss. Die gelben Türen schlossen sich, das behäbige Fahrzeug setzte sich schwerfällig in Bewegung und wirbelte Staub in Roberts Augen. Er bekam eine Umarmung und ein Küsschen, dann setzte die junge Frau über den Straßengraben auf die dortige Wiese und strebte auf den Waldrand zu. Robert sah ihr noch eine Weile nach, dann wandte er sich kopfschüttelnd zum Gehen. Es zog ihn nach Hause. Doch als hätte ein plötzlich aufgekommener Nebel das Tal mit seiner milchigen Trübnis gefüllt, war von diesem Zuhause nichts zu erkennen. Robert verharrte an der einsamen Haltestelle an der Landstraße. Heute würde wohl kein Bus mehr kommen. |
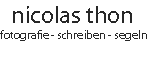 |
|||||
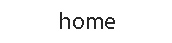 |
 |
 |
 |
 |

|
Dorfleben