| Paulas Törnberichte | 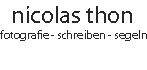 |
|||||
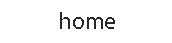 |
 |
 |
 |
 |

|
|
|
|
||||||

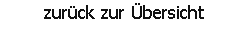
Flottillentörn Westschweden 2.-29. Juli
2016 - Die Relativität der Zeit
Beim Segeln, jedenfalls auf einer Reise wie dieser, geht
das gewohnte Zeitgefühl sofort den Bach runter. Zeit wird
gleichzeitig unendlich gedehnt und maximal komprimiert. Am ersten Abend
schon schleicht sich das Gefühl ein, bereits seit einer
Ewigkeit
gemeinsam unterwegs zu sein. Und dabei war jeder Tag so kurzweilig,
dass er auch für drei Tage genügend Erlebnisse
bereithielt. So viele lehrreiche Erfahrungen, so viele sinnliche
Eindrücke, so viel Neues und so viel Miteinander -
vorläufig fehlte
die Zeit, dies alles angemessen zu verarbeiten, doch es stellte sich
auch eine Sucht danach ein, so dass wir jeden Tag mehr davon wollten.
Juli 2016
 Es war als besondere Reise
angekündigt, als unvergessliches Abenteuer, das „der
Urlaub Eures Lebens“ sein könne. Hatte ich zu viel
versprochen? Rückblickend war wohl eher das Gegenteil der
Fall: Die Schwedenreise übertraf noch die hohen, wenngleich
diffusen, Erwartungen. Dazu folgte sie einem Spannungsbogen, der besser
gar nicht hätte sein können: Die navigatorischen
Aufgaben wurden von
Tag zu Tag anspruchsvoller, bis ein
Starkwindtag im engsten, verwinkeltsten, verwirrendsten Teil der
Schärenwelt, gefolgt von einer extrem kniffligen kollektiven
Anlegeprozedur den unübertrefflichen Höhepunkt
darstellte. Ich kannte das ja schon, hatte die Göteborger
Schären schon mehrfach einhand ersegelt. Doch in der Gruppe
war es dann noch einmal etwas ganz Anderes. Die eigene Begeisterung von
den Gesichtern der Anderen ablesen zu können, war nur einer
der positiven Aspekte.
Es war als besondere Reise
angekündigt, als unvergessliches Abenteuer, das „der
Urlaub Eures Lebens“ sein könne. Hatte ich zu viel
versprochen? Rückblickend war wohl eher das Gegenteil der
Fall: Die Schwedenreise übertraf noch die hohen, wenngleich
diffusen, Erwartungen. Dazu folgte sie einem Spannungsbogen, der besser
gar nicht hätte sein können: Die navigatorischen
Aufgaben wurden von
Tag zu Tag anspruchsvoller, bis ein
Starkwindtag im engsten, verwinkeltsten, verwirrendsten Teil der
Schärenwelt, gefolgt von einer extrem kniffligen kollektiven
Anlegeprozedur den unübertrefflichen Höhepunkt
darstellte. Ich kannte das ja schon, hatte die Göteborger
Schären schon mehrfach einhand ersegelt. Doch in der Gruppe
war es dann noch einmal etwas ganz Anderes. Die eigene Begeisterung von
den Gesichtern der Anderen ablesen zu können, war nur einer
der positiven Aspekte.
 Nach dem Höhepunkt ging es also bergab?
Zunächst galt es, im mondänen Marstrand den
Crewwechsel zu erledigen. Die bisherigen Gäste reisten, auf
einer Wolke der Euphorie schwebend, zurück in den Alltag. Es
kam eine neue Gruppe, ein geschlossener Freundeskreis diesmal, und mit
ihnen andere Aufgaben. Der Rückweg war kein
Selbstläufer wie der Hinweg. Der günstige Wind,
bisher ein treuer
Begleiter, ließ uns nun im Stich. Es wurde, man kann es nicht
leugnen, bisweilen zäh - mit drei Knoten und etlichen
Flautenphasen dauert ein harmloser Dreißigmeilenschlag von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dafür hatten wir zwei
Wochen lang nicht einen Tropfen Regen. Und wir schafften es
pünktlich zurück in die Schlei - eine Leistung, auf
die man durchaus stolz sein darf.
Nach dem Höhepunkt ging es also bergab?
Zunächst galt es, im mondänen Marstrand den
Crewwechsel zu erledigen. Die bisherigen Gäste reisten, auf
einer Wolke der Euphorie schwebend, zurück in den Alltag. Es
kam eine neue Gruppe, ein geschlossener Freundeskreis diesmal, und mit
ihnen andere Aufgaben. Der Rückweg war kein
Selbstläufer wie der Hinweg. Der günstige Wind,
bisher ein treuer
Begleiter, ließ uns nun im Stich. Es wurde, man kann es nicht
leugnen, bisweilen zäh - mit drei Knoten und etlichen
Flautenphasen dauert ein harmloser Dreißigmeilenschlag von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dafür hatten wir zwei
Wochen lang nicht einen Tropfen Regen. Und wir schafften es
pünktlich zurück in die Schlei - eine Leistung, auf
die man durchaus stolz sein darf.
 Das Fazit aus dem Verlauf der
Reise: Sie wird - ausreichende Nachfrage vorausgesetzt - wieder
stattfinden, aber mit Modifikationen. Der zweiwöchige
Rückweg wird nicht in Arnis enden. Statt dessen werden die
folgenden Crews Gelegenheit erhalten, ihren Törn an der
Nordseite Fünens zu beginnen und sich ein Revier zu
erschließen, dass sie in einer Woche von der Schlei aus nicht
zu sehen bekämen. Das Pflichtprogramm der
Schwedenrückkehrer wird um gut hundert Meilen
verkürzt, mit entsprechend mehr Zeit in den Schären
und der Möglichkeit, ein bisschen länger auf passigen
Wind zu warten.
Das Fazit aus dem Verlauf der
Reise: Sie wird - ausreichende Nachfrage vorausgesetzt - wieder
stattfinden, aber mit Modifikationen. Der zweiwöchige
Rückweg wird nicht in Arnis enden. Statt dessen werden die
folgenden Crews Gelegenheit erhalten, ihren Törn an der
Nordseite Fünens zu beginnen und sich ein Revier zu
erschließen, dass sie in einer Woche von der Schlei aus nicht
zu sehen bekämen. Das Pflichtprogramm der
Schwedenrückkehrer wird um gut hundert Meilen
verkürzt, mit entsprechend mehr Zeit in den Schären
und der Möglichkeit, ein bisschen länger auf passigen
Wind zu warten.

DER HINWEG
 Vermutlich wird der Sommer 2016 als kalt,
verregnet und miserabel in
die Geschichte eingehen. Im Juli lange Unterwäsche, dicke
Socken und eine Wollmütze zu tragen, ist nicht wirklich
prickelnd. Und doch hatten wir insgesamt Glück mit
günstigem Wind, Gewittern die rechtzeitig vor uns abzogen und
immer
wieder wunderbarer Sonne - es war eben wechselhaft. Es gab nur zwei
Sorten von Tagen: Hafentage und Segeltage. An den Segeltagen kamen wir
in einem Affentempo voran. Wir hätten wohl auch mal einen Tag
gemütlichen Schönwettersegelns genommen, aber was wir
bekamen und was wir damit bei wachsender Begeisterung anfingen,
ließ eher den Schluss zu: Unter fünf Beaufort laufen
wir gar nicht erst aus.
Vermutlich wird der Sommer 2016 als kalt,
verregnet und miserabel in
die Geschichte eingehen. Im Juli lange Unterwäsche, dicke
Socken und eine Wollmütze zu tragen, ist nicht wirklich
prickelnd. Und doch hatten wir insgesamt Glück mit
günstigem Wind, Gewittern die rechtzeitig vor uns abzogen und
immer
wieder wunderbarer Sonne - es war eben wechselhaft. Es gab nur zwei
Sorten von Tagen: Hafentage und Segeltage. An den Segeltagen kamen wir
in einem Affentempo voran. Wir hätten wohl auch mal einen Tag
gemütlichen Schönwettersegelns genommen, aber was wir
bekamen und was wir damit bei wachsender Begeisterung anfingen,
ließ eher den Schluss zu: Unter fünf Beaufort laufen
wir gar nicht erst aus.
Die Hafentage waren durchaus willkommene
Unterbrechungen unserer Rauschefahrt. Füßehochlegen,
Einkaufen, Sightseeing und crewübergreifende
Gespräche sollen ja nicht zu kurz kommen. Bilanz der ersten
Hälfte: Jede Einzelne der 318 Meilen durfte auf keinen Fall
versäumt werden - und das ist eine wirklich bemerkenswerte
Feststellung!

Die Gruppe
 Wir erreichen nach fünfzehn Stunden auf
offenem Wasser
Mönster, den südlichsten Felsen, an dem man ein
Schiff heil anbinden kann. Wir haben Glück: Es gibt einen Steg
mit freien Plätzen. Einen hilfsbereiten Schweden, der die
Leinen annimmt. Eine Mooringtonne, die zumindest einem Teil von uns
besseren Halt bietet als ein Heckanker. Nach und nach treffen die
"Wildgänse" ein und machen fest, bis als Letzte "Oliese" auf
uns zu tuckert. Sie soll ohne Heckanker längsseits gehen, das
ist simpel und unkompliziert, und helfende Hände stehen
bereit. Der Skipper nimmt den Gang raus. Das Boot verhungert in einer
Bö, der Bug beginnt wegzuklappen - Gang wieder rein,
gefühlvoll etwas Gas geben, schon wird die Crew uns eine
Vorleine werfen, damit wir den Rest erledigen.
Wir erreichen nach fünfzehn Stunden auf
offenem Wasser
Mönster, den südlichsten Felsen, an dem man ein
Schiff heil anbinden kann. Wir haben Glück: Es gibt einen Steg
mit freien Plätzen. Einen hilfsbereiten Schweden, der die
Leinen annimmt. Eine Mooringtonne, die zumindest einem Teil von uns
besseren Halt bietet als ein Heckanker. Nach und nach treffen die
"Wildgänse" ein und machen fest, bis als Letzte "Oliese" auf
uns zu tuckert. Sie soll ohne Heckanker längsseits gehen, das
ist simpel und unkompliziert, und helfende Hände stehen
bereit. Der Skipper nimmt den Gang raus. Das Boot verhungert in einer
Bö, der Bug beginnt wegzuklappen - Gang wieder rein,
gefühlvoll etwas Gas geben, schon wird die Crew uns eine
Vorleine werfen, damit wir den Rest erledigen.
Doch der Motor heult
unheilverkündend auf, "Oliese" nimmt mit Vollausschlag an der
Motorpinne Fahrt auf. Saust in einem Affentempo auf Steg und Schiffe
zu, dreht in einer dramatischen Kurve ab, das ausschwenkende Heck
verfehlt die Ankerlieger nur um Zentimeter. Die wilde Fahrt droht in
ein ungewisses Ende zu führen, das Wort "Haftpflichtschaden"
schießt mir durch den Kopf.
Dann ist schlagartig Ruhe im
Schiff. "Olieses" Außenborder hat eine Achterleine
aufgesammelt und geht aus, der Rumpf verfängt sich in weiteren
Leinen. Wir nehmen Festmacher entgegen, befreien "Oliese" aus ihrem
Netz, verholen sie sachte an ihren Liegeplatz. Schweigend und im
Bewusstsein: Wir haben ein Problem.
***
 Mit einer Ausnahme kannten sich die Teilnehmer
schon vom
Vorbereitungstreffen im Januar. Da waren noch unsere allseits beliebten
Schweizer dabei, die dann aufgrund eines Arbeitsunfalls ausfielen.
Ihnen sei versichert: Wir haben sie vermisst, und dennoch den
Törn auch ohne sie genossen. Als Ersatz sprang mein Freund
Björn ein, der uns eigentlich mit seinem eigenen Boot
begleiten wollte, "Jane" dann aber im Hafen
zurückließ und sich auf "Martha" einquartierte.
Seinem Freund Götz schenkte er die Reise zum Geburtstag.
"Frieda" und "Salty" waren mit segelerfahrenen, folkebooterprobten
Crews besetzt. Thomas auf der „Oliese“ kannte ich
von mehreren gemeinsamen Törns in die Dänische
Südsee. Lange Schläge, die Querung des Kattegats und
nun die Schären waren für alle Teilnehmer Neuland und
eine naheliegende Erweiterung ihres Aktionsradius. Sie stellten sich
der Herausforderung mit Begeisterung, Gelassenheit und Vertrauen in die
Gruppe und meine Törnplanung.
Mit einer Ausnahme kannten sich die Teilnehmer
schon vom
Vorbereitungstreffen im Januar. Da waren noch unsere allseits beliebten
Schweizer dabei, die dann aufgrund eines Arbeitsunfalls ausfielen.
Ihnen sei versichert: Wir haben sie vermisst, und dennoch den
Törn auch ohne sie genossen. Als Ersatz sprang mein Freund
Björn ein, der uns eigentlich mit seinem eigenen Boot
begleiten wollte, "Jane" dann aber im Hafen
zurückließ und sich auf "Martha" einquartierte.
Seinem Freund Götz schenkte er die Reise zum Geburtstag.
"Frieda" und "Salty" waren mit segelerfahrenen, folkebooterprobten
Crews besetzt. Thomas auf der „Oliese“ kannte ich
von mehreren gemeinsamen Törns in die Dänische
Südsee. Lange Schläge, die Querung des Kattegats und
nun die Schären waren für alle Teilnehmer Neuland und
eine naheliegende Erweiterung ihres Aktionsradius. Sie stellten sich
der Herausforderung mit Begeisterung, Gelassenheit und Vertrauen in die
Gruppe und meine Törnplanung.
 Thomas und der Rest
seiner Crew, Marrit und Lars, waren eher flüchtig miteinander
bekannt. Die erprobten Jollen- und Regattasegler waren
planmäßig nur in der ersten Woche dabei. Die danach
vorgesehene Mitseglerin fiel kurzfristig
aus - Götz erklärte sich bereit, die
„Oliese“-Crew dann zu komplettieren. Auch auf
„Salty“ war ein zusätzlicher Crewwechsel
eingeplant: Ernst blieb, Sabine stieg nach der Kattegatquerung ab, Sohn
Christoph bereits in Grenaa auf. Die Logistik dieses Wechsels gelang
fabelhaft und ohne, dass die Flottille in irgendeiner Form vom Kurs
abweichen musste. Von Mönster aus war lediglich ein kleiner
Abstecher ins fünf Meilen entfernte Gottskär
nötig, um die Abreisenden auf den Weg zu bringen.
Thomas und der Rest
seiner Crew, Marrit und Lars, waren eher flüchtig miteinander
bekannt. Die erprobten Jollen- und Regattasegler waren
planmäßig nur in der ersten Woche dabei. Die danach
vorgesehene Mitseglerin fiel kurzfristig
aus - Götz erklärte sich bereit, die
„Oliese“-Crew dann zu komplettieren. Auch auf
„Salty“ war ein zusätzlicher Crewwechsel
eingeplant: Ernst blieb, Sabine stieg nach der Kattegatquerung ab, Sohn
Christoph bereits in Grenaa auf. Die Logistik dieses Wechsels gelang
fabelhaft und ohne, dass die Flottille in irgendeiner Form vom Kurs
abweichen musste. Von Mönster aus war lediglich ein kleiner
Abstecher ins fünf Meilen entfernte Gottskär
nötig, um die Abreisenden auf den Weg zu bringen.
 Schon zuvor hatte aber sich angedeutet: Das war
nicht der Thomas, den ich kannte. Bei Hafenmanövern
war er
angespannt und nervös, jegliches Gefühl für
Pinne und Gasgriff fehlte. Je mehr er sich auf das besann, was er
eigentlich passabel konnte, desto unkontrollierter wurde das Ergebnis.
In besonders engen Häfen sprang ich helfend an Bord, ansonsten
war bisher alles gut gegangen. Dann geschah der katastrophale Anleger
in Mönster. Thomas wusste von uns allen am besten, dass er in
dieser Form nicht fit für die Schären war. Jemand
drücke ihm ein Bier in die Hand, ich redete motivierend auf
ihn ein, ohne wirklich Rat zu wissen. Lag es an der ungewohnten
Crewkonstellation? Hatte sich Thomas in der Absicht
bestmöglicher Törnvorbereitung in jede Menge
„Was ist, wenn...?“-Szenarien hineingesteigert, die
er nun nicht mehr aus dem Kopf bekam? Hätten wir
früher eine andere Rollenverteilung versuchen sollen, bei der
nicht zwangsweise Thomas die Anleger fuhr und die anderen beiden
segelten? Dafür war es nun zu spät, aber wie sollte
es weitergehen? Würden Thomas und Götz als Team
funktionieren? Morgens zuvor in Grenaa warben auch Götz und
Björn auf der „Martha“ nicht gerade um
Vertrauen, als ich früh um vier lauthals durch den Hafen
grölen musste: „Guckt mal, wo ihr
hinfaaaaahrt!!!!“
Schon zuvor hatte aber sich angedeutet: Das war
nicht der Thomas, den ich kannte. Bei Hafenmanövern
war er
angespannt und nervös, jegliches Gefühl für
Pinne und Gasgriff fehlte. Je mehr er sich auf das besann, was er
eigentlich passabel konnte, desto unkontrollierter wurde das Ergebnis.
In besonders engen Häfen sprang ich helfend an Bord, ansonsten
war bisher alles gut gegangen. Dann geschah der katastrophale Anleger
in Mönster. Thomas wusste von uns allen am besten, dass er in
dieser Form nicht fit für die Schären war. Jemand
drücke ihm ein Bier in die Hand, ich redete motivierend auf
ihn ein, ohne wirklich Rat zu wissen. Lag es an der ungewohnten
Crewkonstellation? Hatte sich Thomas in der Absicht
bestmöglicher Törnvorbereitung in jede Menge
„Was ist, wenn...?“-Szenarien hineingesteigert, die
er nun nicht mehr aus dem Kopf bekam? Hätten wir
früher eine andere Rollenverteilung versuchen sollen, bei der
nicht zwangsweise Thomas die Anleger fuhr und die anderen beiden
segelten? Dafür war es nun zu spät, aber wie sollte
es weitergehen? Würden Thomas und Götz als Team
funktionieren? Morgens zuvor in Grenaa warben auch Götz und
Björn auf der „Martha“ nicht gerade um
Vertrauen, als ich früh um vier lauthals durch den Hafen
grölen musste: „Guckt mal, wo ihr
hinfaaaaahrt!!!!“
Es gelang uns schließlich doch, das Drama beiseite zu
schieben, den grandiosen Tag angemessen Revue passieren zu
lassen und die
Ankunft im Seglerparadies zu feiern. Und dann geschah ein kleines
Wunder.
 Den Ausflug nach Gottskär nutzte ich
für ein Skippertraining mit der neuen
„Oliese“-Crew. Thomas, Götz und ich legten
unsere Rettungswesten an. Verbannten die Passagiere unter Deck. Legten
ab, setzten Segel. Dann mussten wir uns aus der Bucht ins betonnte
Fahrwasser einfädeln. Die erste Lektion bestand darin,
ständig Seekarte und Realität in Einklang zu bringen.
Symbole aus der Karte in der felsigen Umgebung wiederzufinden.
Beobachtetem einen Karteneintrag zuzuweisen. Jederzeit zu wissen, wo
wir sind, und wie es weitergeht, und vor allem: wo es flach und
gefährlich wird. Zehn Minuten lang rauften sich Götz
und Thomas die Haare.
Den Ausflug nach Gottskär nutzte ich
für ein Skippertraining mit der neuen
„Oliese“-Crew. Thomas, Götz und ich legten
unsere Rettungswesten an. Verbannten die Passagiere unter Deck. Legten
ab, setzten Segel. Dann mussten wir uns aus der Bucht ins betonnte
Fahrwasser einfädeln. Die erste Lektion bestand darin,
ständig Seekarte und Realität in Einklang zu bringen.
Symbole aus der Karte in der felsigen Umgebung wiederzufinden.
Beobachtetem einen Karteneintrag zuzuweisen. Jederzeit zu wissen, wo
wir sind, und wie es weitergeht, und vor allem: wo es flach und
gefährlich wird. Zehn Minuten lang rauften sich Götz
und Thomas die Haare.
 Dann entwickelten sie den Blick dafür.
Für die Schären. Für die Tonnen, Baken,
Spieren, Felsen und Steine, die in den nächsten Tagen unser
täglich Brot sein würden.
„Oliese“ sauste los, ins Fahrwasser und sicher um
eine Landzunge herum, hinter der der Weg nach Gottskär lag.
Die beiden begannen sich zu verständigen: Nannten diesen
Felsen die Schildkröte und jenen den Frosch, um sie
auseinander zu halten. Und siehe da - Thomas konnte Bootfahren. Er
fasste Vertrauen zu seinem in allen Lebenssituationen stoischen
Mitsegler, und
vor allem in seine eigenen Fähigkeiten. Die nächsten
drei Anlegemanöver fuhr er gefühlvoll und
souverän.
Dann entwickelten sie den Blick dafür.
Für die Schären. Für die Tonnen, Baken,
Spieren, Felsen und Steine, die in den nächsten Tagen unser
täglich Brot sein würden.
„Oliese“ sauste los, ins Fahrwasser und sicher um
eine Landzunge herum, hinter der der Weg nach Gottskär lag.
Die beiden begannen sich zu verständigen: Nannten diesen
Felsen die Schildkröte und jenen den Frosch, um sie
auseinander zu halten. Und siehe da - Thomas konnte Bootfahren. Er
fasste Vertrauen zu seinem in allen Lebenssituationen stoischen
Mitsegler, und
vor allem in seine eigenen Fähigkeiten. Die nächsten
drei Anlegemanöver fuhr er gefühlvoll und
souverän.
 Es bestand kein Zweifel, dass die beiden den
Rest der Reise ohne
Weiteres bewältigen und genießen konnten. Und so kam
es dann auch. Für mich gehört es zu den
schönsten Erlebnissen der gesamten Veranstaltung, dass jemand,
dessen Selbstbewusstsein dermaßen im Keller war, so
über sich hinaus wachsen konnte. Das durfte Thomas dann noch
auf ganz andere Weise: Am
nördlichsten Punkt unseres Törns, in Vasholmarna,
slippte zunächst „Olieses“ Heckanker,
bevor er sich doch noch sicher und solide verfing. Allerdings in
„Marthas“ Heckanker. Beim Ablegen musste Thomas
beide Anker aufholen - schweißübertrömt
zwanzig Kilo Eisen aus dem Wasser zerren.
Götz stand staunend am Ruder, der Rest der Gruppe an Bord oder
auf dem Felsen, und beobachtete das Schauspiel. Thomas
nahm auch diese Hürde.
Es bestand kein Zweifel, dass die beiden den
Rest der Reise ohne
Weiteres bewältigen und genießen konnten. Und so kam
es dann auch. Für mich gehört es zu den
schönsten Erlebnissen der gesamten Veranstaltung, dass jemand,
dessen Selbstbewusstsein dermaßen im Keller war, so
über sich hinaus wachsen konnte. Das durfte Thomas dann noch
auf ganz andere Weise: Am
nördlichsten Punkt unseres Törns, in Vasholmarna,
slippte zunächst „Olieses“ Heckanker,
bevor er sich doch noch sicher und solide verfing. Allerdings in
„Marthas“ Heckanker. Beim Ablegen musste Thomas
beide Anker aufholen - schweißübertrömt
zwanzig Kilo Eisen aus dem Wasser zerren.
Götz stand staunend am Ruder, der Rest der Gruppe an Bord oder
auf dem Felsen, und beobachtete das Schauspiel. Thomas
nahm auch diese Hürde.
Diese Schilderung hätte ich auch weglassen können.
Sie scheint mir jedoch angebracht, damit deutlich wird, welche
Höhen und Tiefen, welche persönlichen Krisen bei
einer solchen Reise auftreten können - in der einen oder
anderen Form hatte sie jeder von uns. Und damit ebenfalls deutlich
wird, dass die Gruppe Vieles auffangen kann, was auf sich allein
gestellt ein unmögliches Unterfangen wäre.

Erste Etappe:
Arnis-Grenaa, 150 Meilen in vier Tagen
Dankenswerterweise waren alle Teilnehmer schon am Freitag angereist.
Das gemeinsame Abendessen bei „Godewind“ erwies
sich als gute Idee. Gesprächsthema Nummer: die Vollsperrung
der A7, der daraus resultierende Stau und ähnliche
Beschwerlichkeiten.
 Nachdem die Einweisungen abgeschlossen und alle
Boote seeklar waren, wurde es auch höchste Zeit zum Ablegen,
um die angepeilte Ein-Uhr-Brücke (spät genug
für einen Dreißigmeilenschlag) gerade noch zu
schaffen. In der Schlei gab es Regen, aber kaum Wind, und mir schwante
schon Böses, aber dann fegten wir doch mit reichlich Speed in
die Flensburger Förde.
Nachdem die Einweisungen abgeschlossen und alle
Boote seeklar waren, wurde es auch höchste Zeit zum Ablegen,
um die angepeilte Ein-Uhr-Brücke (spät genug
für einen Dreißigmeilenschlag) gerade noch zu
schaffen. In der Schlei gab es Regen, aber kaum Wind, und mir schwante
schon Böses, aber dann fegten wir doch mit reichlich Speed in
die Flensburger Förde.
 Die Entscheidung für den Kleinen Belt
anstelle des Großen traf ich im Stillen. Aus dem
Gefühl heraus: Ich mag ihn lieber, er ist landschaftlich
reizvoller, auch wenn er uns einige Meilen mehr Strecke einbrachte. Wir
hätten mir dem gleichen Wind auch nach Marstal gehen
können, aber es wurde - nein, nicht Sønderborg,
sondern Sottrupskov: ein kleiner Anleger im Als Sund, wo ein Nachbau
des Nydambootes liegt und man außer von wenigen
Häusern ausschließlich von Natur und Idylle umgeben
ist.
Die Entscheidung für den Kleinen Belt
anstelle des Großen traf ich im Stillen. Aus dem
Gefühl heraus: Ich mag ihn lieber, er ist landschaftlich
reizvoller, auch wenn er uns einige Meilen mehr Strecke einbrachte. Wir
hätten mir dem gleichen Wind auch nach Marstal gehen
können, aber es wurde - nein, nicht Sønderborg,
sondern Sottrupskov: ein kleiner Anleger im Als Sund, wo ein Nachbau
des Nydambootes liegt und man außer von wenigen
Häusern ausschließlich von Natur und Idylle umgeben
ist.
In Sønderborg wäre es eine Punktlandung
für die 17h30-Brücke geworden, doch die machte gar
nicht auf, also fuhr ich einen miserablen Aufschießer an die
Boxen im Fischerhafen, stoppte zwei Knoten Fahrt von Hand am Pfahl auf
und band uns dort fest. Die Punktlandung schaffte dann
„Martha“ für die
Achtzehnuhrbrücke - zum Segelbergen war keine Zeit, einfach
Motor an und Hebel auf den Tisch, und schon waren wir alle
fünf durch.
Zur Belohnung für den doch recht harten
Tag gab es nun noch eine gute Stunde beschaulichen Segelns ohne Welle,
dafür mit sattem Grün zu beiden Seiten, bevor wir uns
an besagtem Steg zur ersten Ruhe betteten. Durch den Als Sund zu
segeln, ist immer ein besonderes Erlebnis. Und das anfangs noch graue
Wetter spielte mit und verwöhnte uns mit wunderbarer
Abendstimmung. Zum Begrüßungskommittee
gehörten prompt "Renate" und "Drossel", zwei weitere
Folkeboote.
*
 Es lag ein Missverständnis vor. Nach
drei Tagen
auf Samsø sein zu wollen, meinte ich ernst, doch als ich
erklärte, dass wir die achtzig Meilen in einmal
fünfzig und einmal dreißig aufsplitten
müssten, wollte ich keineswegs darauf beharren, zuerst die
fünfzig zurückzulegen. So kam es bei der Gruppe
jedoch an, und weil der Wind es hergab, erwies sich das als gute
Entscheidung. Wir segelten also mit gerefften Großsegeln am
Alternativziel Middelfart vorbei ganz bis Bogense.
Es lag ein Missverständnis vor. Nach
drei Tagen
auf Samsø sein zu wollen, meinte ich ernst, doch als ich
erklärte, dass wir die achtzig Meilen in einmal
fünfzig und einmal dreißig aufsplitten
müssten, wollte ich keineswegs darauf beharren, zuerst die
fünfzig zurückzulegen. So kam es bei der Gruppe
jedoch an, und weil der Wind es hergab, erwies sich das als gute
Entscheidung. Wir segelten also mit gerefften Großsegeln am
Alternativziel Middelfart vorbei ganz bis Bogense.
Es war Wetter live.
Alles dabei. Beginnend in totaler Abdeckung, so dass Ablegen unter
Segeln am fehlenden Wind scheiterte. Einen Schauer mit sechser
Bö bekamen wir voll ab, die Gewitter zogen sämtlich
vor uns durch, und danach klarte es auf, ohne dass der Wind
nachließe. Speed ohne Ende, reichlich Ruderdruck bis zum
Muskelkater, abwechselnd offenes Wasser und eng betonnte Passagen, das
alles zunehmend unter Sommersonne und entsprechender Wärme,
während uns bisweilen die Gischt um die Ohren klatschte -
natürlich hatten wir in Middelfart noch nicht genug und
gönnten uns die weiteren fünfzehn Meilen.
*
 Nach dem
Abklingen der morgendlichen Schauer gab es Entspannung mit
T-Shirt-Wetter und dödeligen zweieinhalb Knoten. Aber Kopp
nich innen Sand stecken: Es kam dann doch wieder eine frische Brise auf
und steigerte sich zu einer wackeren vier, so dass wir mit sechs Knoten
südlich um Samsø herum und nach Langør
hinein segelten. Die Kombination aus meditativem Dümpeln,
entspannten Füßehochlegen und anschließend
zügigem Zurücklegen der Strecke sorgte für
einen grandiosen Gesamteindruck, zumal es nach dem Abziehen der letzten
Schauer richtig warm und sommerlich wurde.
Nach dem
Abklingen der morgendlichen Schauer gab es Entspannung mit
T-Shirt-Wetter und dödeligen zweieinhalb Knoten. Aber Kopp
nich innen Sand stecken: Es kam dann doch wieder eine frische Brise auf
und steigerte sich zu einer wackeren vier, so dass wir mit sechs Knoten
südlich um Samsø herum und nach Langør
hinein segelten. Die Kombination aus meditativem Dümpeln,
entspannten Füßehochlegen und anschließend
zügigem Zurücklegen der Strecke sorgte für
einen grandiosen Gesamteindruck, zumal es nach dem Abziehen der letzten
Schauer richtig warm und sommerlich wurde.
 Besonderes Bonbon: Die Kreuz in die Bucht,
zwischen
Untiefen, wie es sie sonst kaum zu sehen gibt. Mit diesem Speed, der
einem wenig Reaktionszeit lässt, wenn der Kieshaufen
näher kommt, war das aufregend, vor allem für
diejenigen, die zum ersten Mal hier einliefen. Ernst (am Ruder, von
Sabine mit Ausguck und Kartenlesen unterstützt):
„Ist das spannend! Ist das spannend!“ Ich habe mich
fast ein bisschen geärgert, schon in der Ankerbucht die Segel
geborgen zu haben, wo man doch durchaus direkt am Hafen dazu
genügend Platz hatte.
Besonderes Bonbon: Die Kreuz in die Bucht,
zwischen
Untiefen, wie es sie sonst kaum zu sehen gibt. Mit diesem Speed, der
einem wenig Reaktionszeit lässt, wenn der Kieshaufen
näher kommt, war das aufregend, vor allem für
diejenigen, die zum ersten Mal hier einliefen. Ernst (am Ruder, von
Sabine mit Ausguck und Kartenlesen unterstützt):
„Ist das spannend! Ist das spannend!“ Ich habe mich
fast ein bisschen geärgert, schon in der Ankerbucht die Segel
geborgen zu haben, wo man doch durchaus direkt am Hafen dazu
genügend Platz hatte.
Einem trüben Morgen folgte Dauerregen. Aber wir hatten es
dabei ganz gut: Es war ein schwacher Wind angekündigt, statt
dessen gab eine vier aus Ost, und wir erwischten eine mitlaufende
Strömung von gut eineinhalb Knoten. Mit deren sieben sausten
wir durch den Regen und
erreichten Grenaa gerade, als der Wind abflaute, um dann auf Nordost zu
drehen. Einzig „Martha“, die den Start verschlafen
hatte, musste zum Schluss noch zwei Holeschläge fahren, und
die Crew machte lange Gesichter, als sie zwei Stunden nach den Ersten
eintraf.

Liegetage in Grenaa und die
große Überfahrt
 Nun
hieß es: Auf passenden Wind
für die
Überfahrt warten. Der Ort war mit Grund ausgewählt -
von Grenaa ist die Passage übers Kattegat am
kürzesten, und es gibt weit und breit keine praktische
Alternative. Vom Ambiente her fällt die moderne, kommerzielle
Marina deutlich ab z.B. gegenüber Langør, aber wir
ließen es uns gutgehen in den zwei Hafentagen. Wir konnten
sie
auch durchaus brauchen - bisher hatten wir wenig getan außer
zu
segeln, und nun fanden wir einen allgemein nutzbaren Clubraum und einen
Grillplatz - klassischerweise der Aufhänger zu einem
gemeinsamen
Gruppenabend, der die einzelnen Crews endgültig zu einem
Ganzen
verbindet. Ruhe, Ausspannen, kein Zeitdruck - es waren Urlaubstage in
einem allgemeineren Sinne, als wenn es ausschließlich ums
Meilenfressen geht. Es war zu windig zum Segeln, aber sonnig genug, um
im Cockpit die Füße hochzulegen und die Umgebung zu
erkunden
- und dabei eine Weile allein zu sein und das bisher Erlebte zu
verarbeiten. Die Abwrackwerft gefiel, der Ort ebenfalls, und die
Möglichkeiten der Proviantierung waren ideal.
Außerdem
konnte „Marthas“ defekter Wasserkocher ersetzt
werden,
während ich die Zeit für einige kleine Reparaturen
nutzte -
„Paulas“ Vorpiekwerft trat in Aktion.
Nun
hieß es: Auf passenden Wind
für die
Überfahrt warten. Der Ort war mit Grund ausgewählt -
von Grenaa ist die Passage übers Kattegat am
kürzesten, und es gibt weit und breit keine praktische
Alternative. Vom Ambiente her fällt die moderne, kommerzielle
Marina deutlich ab z.B. gegenüber Langør, aber wir
ließen es uns gutgehen in den zwei Hafentagen. Wir konnten
sie
auch durchaus brauchen - bisher hatten wir wenig getan außer
zu
segeln, und nun fanden wir einen allgemein nutzbaren Clubraum und einen
Grillplatz - klassischerweise der Aufhänger zu einem
gemeinsamen
Gruppenabend, der die einzelnen Crews endgültig zu einem
Ganzen
verbindet. Ruhe, Ausspannen, kein Zeitdruck - es waren Urlaubstage in
einem allgemeineren Sinne, als wenn es ausschließlich ums
Meilenfressen geht. Es war zu windig zum Segeln, aber sonnig genug, um
im Cockpit die Füße hochzulegen und die Umgebung zu
erkunden
- und dabei eine Weile allein zu sein und das bisher Erlebte zu
verarbeiten. Die Abwrackwerft gefiel, der Ort ebenfalls, und die
Möglichkeiten der Proviantierung waren ideal.
Außerdem
konnte „Marthas“ defekter Wasserkocher ersetzt
werden,
während ich die Zeit für einige kleine Reparaturen
nutzte -
„Paulas“ Vorpiekwerft trat in Aktion.
 Am
zweiten Tag bereiteten wir uns navigatorisch und emotional auf die
anstehende Nachtfahrt vor, die für Viele die erste ihres
Lebens hätte sein sollen. Schade nur, dass sie gar nicht
stattfand: Sah es zunächst so aus, als sei die Nacht zwischen
einem pustigen Donnerstag und einem verregneten, schwachwindigen
Freitag ideal für den langen Schlag, so lautete die Prognose
am Nachmittag: Südwest fünf, vorübergehend
sechs, und eineinhalb Meter Welle. Platt vorm Laken bei Hack ist nun
alles andere als günstig, und so vertagten wir das Auslaufen
auf das erste Licht des Freitags und hofften, dass der Wind uns nicht
allzu früh im Stich lassen würde.
Am
zweiten Tag bereiteten wir uns navigatorisch und emotional auf die
anstehende Nachtfahrt vor, die für Viele die erste ihres
Lebens hätte sein sollen. Schade nur, dass sie gar nicht
stattfand: Sah es zunächst so aus, als sei die Nacht zwischen
einem pustigen Donnerstag und einem verregneten, schwachwindigen
Freitag ideal für den langen Schlag, so lautete die Prognose
am Nachmittag: Südwest fünf, vorübergehend
sechs, und eineinhalb Meter Welle. Platt vorm Laken bei Hack ist nun
alles andere als günstig, und so vertagten wir das Auslaufen
auf das erste Licht des Freitags und hofften, dass der Wind uns nicht
allzu früh im Stich lassen würde.
Der Hafen war
auffällig leer, obwohl auch in Dänemark die
Sommerferien begonnen hatten. Da haben wohl viele Dänen den
Segelurlaub angesichts des durchwachsenen Wetters
hinausgezögert, und viele Deutsche dürften sich
erinnert haben, dass Fehmarn auch reizvoll ist. Sogar vom chronisch
überfüllten Anholt wurde berichtet, dass es dort noch
nie so leer gewesen sei im Juli. Uns war das gerade recht - wir bekamen
in Grenaa fünf beinahe zusammenhängende, wunderbar
geschützte Liegeplätze, was Kommunikation und
Gruppendynamik erheblich erleichterte.
 Statt abends starteten wir zum
Sonnenaufgang zur großen, langen Reise über siebzig
Meilen offenes Wasser. Zu Beginn raufte ich mir die Haare: Zuerst
dümpelten wir mit drei Knoten in der Landabdeckung herum, dann
würfelte uns eine hässliche Dünung
durcheinander. Mit der nordgehenden Strömung machten wir dann
aber auch mit wenig Wind gute Fahrt, und als die Ursache der
erheblichen Welle auch uns erreichte, ging es dann gut los. Da hatten
wir allerdings schon die zwanzig Meilen zur Nordecke des Windparks
Anholt zurückgelegt und dann eine Stunde vorm Wind gegeigt und
gewackelt, bevor ich mich als Erster aufs Vorschiff traute, um die Fock
auszubaumen. Es war ein Seeeeeeeegen! Sofort lag die zuvor zappelnde,
schwankende „Paula“ sagenhaft ruhig auf dem Ruder
und sauste los. Die anderen Crews folgten dem Beispiel.
Statt abends starteten wir zum
Sonnenaufgang zur großen, langen Reise über siebzig
Meilen offenes Wasser. Zu Beginn raufte ich mir die Haare: Zuerst
dümpelten wir mit drei Knoten in der Landabdeckung herum, dann
würfelte uns eine hässliche Dünung
durcheinander. Mit der nordgehenden Strömung machten wir dann
aber auch mit wenig Wind gute Fahrt, und als die Ursache der
erheblichen Welle auch uns erreichte, ging es dann gut los. Da hatten
wir allerdings schon die zwanzig Meilen zur Nordecke des Windparks
Anholt zurückgelegt und dann eine Stunde vorm Wind gegeigt und
gewackelt, bevor ich mich als Erster aufs Vorschiff traute, um die Fock
auszubaumen. Es war ein Seeeeeeeegen! Sofort lag die zuvor zappelnde,
schwankende „Paula“ sagenhaft ruhig auf dem Ruder
und sauste los. Die anderen Crews folgten dem Beispiel.
 Es hatte sich
bereits eine Reihenfolge etabliert, wonach sich
„Paula“ und „Frieda“ ein
ausgeglichenes Rennen lieferten, gefolgt von
„Martha“, dann „Oliese“,
während „Salty“ nicht so recht
durchstarten wollte. „Martha“ hatte diesmal einen
wesentlichen Vorteil - sie legte als Erste ab, segelte entsprechend
früher aus der Abdeckung und in die Strömung, nahm
also immer ein Weilchen früher zusätzliche Fahrt auf.
Das half aber alles nichts, denn wir hatten drei Meilen vor dem
Tiefwasserweg einen Treffpunkt vereinbart, um auf die
Nachzügler zu warten und es in voller Gruppenstärke
mit den großen Dampfern aufzunehmen.
Es hatte sich
bereits eine Reihenfolge etabliert, wonach sich
„Paula“ und „Frieda“ ein
ausgeglichenes Rennen lieferten, gefolgt von
„Martha“, dann „Oliese“,
während „Salty“ nicht so recht
durchstarten wollte. „Martha“ hatte diesmal einen
wesentlichen Vorteil - sie legte als Erste ab, segelte entsprechend
früher aus der Abdeckung und in die Strömung, nahm
also immer ein Weilchen früher zusätzliche Fahrt auf.
Das half aber alles nichts, denn wir hatten drei Meilen vor dem
Tiefwasserweg einen Treffpunkt vereinbart, um auf die
Nachzügler zu warten und es in voller Gruppenstärke
mit den großen Dampfern aufzunehmen.
Während
„Martha“ und „Frieda“,
später auch „Oliese“, auf der Stelle hin
und her segelten, bedienten sich „Paula“ und ich
aller verfügbaren Tricks, um vorm Wind Fahrt rauszunehmen, bis
die aus unerfindlichen Gründen behäbige
„Salty“ endlich aufkam: Großschot dicht,
Achterstag dicht, Fockschot gefiert, bis der Ausbaumer träge
herumschlabberte, dann noch durch die Halse, um weiteren Druck aus dem
Vorsegel zu nehmen. Ergebnis: Immer noch fast drei Knoten Fahrt. Als
ich dann auch noch die Pütz als Treibanker benutzte, waren wir
endlich langsam genug, um uns punktgenau zusammenzufinden.
 Bis hierhin
hätte es kaum besser laufen können, nun ging das Eine
oder Andere schief: Der Wind ließ nach und drehte
ungünstig, als sei er beleidigt, dass wir Fahrt rausnahmen,
anstatt uns seiner uneingeschränkt zu erfreuen, und auf
„Martha“ verabschiedete sich ein Beschlag des
Fockausbaumers. Durchgeschüttelt von Wellen und Dampferschwell
hoppelten wir mit drei Knoten zum Tiefwasserweg. Je einem Schiff in
südlicher und nördlicher Richtung wichen wir
mustergültig und kollektiv aus, kämpften uns wacker
durch ihr Kielwasser, dann konnten wir zurück auf Kurs gehen,
wobei „Marthas“ Crew am Funk ein bisschen
unglücklich klang. Es war dann wohl
„Paula“, ständig im Hintergrund um das
Wohl ihrer Schwestern und der Chartergäste bemüht,
die für neuen Wind sorgte: Unerwartet kam eine frische Brise
aus Südost auf, die uns in der Windeseile von
fünfeinhalb Knoten durch die letzten zwanzig Meilen
spülte.
Bis hierhin
hätte es kaum besser laufen können, nun ging das Eine
oder Andere schief: Der Wind ließ nach und drehte
ungünstig, als sei er beleidigt, dass wir Fahrt rausnahmen,
anstatt uns seiner uneingeschränkt zu erfreuen, und auf
„Martha“ verabschiedete sich ein Beschlag des
Fockausbaumers. Durchgeschüttelt von Wellen und Dampferschwell
hoppelten wir mit drei Knoten zum Tiefwasserweg. Je einem Schiff in
südlicher und nördlicher Richtung wichen wir
mustergültig und kollektiv aus, kämpften uns wacker
durch ihr Kielwasser, dann konnten wir zurück auf Kurs gehen,
wobei „Marthas“ Crew am Funk ein bisschen
unglücklich klang. Es war dann wohl
„Paula“, ständig im Hintergrund um das
Wohl ihrer Schwestern und der Chartergäste bemüht,
die für neuen Wind sorgte: Unerwartet kam eine frische Brise
aus Südost auf, die uns in der Windeseile von
fünfeinhalb Knoten durch die letzten zwanzig Meilen
spülte.
Auf den letzten Metern ließ "Paula" - wie ich
beflügelt von der Aussicht, nach fünzehn Stunden auf
offenem Wasser die ersten Schären zu erreichen - die teuflisch
schnelle "Frieda" doch noch ein paar Bootslängen hinter sich.
"Hallo, Steine! Wir haben Euch vermisst", rief ich in unsere
felsige Umgebung. Dann konzentrierte ich mich auf die letzten Meile vor
dem Anlegen. Zu lange waren wir nicht mehr hier, mussten uns an das
geliebte Revier erst wieder gewöhnen.
 Die fünf Boote
nacheinander vorsichtig und sorgfältig mit Heckanker oder
Mooring sowie untereinander und am Steg zu vertäuen, dauerte
eine Stunde - inklusive des Dramas um "Oliese". Dann endlich konnten
wir anstoßen auf das, was wir geschafft hatten, und ich riet
allen, ruhig ein bisschen stolz auf diese siebzig Meilen zu sein. Dies
als Gruppe eigenverantwortlicher Crews bewältigt zu haben,
miteinander regattiert und aufeinander geachtet und gewartet zu haben,
sich über die Ankunft jedes Bootes freuen zu dürfen,
war ein bemerkenswertes Erlebnis.
Die fünf Boote
nacheinander vorsichtig und sorgfältig mit Heckanker oder
Mooring sowie untereinander und am Steg zu vertäuen, dauerte
eine Stunde - inklusive des Dramas um "Oliese". Dann endlich konnten
wir anstoßen auf das, was wir geschafft hatten, und ich riet
allen, ruhig ein bisschen stolz auf diese siebzig Meilen zu sein. Dies
als Gruppe eigenverantwortlicher Crews bewältigt zu haben,
miteinander regattiert und aufeinander geachtet und gewartet zu haben,
sich über die Ankunft jedes Bootes freuen zu dürfen,
war ein bemerkenswertes Erlebnis.

Schärensegeln
 Nach dem Skippertraining und Crewwechsel wollten
wir eigentlich noch
zwanzig Meilen nach Norden schaffen. Nach einer kurzen Besprechung
bereiteten sich alle darauf vor, indem sie wahlweise endlich den
Abwasch erledigten oder einen Haufen Wegpunkte ins GPS eingaben, obwohl
die vor uns liegende Strecke eigentlich so simpel war wie eine Querung
der Dänischen Südsee. Ich vertrieb mir die Zeit mit
dem Einholen des aktuellen Seewetterberichtes. Und hätte das
Tagesprogramm beinahe komplett gecancelt. West sechs, nördlich
von Göteborg gar sieben, war nicht ideal, doch ich wollte
nicht erneut als Spielverderber auftreten. Also empfahl ich vor dem
gewagten Auslaufen lediglich zu reffen.
Nach dem Skippertraining und Crewwechsel wollten
wir eigentlich noch
zwanzig Meilen nach Norden schaffen. Nach einer kurzen Besprechung
bereiteten sich alle darauf vor, indem sie wahlweise endlich den
Abwasch erledigten oder einen Haufen Wegpunkte ins GPS eingaben, obwohl
die vor uns liegende Strecke eigentlich so simpel war wie eine Querung
der Dänischen Südsee. Ich vertrieb mir die Zeit mit
dem Einholen des aktuellen Seewetterberichtes. Und hätte das
Tagesprogramm beinahe komplett gecancelt. West sechs, nördlich
von Göteborg gar sieben, war nicht ideal, doch ich wollte
nicht erneut als Spielverderber auftreten. Also empfahl ich vor dem
gewagten Auslaufen lediglich zu reffen.
 Die Wellenhöhe, die
uns ausgangs des Fjordes packte, hatte ich so nicht erwartet. Segeln
ließ sich das an und für sich ausgezeichnet - kaum
Ruderdruck und eine harmonische, gut ausgeprägte See, die man
bequem aussteuern konnte. Es war dann ein Defekt auf
„Martha“, der uns zum Umkehren zwang:
Björn, inzwischen einhand unterwegs, fragte über
Funk, ob in der Werkzeugkiste ein Schäkel sei. „Was
suchst du? Nen Schäkel?“ fragte ich. „Nen
Schäkel“, bestätigte Björn.
„Äh, worum gehts denn?“ verlangte ich nun
zu wissen und erfuhr, dass das Problem ein kaputter Fockholepunkt war.
Das war allemal Vorwand genug, die Sache abzubrechen und das Malheur in
Ruhe im Hafen zu reparieren, anstatt Björn das einhand bei
zwei Meter See zu überlassen. Ich denke, insgeheim waren Alle
gleichzeitig erleichtert, dass sie umkehren durften, und dankbar
für die wertvolle Erfahrung, die der kurze Schlag bedeutete:
Die Einen erkannten ihre (derzeitigen) Grenzen, die Anderen merkten,
was sie und ihr Boot abkönnen, und die Dritten stellten fest,
dass sie zwar auf dem „Kotzkurs“ mit achterlicher
Welle unter Deck seekrank werden, bei Hack von vorn als
Rudergänger aber nicht zu stoppen sind. Das Experiment sollte
sich später noch auszahlen.
Die Wellenhöhe, die
uns ausgangs des Fjordes packte, hatte ich so nicht erwartet. Segeln
ließ sich das an und für sich ausgezeichnet - kaum
Ruderdruck und eine harmonische, gut ausgeprägte See, die man
bequem aussteuern konnte. Es war dann ein Defekt auf
„Martha“, der uns zum Umkehren zwang:
Björn, inzwischen einhand unterwegs, fragte über
Funk, ob in der Werkzeugkiste ein Schäkel sei. „Was
suchst du? Nen Schäkel?“ fragte ich. „Nen
Schäkel“, bestätigte Björn.
„Äh, worum gehts denn?“ verlangte ich nun
zu wissen und erfuhr, dass das Problem ein kaputter Fockholepunkt war.
Das war allemal Vorwand genug, die Sache abzubrechen und das Malheur in
Ruhe im Hafen zu reparieren, anstatt Björn das einhand bei
zwei Meter See zu überlassen. Ich denke, insgeheim waren Alle
gleichzeitig erleichtert, dass sie umkehren durften, und dankbar
für die wertvolle Erfahrung, die der kurze Schlag bedeutete:
Die Einen erkannten ihre (derzeitigen) Grenzen, die Anderen merkten,
was sie und ihr Boot abkönnen, und die Dritten stellten fest,
dass sie zwar auf dem „Kotzkurs“ mit achterlicher
Welle unter Deck seekrank werden, bei Hack von vorn als
Rudergänger aber nicht zu stoppen sind. Das Experiment sollte
sich später noch auszahlen.
 Es war schon ruppig, und
Götz, der ja nun auf „Oliese“ segelte,
aber weiterhin auf „Martha“ wohnte und schlief,
fragte entsetzt: „Was hast du denn mit unserer
schönen, ordentlichen Kajüte gemacht?“
Björns Antwort: „Ich hab das Schapp
leergesegelt.“
Es war schon ruppig, und
Götz, der ja nun auf „Oliese“ segelte,
aber weiterhin auf „Martha“ wohnte und schlief,
fragte entsetzt: „Was hast du denn mit unserer
schönen, ordentlichen Kajüte gemacht?“
Björns Antwort: „Ich hab das Schapp
leergesegelt.“
Am inzwischen komplett leeren Steg konnten wir noch einmal in Ruhe
Anlegen Schären-style üben und danach einen Rundgang
unter dem Aspekt Brandung vornehmen, dann krochen die Ersten in die
Koje und freuten sich auf das nächste Abenteuer. Sie
versäumten nicht nur den Sonnenuntergang: So weit im Norden
wird es im Juli nie richtig dunkel, doch der Himmel verfärbt
sich von leuchtend Rot über Zitronengelb und
Froschgrün zu einer erdigen Mischung aus Rostbraun und Ocker,
diesmal akzentuiert durch lange, parallele Zirren, die zwar Regen
ankündigten, aber auch ein sagenhaftes Naturschauspiel
darstellten, das man erlebt haben muss, um es glauben zu
können. „Paula“, ihre
unermüdlichen Schwestern und ich jedenfalls genossen das
Spektakel.
 Wir segelten also mit eintägiger
Verspätung nach Fjordholmen. Seglerisch war es noch nicht das
eigentliche Ding: Relativ offenes Wasser mit wenigen Tonnen, Baken,
Felsen und Kursänderungen. Dafür gab es zum ersten
Mal richtiges Schärenankern: Vorleinen zum Stein, an
vorhandenen Ringen oder unseren mitgebrachten Schärenhaken
belegt, dazu der
Heckanker. Als zusätzliche Schwierigkeit blockierte eine
schwedische Yacht nicht nur den einzigen wirklich idealen Platz,
sondern hatte mit langen Querleinen im Prinzip die gesamte Bucht
abgesperrt. Da musste ich erst einige Kreise drehen, bis die Crew uns
den Zugang gewährte - der Rest der Flottille beäugte
das Treiben aus sicherer Entfernung geduldig, ohne sich einen Reim
darauf machen zu können. Es war dann gerade genug Platz
für uns, allerdings konnte nur „Paula“ die
Schäre erreichen, die Anderen hatten ein Hindernis aus Granit
vor dem Steven.
Wir segelten also mit eintägiger
Verspätung nach Fjordholmen. Seglerisch war es noch nicht das
eigentliche Ding: Relativ offenes Wasser mit wenigen Tonnen, Baken,
Felsen und Kursänderungen. Dafür gab es zum ersten
Mal richtiges Schärenankern: Vorleinen zum Stein, an
vorhandenen Ringen oder unseren mitgebrachten Schärenhaken
belegt, dazu der
Heckanker. Als zusätzliche Schwierigkeit blockierte eine
schwedische Yacht nicht nur den einzigen wirklich idealen Platz,
sondern hatte mit langen Querleinen im Prinzip die gesamte Bucht
abgesperrt. Da musste ich erst einige Kreise drehen, bis die Crew uns
den Zugang gewährte - der Rest der Flottille beäugte
das Treiben aus sicherer Entfernung geduldig, ohne sich einen Reim
darauf machen zu können. Es war dann gerade genug Platz
für uns, allerdings konnte nur „Paula“ die
Schäre erreichen, die Anderen hatten ein Hindernis aus Granit
vor dem Steven.
 Wir legten uns ins Päckchen,
„Paula“ diente als Ausstieg. Der ganze Vorgang
dauerte über eine Stunde, wollte er doch ruhig und
sorgfältig durchgeführt werden. Da bestand auch noch
Raum für Verbesserungen, warfen wir doch unsere Heckanker ein
bisschen durcheinander und vor allem konsequent genau auf die
Ankerleine eines norwegischen Nachbarn. Während wir so unsere
Boote sicher vertäuten, legten die Schweden ab, so dass der
Premiumplatz schließlich „Oliese“ zur
Verfügung stand. Es war schön auf Fjordholmen - und
wir trafen auf eine der typischen Komposttoiletten, die wirklich
durchdacht sind und nach zwei Nächten ganz ohne Klo
überaus luxuriös wirken.
Wir legten uns ins Päckchen,
„Paula“ diente als Ausstieg. Der ganze Vorgang
dauerte über eine Stunde, wollte er doch ruhig und
sorgfältig durchgeführt werden. Da bestand auch noch
Raum für Verbesserungen, warfen wir doch unsere Heckanker ein
bisschen durcheinander und vor allem konsequent genau auf die
Ankerleine eines norwegischen Nachbarn. Während wir so unsere
Boote sicher vertäuten, legten die Schweden ab, so dass der
Premiumplatz schließlich „Oliese“ zur
Verfügung stand. Es war schön auf Fjordholmen - und
wir trafen auf eine der typischen Komposttoiletten, die wirklich
durchdacht sind und nach zwei Nächten ganz ohne Klo
überaus luxuriös wirken.
 Es bestand dann Bedarf
danach, uns mal wieder in einem richtigen Hafen blicken zu lassen, mit
Strom, Wasser, Dusche und vor allem Kaufmannsladen. Die Wahl fiel auf
Aastol, eine über und über von Häusern
bedeckte Schäre mit einem gemütlichen Hafen in der
Mitte. Der Segelschlag dorthin führte uns dreißig
Meilen nordwärts, wobei wir das Fahrwasser nach
Göteborg queren mussten. Ansonsten wechselten enge und
weitläufige Passagen in schneller Folge ab.
Es bestand dann Bedarf
danach, uns mal wieder in einem richtigen Hafen blicken zu lassen, mit
Strom, Wasser, Dusche und vor allem Kaufmannsladen. Die Wahl fiel auf
Aastol, eine über und über von Häusern
bedeckte Schäre mit einem gemütlichen Hafen in der
Mitte. Der Segelschlag dorthin führte uns dreißig
Meilen nordwärts, wobei wir das Fahrwasser nach
Göteborg queren mussten. Ansonsten wechselten enge und
weitläufige Passagen in schneller Folge ab.
Dass es ein
bemerkenswerter Tag sein würde, ein Teilnehmer beschrieb ihn
als „das waren mindestens drei Tage in einem“,
dafür sorgte neben der Landschaft und dem immer weiteren
Vordringen in die Besonderheiten der Schärenwelt vor allem der
Wind. Ich drängelte schon abends auf einen frühen
Aufbruch, morgens um sieben drängelte ich noch mehr, war doch
für den Nachmittag mit dem Durchgang eines Trogs zu rechnen,
begleitet von Wind bis sechs Beaufort sowie von Schauern und Gewittern.
Ich empfahl auch morgens schon zu reffen, denn die fröhliche
Brise, die über die Insel wehte, war mir nicht
uneingeschränkt geheuer.
Das Ablegen war großartig -
konzentriert und bedächtig bekamen wir alle Schiffe vom Felsen
weg und die Heckanker frei. Beim Segelsetzen merkte ich sofort, dass
das Reffen eine gute Idee war: „Paula“ sauste nur
unter Fock schon los wie der Teufel, und ich durfte mich in Ruhe damit
beschäftigen, das Knäuel zu entheddern, das in
Sekundenschnelle aus den beiden Parten der Fockschot sowie dem Fockfall
entstanden war. Endlich konnte auch das Groß hoch,
und
wir sausten mit über sieben Knoten über Grund durch
die steinige Inselwelt.
 Ein Erlebnis war die Querung des
Göteborg-Fahrwassers. Hoch am Wind bei strammen
sechs Windstärken zwischen Felsen und gigantischen Seezeichen
hindurch zu schießen, macht man nicht alle Tage. Den ganzen
Tag hätte der stramme Ritt für meinen Geschmack nicht
dauern müssen, doch nördlich des Fahrwassers
verkrochen wir uns ja wieder in den Schutz der Schären und
konnten ein paar Grad abfallen. Als wir vorübergehend wieder
offenes Wasser erreichten, hatte der Wind erheblich abgenommen, und die
Sonne zeigte sich dann und wann. Bei der Kreuz im Marstrands Fjord
wurde es höchste Zeit zum Ausreffen. Und dank des
frühen Aufbruchs und der Rauschefahrt erreichten wir Aastol
deutlich rechtzeitig vor den nachmittäglichen Schauern.
Ein Erlebnis war die Querung des
Göteborg-Fahrwassers. Hoch am Wind bei strammen
sechs Windstärken zwischen Felsen und gigantischen Seezeichen
hindurch zu schießen, macht man nicht alle Tage. Den ganzen
Tag hätte der stramme Ritt für meinen Geschmack nicht
dauern müssen, doch nördlich des Fahrwassers
verkrochen wir uns ja wieder in den Schutz der Schären und
konnten ein paar Grad abfallen. Als wir vorübergehend wieder
offenes Wasser erreichten, hatte der Wind erheblich abgenommen, und die
Sonne zeigte sich dann und wann. Bei der Kreuz im Marstrands Fjord
wurde es höchste Zeit zum Ausreffen. Und dank des
frühen Aufbruchs und der Rauschefahrt erreichten wir Aastol
deutlich rechtzeitig vor den nachmittäglichen Schauern.
 Aastol
erwies sich als lohnenswertes Ziel. Ein einzigartiger Ort voller Charme
und Schönheiten, mit einem Park, einem Kaufmann, einem
gemütlichen Café und einem tollen, kleinen Hafen.
Durchaus auch einem vollen, kleinen Hafen, doch wir waren ja
früh dran und setzten gleich mal unseren eigenen, chaotischen
Folkeboot-Kopf durch: Wo man eigentlich mit Mooringleinen anlegt,
gingen wir ins Fünferpäckchen, was uns nur
ausnahmsweise gestattet wurde: Wir sparten dadurch einen Liegeplatz.
Und wir fielen natürlich auf, wurden immer wieder
angesprochen, wo wir herkämen und was wir für ein
Verein seien.
Aastol
erwies sich als lohnenswertes Ziel. Ein einzigartiger Ort voller Charme
und Schönheiten, mit einem Park, einem Kaufmann, einem
gemütlichen Café und einem tollen, kleinen Hafen.
Durchaus auch einem vollen, kleinen Hafen, doch wir waren ja
früh dran und setzten gleich mal unseren eigenen, chaotischen
Folkeboot-Kopf durch: Wo man eigentlich mit Mooringleinen anlegt,
gingen wir ins Fünferpäckchen, was uns nur
ausnahmsweise gestattet wurde: Wir sparten dadurch einen Liegeplatz.
Und wir fielen natürlich auf, wurden immer wieder
angesprochen, wo wir herkämen und was wir für ein
Verein seien.

Das Meisterstück
 Acht Uhr morgens. Draußen regnet es.
Roland, Jochen und ich
hocken auf Frieda unter Deck, Thomas gesellt sich zu uns. Der Tee ist
aufgebrüht, nun machen wir Tagesplanung. Es pustet mit
fünf bis sechs, und so ist auch die Prognose bis
ungefähr sonst wann, zumindest die nächsten zwei
Tage. „Wir haben drei Möglichkeiten“,
skizziere ich, um ein erstes Meinungsbild zu erstellen, „hier
bleiben, das Innenfahrwasser um Tjörn und Orust fahren oder
uns der Sache stellen.“
Acht Uhr morgens. Draußen regnet es.
Roland, Jochen und ich
hocken auf Frieda unter Deck, Thomas gesellt sich zu uns. Der Tee ist
aufgebrüht, nun machen wir Tagesplanung. Es pustet mit
fünf bis sechs, und so ist auch die Prognose bis
ungefähr sonst wann, zumindest die nächsten zwei
Tage. „Wir haben drei Möglichkeiten“,
skizziere ich, um ein erstes Meinungsbild zu erstellen, „hier
bleiben, das Innenfahrwasser um Tjörn und Orust fahren oder
uns der Sache stellen.“
 Roland ist derjenige, der
für Segeln durch die Außenschären
plädiert. Vasholmarna ist unser Ziel, das südlichste
Vorkommen des wunderschönen, roten, gerundeten Granits, das
den Norden von Bohuslän prägt und an dem man
bisweilen längsseits anlegen kann. Was die Anderen allenfalls
ahnen, als wir unsere Nasen in die Seekarten stecken und die
Tagesetappe navigatorisch durchgehen: Das ist jetzt das eigentliche
Ding. Seit wir in Schweden angekommen sind, haben wir uns langsam ans
Schärensegeln herangetastet. Was uns heute erwartet - bei
ordentlich Wind und einem Speed von konstant sechs Knoten, der den
schnellen Schnitten des Actionfilms zusätzlich einen
Zeitraffer verpasst - ist Segeln pur: Tonnen, Baken, Felsen, kaum eine
Minute ohne Kursänderung. Wir können uns meistens auf
nördlichem Kurs hinter solidem Fels verstecken, immer wieder
erwartet uns aber offenes Wasser mit gewaltiger Brandung, gerne auch
mit einer kleinen Kreuz, und die Engstellen sind wirklich eng, so eng,
dass man hier und da eine Warteschleife drehen muss, wenn Gegenverkehr
kommt.
Roland ist derjenige, der
für Segeln durch die Außenschären
plädiert. Vasholmarna ist unser Ziel, das südlichste
Vorkommen des wunderschönen, roten, gerundeten Granits, das
den Norden von Bohuslän prägt und an dem man
bisweilen längsseits anlegen kann. Was die Anderen allenfalls
ahnen, als wir unsere Nasen in die Seekarten stecken und die
Tagesetappe navigatorisch durchgehen: Das ist jetzt das eigentliche
Ding. Seit wir in Schweden angekommen sind, haben wir uns langsam ans
Schärensegeln herangetastet. Was uns heute erwartet - bei
ordentlich Wind und einem Speed von konstant sechs Knoten, der den
schnellen Schnitten des Actionfilms zusätzlich einen
Zeitraffer verpasst - ist Segeln pur: Tonnen, Baken, Felsen, kaum eine
Minute ohne Kursänderung. Wir können uns meistens auf
nördlichem Kurs hinter solidem Fels verstecken, immer wieder
erwartet uns aber offenes Wasser mit gewaltiger Brandung, gerne auch
mit einer kleinen Kreuz, und die Engstellen sind wirklich eng, so eng,
dass man hier und da eine Warteschleife drehen muss, wenn Gegenverkehr
kommt.
 Zunächst verordnete ich uns Ablegen
unter Segeln,
Neuland für die Meisten. Zwei Meter Welle umströmten
Aastol, da musste das Tuch auf jeden Fall im Hafen hoch, und wo ginge
das einfacher als fest vertäut am Liegeplatz? Unsere Situation
verbesserte sich dramatisch, als unsere Nachbarn ausliefen - wir hatten
vorn und achtern genug Platz um Fahrt aufzunehmen, uns freizusegeln und
Richtung Hafenausfahrt abzufallen. Gemeinsam - es hielt immer jemand
die Vorleine und die Achterspring, warf sie im richtigen Augenblick
los, konnte bei Bedarf noch ein bisschen abstoßen - gelang
das Manöver einwandrei - und bildete den Auftakt zum
unübertrefflichen Höhepunkt der Reise.
Zunächst verordnete ich uns Ablegen
unter Segeln,
Neuland für die Meisten. Zwei Meter Welle umströmten
Aastol, da musste das Tuch auf jeden Fall im Hafen hoch, und wo ginge
das einfacher als fest vertäut am Liegeplatz? Unsere Situation
verbesserte sich dramatisch, als unsere Nachbarn ausliefen - wir hatten
vorn und achtern genug Platz um Fahrt aufzunehmen, uns freizusegeln und
Richtung Hafenausfahrt abzufallen. Gemeinsam - es hielt immer jemand
die Vorleine und die Achterspring, warf sie im richtigen Augenblick
los, konnte bei Bedarf noch ein bisschen abstoßen - gelang
das Manöver einwandrei - und bildete den Auftakt zum
unübertrefflichen Höhepunkt der Reise.
 Zu Beginn der
Tagesetappe erwartete uns eine kleine Kreuz. Wir hoppeln über
die aufgewühlte See, bis wir unser Schlupfloch erreicht haben.
Was dann passiert, lässt sich mit Worten wie
„krass“, „geil“ oder
Ähnlichem kaum zutreffend beschreiben. Wer die neunzehn Meilen
zwischen Aastol und Gullhomen nicht kennt, wird unmöglich
nachvollziehen können, wie unser Tag verlief. Abenteuer pur -
und es war eine Freude zu sehen, wie alle das genossen, wie auch die
unerfahrenste Crew super mit den Bedingungen klarkam, wie
Björn und ich einander angrinsten, als wir das letzte
Stück nebeneinander her segelten, bevor es dann wieder hoch am
Wind über zwei Meilen offenes Wasser, zwei Meter See und
alles, unserem Ziel entgegenging.
Zu Beginn der
Tagesetappe erwartete uns eine kleine Kreuz. Wir hoppeln über
die aufgewühlte See, bis wir unser Schlupfloch erreicht haben.
Was dann passiert, lässt sich mit Worten wie
„krass“, „geil“ oder
Ähnlichem kaum zutreffend beschreiben. Wer die neunzehn Meilen
zwischen Aastol und Gullhomen nicht kennt, wird unmöglich
nachvollziehen können, wie unser Tag verlief. Abenteuer pur -
und es war eine Freude zu sehen, wie alle das genossen, wie auch die
unerfahrenste Crew super mit den Bedingungen klarkam, wie
Björn und ich einander angrinsten, als wir das letzte
Stück nebeneinander her segelten, bevor es dann wieder hoch am
Wind über zwei Meilen offenes Wasser, zwei Meter See und
alles, unserem Ziel entgegenging.
 Wer bei Segeln an entspanntes
Dümpeln unter blauem Himmel denkt, liegt hier völlig
falsch. Wer stundenlanges Starren auf den Kompass im Sinn hat,
ebenfalls. Es ging ständig darum, sich in der Seekarte die
drei Seezeichen und Landmarken einzuprägen, die hinter der
nächsten Biegung zu erwarten waren, sowie ob sie an Steuerbord
oder Backbord bleiben. War das abgearbeitet, musste erneut die Karte
auf den Schoß. Wer vom Thema abwich, nämlich der
Navigation, verlor augenblicklich die Orientierung. Und wer nicht dabei
war, hat das beeindruckende Bild versäumt, das "Martha" neben
uns abgab: Wie eine Ballerina tänzelte sie auf gewaltigen
Wellenbergen, während eine spektakuläre Brandung auf
die nächsten Felsen einprügelte.
Wer bei Segeln an entspanntes
Dümpeln unter blauem Himmel denkt, liegt hier völlig
falsch. Wer stundenlanges Starren auf den Kompass im Sinn hat,
ebenfalls. Es ging ständig darum, sich in der Seekarte die
drei Seezeichen und Landmarken einzuprägen, die hinter der
nächsten Biegung zu erwarten waren, sowie ob sie an Steuerbord
oder Backbord bleiben. War das abgearbeitet, musste erneut die Karte
auf den Schoß. Wer vom Thema abwich, nämlich der
Navigation, verlor augenblicklich die Orientierung. Und wer nicht dabei
war, hat das beeindruckende Bild versäumt, das "Martha" neben
uns abgab: Wie eine Ballerina tänzelte sie auf gewaltigen
Wellenbergen, während eine spektakuläre Brandung auf
die nächsten Felsen einprügelte.
 Vasholmarna ist
eine wunderschöne und überaus beliebte Felsengruppe,
mit zahlreichen Liegemöglichkeiten, die bei ruhigem
Sommerwetter auch meistens alle belegt sind. Ich kannte den Ort
pickepackevoll. Heute hingegen waren wir außer einer ziemlich
großen Yacht, die längsseits an der mittleren
Schäre lag, die Einzigen, die sich hier her wagten. Dadurch
war die einzige Stelle, bei der man bei einem strammen Südwest
einigermaßen geschützt und sicher liegen kann, noch
frei - aber es gab auch niemanden, der mir eine Vorleine angenommen
hätte. Die „Frieda“-Crew musste also
zunächst Roland auf dem Felsen absetzen, bevor wir die Boote
nach und nach heranwinken konnten.
Vasholmarna ist
eine wunderschöne und überaus beliebte Felsengruppe,
mit zahlreichen Liegemöglichkeiten, die bei ruhigem
Sommerwetter auch meistens alle belegt sind. Ich kannte den Ort
pickepackevoll. Heute hingegen waren wir außer einer ziemlich
großen Yacht, die längsseits an der mittleren
Schäre lag, die Einzigen, die sich hier her wagten. Dadurch
war die einzige Stelle, bei der man bei einem strammen Südwest
einigermaßen geschützt und sicher liegen kann, noch
frei - aber es gab auch niemanden, der mir eine Vorleine angenommen
hätte. Die „Frieda“-Crew musste also
zunächst Roland auf dem Felsen absetzen, bevor wir die Boote
nach und nach heranwinken konnten.
Aller modernen Technik zum Trotz
überraschte uns das Wetter: Kaum waren wir alle fest und
hatten unserer Euphorie Ausdruck verliehen, schon briste es auf. Hatte
der dänische Seewetterbericht vormittags noch von
fünf, strichweise sechs, gesprochen, so roch es jetzt nach
einer soliden sieben genau in dem Gebiet, in dem wir uns aufhielten.
Die Starkwindwarnung wurde erst herausgegeben, als wir bereits
unterwegs waren. Es
wurde eine unruhige Nacht, bei zeitweise acht Beaufort aus
Südwest ist Vashomen nicht mehr ganz so geschützt wie
bei ruhigem Wetter. Auch wenn es schaukelig war: Im Vergleich zu dem,
was da draußen los war, wo die See kochte und die Brandung
dramatisch an die Felsen klatschte, hatten wir es erstaunlich
gemütlich. Vor allem mussten wir Einiges richtig gemacht haben
beim Vertäuen der treuen Boote, denn es gab nicht einen
Kratzer.
 Nun zeigt die Erfahrung, dass auf einen Rausch
ein
gehöriger Kater folgt - und tatsächlich roch es nach
Katerstimmung, als es morgens weiter pustete und erst für die
folgende Nacht Besserung zu erwarten war. Ich besprach mit der
„Frieda“-Crew die Optionen, und wir
verständigten uns darauf, gegen dreizehn Uhr abzulegen
für einen ernstgemeinten Versuch, mit der Fock zurück
nach Gullholmem zu segeln, auf die Gefahr hin, statt dessen in den
nächsten nördlich gelegenen Hafen ablaufen zu
müssen. Während ich noch unter Deck
herumklambüsterte und hin und herüberlegte, ob das
die richtige Entscheidung war, wurde „Frieda“
segelklar gemacht, während die Anderen noch gar nicht
informiert oder gehört waren. Entsprechend sparsam guckten sie
und wirkten durchaus vorwurfsvoll in ihrem Gebahren. Das Gute daran
war, dass nun Einzelne klar und deutlich sagten, sie wollten unter
diesen Bedingungen nicht ablegen, und damit war das entschieden: Wir
blieben und wappneten uns für eine mögliche
Winddrehung in der kommenden Sturmnacht, indem wir einen
zusätzlichen Anker ausbrachten. Danach bauten wir eine
Schlauchboot-Seilfähre von unserem kleinen Felsen zur
Hauptinsel, und damit war der Tag gerettet. Dort war es
nämlich wirklich sehenswert, und man konnte sich auch einmal
für zwei Stunden ganz allein die Füße
vertreten und dabei das wahnsinnige große Ganze, aber auch
die winzigen Details der in Klüften und Spalten ihr tapferes
Dasein fristenden Blümchen auf sich wirken lassen.
Nun zeigt die Erfahrung, dass auf einen Rausch
ein
gehöriger Kater folgt - und tatsächlich roch es nach
Katerstimmung, als es morgens weiter pustete und erst für die
folgende Nacht Besserung zu erwarten war. Ich besprach mit der
„Frieda“-Crew die Optionen, und wir
verständigten uns darauf, gegen dreizehn Uhr abzulegen
für einen ernstgemeinten Versuch, mit der Fock zurück
nach Gullholmem zu segeln, auf die Gefahr hin, statt dessen in den
nächsten nördlich gelegenen Hafen ablaufen zu
müssen. Während ich noch unter Deck
herumklambüsterte und hin und herüberlegte, ob das
die richtige Entscheidung war, wurde „Frieda“
segelklar gemacht, während die Anderen noch gar nicht
informiert oder gehört waren. Entsprechend sparsam guckten sie
und wirkten durchaus vorwurfsvoll in ihrem Gebahren. Das Gute daran
war, dass nun Einzelne klar und deutlich sagten, sie wollten unter
diesen Bedingungen nicht ablegen, und damit war das entschieden: Wir
blieben und wappneten uns für eine mögliche
Winddrehung in der kommenden Sturmnacht, indem wir einen
zusätzlichen Anker ausbrachten. Danach bauten wir eine
Schlauchboot-Seilfähre von unserem kleinen Felsen zur
Hauptinsel, und damit war der Tag gerettet. Dort war es
nämlich wirklich sehenswert, und man konnte sich auch einmal
für zwei Stunden ganz allein die Füße
vertreten und dabei das wahnsinnige große Ganze, aber auch
die winzigen Details der in Klüften und Spalten ihr tapferes
Dasein fristenden Blümchen auf sich wirken lassen.
 Morgens
hatte der Wind dann endlich genug mit uns gespielt und beruhigte sich
so, dass wir weiter konnten. Das Ablegen nebst Aufsammeln der
diversen Heckanker klappte absolut fluffig, und es folgte ein
schöner Segeltag, südwärts bei
Südwind mit einem Stück Motoren, aber auch diversen
Wenden und einer spannenden Kreuz. Unseren Ankerplatz hatten wir im
Hinblick auf den zu erwartenden Nordwind konzipiert - es gelang schon
wieder eine perfekte Punktlandung: Mit dem letzten Schluck
Südwind segelten wir in die Bucht, in der abendlichen Flaute
hatten die Heckanker dann nicht mehr viel zu halten.
„Paulas“ slippte beim ersten Versuch - ich hatte
ihn genau auf eine Plastikplane geworfen.
Morgens
hatte der Wind dann endlich genug mit uns gespielt und beruhigte sich
so, dass wir weiter konnten. Das Ablegen nebst Aufsammeln der
diversen Heckanker klappte absolut fluffig, und es folgte ein
schöner Segeltag, südwärts bei
Südwind mit einem Stück Motoren, aber auch diversen
Wenden und einer spannenden Kreuz. Unseren Ankerplatz hatten wir im
Hinblick auf den zu erwartenden Nordwind konzipiert - es gelang schon
wieder eine perfekte Punktlandung: Mit dem letzten Schluck
Südwind segelten wir in die Bucht, in der abendlichen Flaute
hatten die Heckanker dann nicht mehr viel zu halten.
„Paulas“ slippte beim ersten Versuch - ich hatte
ihn genau auf eine Plastikplane geworfen.
 Inzwischen hatten sich auch
sämtliche Wolken verzogen, und so bekamen wir, was im Programm
noch gefehlt hatte: Eine wirklich lauschige Schärennacht, mit
Zusammensitzen im Cockpit bis weit nach Sonnenuntergang. Kaum ein
Geräusch war zu hören, abgesehen vom Schnattern der
Wildgänse. Morgens legten wir dann alle
standesgemäß unter Segeln ab zur letzten Etappe vor
dem Gruppenwechsel: Neun Meilen bis Marstrand bei Sonne, Wärme
und einem mäßigen Westnordwest - Sommersegeln in den
Schären, auch das war bisher zu kurz gekommen. Der Kontrast
hätte nicht markanter sein könnten: Aus der
lauschigsten aller lauschigen Buchten kamen wir ins trubelige,
turbulente Seglermekka der Westküste. Der Ort mit der
wechselvollen Geschichte bietet das Ambiente eines ehrwürdigen
Seebades, in den Laden und an den Stegen wird alles gezeigt, was in den
letzten Jahren von führenden Yachtzeitschriften getestet und
für gut befunden wurde. Zwischen all den Touristen
herumzuschlendern, endlich mal in T-Shirt und Sandalen, war genau das
Richtige.
Inzwischen hatten sich auch
sämtliche Wolken verzogen, und so bekamen wir, was im Programm
noch gefehlt hatte: Eine wirklich lauschige Schärennacht, mit
Zusammensitzen im Cockpit bis weit nach Sonnenuntergang. Kaum ein
Geräusch war zu hören, abgesehen vom Schnattern der
Wildgänse. Morgens legten wir dann alle
standesgemäß unter Segeln ab zur letzten Etappe vor
dem Gruppenwechsel: Neun Meilen bis Marstrand bei Sonne, Wärme
und einem mäßigen Westnordwest - Sommersegeln in den
Schären, auch das war bisher zu kurz gekommen. Der Kontrast
hätte nicht markanter sein könnten: Aus der
lauschigsten aller lauschigen Buchten kamen wir ins trubelige,
turbulente Seglermekka der Westküste. Der Ort mit der
wechselvollen Geschichte bietet das Ambiente eines ehrwürdigen
Seebades, in den Laden und an den Stegen wird alles gezeigt, was in den
letzten Jahren von führenden Yachtzeitschriften getestet und
für gut befunden wurde. Zwischen all den Touristen
herumzuschlendern, endlich mal in T-Shirt und Sandalen, war genau das
Richtige.
 Fünf Folkeboote auf einem Haufen fielen
hier
natürlich genauso auf wie an einer Schäre - es
dauerte keine halbe Stunde, bis wir bereits mehrfach fotografiert und
angesprochen wurden. Es wurde uns sogar ein Folke angeboten, das
dringend und gratis einen neuen Besitzer suchte. Bei
oberflächlicher Betrachtung war das arme Würstchen,
das seit Jahren ungenutzt und ungepflegt im Wasser schwamm, allerdings
nicht mehr zu retten, jedenfalls nicht mit kalkulierbarem Aufwand. Wir
gingen dann doch lieber zum Konditor und besorgten für das
Abschieds-Kaffeekränzchen auf dem Steg eine große
Tüte mit süßen Köstlichkeiten.
Fünf Folkeboote auf einem Haufen fielen
hier
natürlich genauso auf wie an einer Schäre - es
dauerte keine halbe Stunde, bis wir bereits mehrfach fotografiert und
angesprochen wurden. Es wurde uns sogar ein Folke angeboten, das
dringend und gratis einen neuen Besitzer suchte. Bei
oberflächlicher Betrachtung war das arme Würstchen,
das seit Jahren ungenutzt und ungepflegt im Wasser schwamm, allerdings
nicht mehr zu retten, jedenfalls nicht mit kalkulierbarem Aufwand. Wir
gingen dann doch lieber zum Konditor und besorgten für das
Abschieds-Kaffeekränzchen auf dem Steg eine große
Tüte mit süßen Köstlichkeiten.
Die
Tour wäre nicht komplett gewesen ohne einen Besuch hier, und
für den Crewwechsel erwies sich Marstrand als ideal. Die
Ersten reisten am frühen Nachmittag gleich ab - mit der
Fähre über den Sund, per Bus nach Göteborg,
dann mit der Fähre nach Kiel und von dort zurück zum
an der Schlei geparkten Wagen. Für diejenigen, die blieben,
stand ein bisschen Füße hochlegen und etwas
Bootspflege auf dem Programm, während wir die neue Gruppe
erwarteten.

ZWEITER TEIL
Die neue Gruppe traf ein mit den gleichen hohen Erwartungen, aber auch
der Hypothek, sich den Aufenthalt in der Wunderwelt der
Schären nicht selbst ersegelt zu haben, sondern ohne eigenes
Zutun mit der Bahn angereist zu sein. Vor ihnen stand im Wesentlichen
die Aufgabe, meine Boote pünktlich nach Hause zu bringen, doch
zuvor winkten auch ihnen einmalige Erlebnisse in einem der
anspruchsvollsten Segelreviere, bis zu dem unvermeidlichen Morgen, an
dem wir uns auf den Weg übers Kattegat machten.
 Die
Gruppenkonstellation war nun eine völlig andere: Nach und
nach, erwartungsvoll, aber erschöpft von der langen Bahnfahrt
und einem einstimmenden Bustrip durch die Schären, traf im
Laufe des Samstags ein Freundeskreis am Steg in Marstrand ein, der die
komplette Flotte für die zweite Etappe gebucht hatte. Die
Teilnehmer kamen aus allen Teilen der Republik, verbindendes Element
waren Pfadfinderei und Traditionsschiffahrt - Erfahrung im
Fahrtensegeln auf Yachten brachten nur Einzelne mit. Die Boote waren so
besetzt, dass jedes ausreichend mit Kenntnissen besetzt war - auch wenn
da im Einzelfall noch erheblicher Lernbedarf bestand.
„Oliese“ zum Beispiel segelte am Anfang dramatisch
hinerher, doch nach einer Woche war sie nicht mehr einzuholen, und ich
durfte fragen: „Warum habt ihr so getan, als ob Ihr
überhaupt nicht segeln könntet?“
Die
Gruppenkonstellation war nun eine völlig andere: Nach und
nach, erwartungsvoll, aber erschöpft von der langen Bahnfahrt
und einem einstimmenden Bustrip durch die Schären, traf im
Laufe des Samstags ein Freundeskreis am Steg in Marstrand ein, der die
komplette Flotte für die zweite Etappe gebucht hatte. Die
Teilnehmer kamen aus allen Teilen der Republik, verbindendes Element
waren Pfadfinderei und Traditionsschiffahrt - Erfahrung im
Fahrtensegeln auf Yachten brachten nur Einzelne mit. Die Boote waren so
besetzt, dass jedes ausreichend mit Kenntnissen besetzt war - auch wenn
da im Einzelfall noch erheblicher Lernbedarf bestand.
„Oliese“ zum Beispiel segelte am Anfang dramatisch
hinerher, doch nach einer Woche war sie nicht mehr einzuholen, und ich
durfte fragen: „Warum habt ihr so getan, als ob Ihr
überhaupt nicht segeln könntet?“
 Das
Seglerische stand insgesamt weniger im Vordergrund. Dafür gab
es keine Mahlzeit ohne vorheriges gemeinsames Singen. Kochen und Essen
auf Steg, Pier oder Felsen war ein kleines Happening. Es dauerte einige
Tage, bis ich die Gruppe und dann auch die Individuen ein bisschen
kannte - und bis diese im Bordalltag angekommen waren. "Das war richtig
geil!" war ein Satz, den ich anfangs vermisste, zuletzt aber
häufig zu hören bekam.
Das
Seglerische stand insgesamt weniger im Vordergrund. Dafür gab
es keine Mahlzeit ohne vorheriges gemeinsames Singen. Kochen und Essen
auf Steg, Pier oder Felsen war ein kleines Happening. Es dauerte einige
Tage, bis ich die Gruppe und dann auch die Individuen ein bisschen
kannte - und bis diese im Bordalltag angekommen waren. "Das war richtig
geil!" war ein Satz, den ich anfangs vermisste, zuletzt aber
häufig zu hören bekam.
 Auch auf
„Paula“ hatte sich etwas getan, hatten wir doch
jetzt Björn an Bord. Das musste sich einspielen, war aber
extrem vorteilhaft: Auf den zähen, langen Schlägen
konnten wir abwechselnd reichlich Zeit in der Koje verbringen, beim
Anlegen an den Schären war ich nicht auf eine andere Crew
angewiesen, und Björn nahm mir auch im Umgang mit den
Gästen, bei der Verproviantierung und bei der Schiffspflege
eine Menge Arbeit ab. Aus zwei Skippern wurde allmählich auch
eine handlungsfähige Crew - doch erst, nachdem wir begriffen
hatten, wie sehr "Paula" auf Einhandsegeln und auf mich ausgerichtet
ist, und wie sehr auch ich daran gewöhnt bin, mit ihr zusammen
zu segeln. Der Versuch beispielsweise, Wenden in der klassischen
Arbeitsteilung von Rudergänger und Vorschoter zu fahren, ging
schief. Auf "Paula" fährt der Rudergänger allein die
Wenden. Und es kommt auch vor, dass der Vorschoter - Björn -
mit dem Bergen der Fock beschäftigt ist und ich
plötzlich neben ihm stehe und das Groß runterzerre,
weil mir in den Sinn kam, dass dies ein günstiger Augenblick
dafür sei.
Auch auf
„Paula“ hatte sich etwas getan, hatten wir doch
jetzt Björn an Bord. Das musste sich einspielen, war aber
extrem vorteilhaft: Auf den zähen, langen Schlägen
konnten wir abwechselnd reichlich Zeit in der Koje verbringen, beim
Anlegen an den Schären war ich nicht auf eine andere Crew
angewiesen, und Björn nahm mir auch im Umgang mit den
Gästen, bei der Verproviantierung und bei der Schiffspflege
eine Menge Arbeit ab. Aus zwei Skippern wurde allmählich auch
eine handlungsfähige Crew - doch erst, nachdem wir begriffen
hatten, wie sehr "Paula" auf Einhandsegeln und auf mich ausgerichtet
ist, und wie sehr auch ich daran gewöhnt bin, mit ihr zusammen
zu segeln. Der Versuch beispielsweise, Wenden in der klassischen
Arbeitsteilung von Rudergänger und Vorschoter zu fahren, ging
schief. Auf "Paula" fährt der Rudergänger allein die
Wenden. Und es kommt auch vor, dass der Vorschoter - Björn -
mit dem Bergen der Fock beschäftigt ist und ich
plötzlich neben ihm stehe und das Groß runterzerre,
weil mir in den Sinn kam, dass dies ein günstiger Augenblick
dafür sei.
 Bei trockenem, warmem Wetter gelangen noch drei
tolle, aufregende, lehrreiche Segel-, sowie zwei schöne,
entspannte Liegetage in den Schären. Dann nistete sich eine
sommerliche, windarme Wetterlage ein - mit viel
schwachbrüstigem Südost, der Richtung, die wir am
schlechtesten nutzen konnten. Es drohte der Eindruck zu entstehen, es
ginge jetzt nur noch darum, mir meine Boote nach Hause zu bringen. So
konnte der weite Weg in die Schlei nur eines werden: zäh.
Endlich mal wieder auf dreieinhalb Knoten zu kommen, bot Anlass zur
Freude, die Außenborder
versahen fleißig und über Stunden ihren Dienst, und
es war eine schwierige Aufgabe, unter diesen Umständen
Spaß und Pflicht in Einklang zu bringen. Wir hatten nicht die
Wahl, uns die schönsten Liegeplätze auszusuchen,
sondern mussten zum Übernachten nehmen, was gerade vor uns
lag.
Bei trockenem, warmem Wetter gelangen noch drei
tolle, aufregende, lehrreiche Segel-, sowie zwei schöne,
entspannte Liegetage in den Schären. Dann nistete sich eine
sommerliche, windarme Wetterlage ein - mit viel
schwachbrüstigem Südost, der Richtung, die wir am
schlechtesten nutzen konnten. Es drohte der Eindruck zu entstehen, es
ginge jetzt nur noch darum, mir meine Boote nach Hause zu bringen. So
konnte der weite Weg in die Schlei nur eines werden: zäh.
Endlich mal wieder auf dreieinhalb Knoten zu kommen, bot Anlass zur
Freude, die Außenborder
versahen fleißig und über Stunden ihren Dienst, und
es war eine schwierige Aufgabe, unter diesen Umständen
Spaß und Pflicht in Einklang zu bringen. Wir hatten nicht die
Wahl, uns die schönsten Liegeplätze auszusuchen,
sondern mussten zum Übernachten nehmen, was gerade vor uns
lag.
Und dennoch: Die Lektion, dass Durchhaltevermögen
unweigerlich dazugehört, wurde gerne aufgenommen. Gemeinsam
gelang es uns, die beträchtliche Strecke
zurückzulegen, erholsame Hafentage einzubauen und die
Segelstunden, in denen es gut lief, ausgiebig zu genießen.
Gerade rechtzeitig, bevor die pünktliche Rückkehr in
Zweifel geriet, hatten wir wieder einen begeisternden, rasanten
Segeltag, der uns tüchtig voranbrachte und die Stimmung
dorthin hob, wohin sie gehörte: In schwindelerregende
Höhen.

„That was
mustergültig“, oder: Das
Glück verlässt uns (?)
Unsere erste Aufgabe bestand am Sonntag in dem Spagat, den neuen Crews
ein Minimum an Einweisung und einen Einblick ins Schärensegeln
zu geben, aber auch noch mit einem kurzen Schlag den Absprung aus dem
teuren und auf Dauer nicht gerade gemütlichen Hafen zu
schaffen. Das gelang vorzüglich: Mit zwei Booten liefen wir zu
einer kleinen Übungsrunde rund Klaaverön aus - bei
fünf bis sechs aus West und mit Björn bzw. mir sowie
jeweils drei der neuen Gäste besetzt. Das lief gut und war
hilfreich, um Boot und Felsenlandschaft ausreichend gut kennenzulernen,
damit wir anschließend noch zu einem Sechsmeilenschlag ins
wunderschöne Hjärterö auslaufen konnten.
 Die
Gruppe machte nahtlos weiter, wie sie auf dem Steg in Marstrand
begonnen hatte: Gemeinsames Kochen über vier Boote ("Welches
Boot macht das Nudelwasser heiß?"), Essen auf
dem Felsen, nicht ohne vorher die Gitarre auszupacken und ein
Pfadfinderlied zum Besten zu geben. Björn und ich hatten
Anderes im Sinn: Über den höchsten Punkt der Insel
kletterten wir zur Westseite, staunend und aus dem Grinsen nicht
herauskommend, und wurden verwöhnt mit der einzigartigen
Kombination aus pittoreskem Sonnenuntergang und spektakulärer
Brandung.
Die
Gruppe machte nahtlos weiter, wie sie auf dem Steg in Marstrand
begonnen hatte: Gemeinsames Kochen über vier Boote ("Welches
Boot macht das Nudelwasser heiß?"), Essen auf
dem Felsen, nicht ohne vorher die Gitarre auszupacken und ein
Pfadfinderlied zum Besten zu geben. Björn und ich hatten
Anderes im Sinn: Über den höchsten Punkt der Insel
kletterten wir zur Westseite, staunend und aus dem Grinsen nicht
herauskommend, und wurden verwöhnt mit der einzigartigen
Kombination aus pittoreskem Sonnenuntergang und spektakulärer
Brandung.
 Am Montag war immer noch ordentlich Westenwind.
Wir
verordneten den Charterbooten Reff, „Paula“ legte
gemütlich ab und überholte unter Vollzeug. Die Reise
ging nach Brandskär, das der nördlichste Punkt der
Reise werden sollte. Es gab also noch einmal feinstes
Schärensegeln in den engsten Engen und Sunden,
nördlich von Gullholmen offeneres Terrain und
schließlich eine sagenhaft schöne Bucht, in der
„Paula“ nach einigem Hin und Her - nicht haltende
Heckanker und schwedischen Yachten, die im Angesicht der einfallenden
Verrückten mit den Folkebooten noch einmal verholten -
längsseits an den Felsen ging und die anderen Vier ins
Päckchen nahm. Wir lagen zunächst nicht ideal, hatten
einen kleinen Vorsprung übersehen, der am Wasserpass kratzte.
Ganz ohne Spuren gelang das große Abenteuer also nicht.
Am Montag war immer noch ordentlich Westenwind.
Wir
verordneten den Charterbooten Reff, „Paula“ legte
gemütlich ab und überholte unter Vollzeug. Die Reise
ging nach Brandskär, das der nördlichste Punkt der
Reise werden sollte. Es gab also noch einmal feinstes
Schärensegeln in den engsten Engen und Sunden,
nördlich von Gullholmen offeneres Terrain und
schließlich eine sagenhaft schöne Bucht, in der
„Paula“ nach einigem Hin und Her - nicht haltende
Heckanker und schwedischen Yachten, die im Angesicht der einfallenden
Verrückten mit den Folkebooten noch einmal verholten -
längsseits an den Felsen ging und die anderen Vier ins
Päckchen nahm. Wir lagen zunächst nicht ideal, hatten
einen kleinen Vorsprung übersehen, der am Wasserpass kratzte.
Ganz ohne Spuren gelang das große Abenteuer also nicht.
 Bei
mäßigem Südwind galt nun: Wir
müssen mal langsam an den Rückweg denken. Wir
kreuzten also gute zwanzig Meilen, westlich an
Härmanö vorbei und bei Mollösund wieder ins
Innenfahrwasser. In Smögholmarna fanden wir den idealen Platz:
Alle fünf Boote hatten statt Heckanker (hielt auch hier nicht)
eine Achterleine zur anderen Seite der winzigen Bucht.
Übereinstimmende Aussage der Gäste: Das ist bisher
der
schönste Platz! Zu diesem Eindruck trug
auch der hohe, steile Felsen bei, von dem aus man auf vorbeifahrende
Schiffe fast senkrecht von oben blicken konnte.
Bei
mäßigem Südwind galt nun: Wir
müssen mal langsam an den Rückweg denken. Wir
kreuzten also gute zwanzig Meilen, westlich an
Härmanö vorbei und bei Mollösund wieder ins
Innenfahrwasser. In Smögholmarna fanden wir den idealen Platz:
Alle fünf Boote hatten statt Heckanker (hielt auch hier nicht)
eine Achterleine zur anderen Seite der winzigen Bucht.
Übereinstimmende Aussage der Gäste: Das ist bisher
der
schönste Platz! Zu diesem Eindruck trug
auch der hohe, steile Felsen bei, von dem aus man auf vorbeifahrende
Schiffe fast senkrecht von oben blicken konnte.
 Hier verließ
uns das sagenhafte Glück mit dem Wind, der uns bisher so
verlässlich vorangetrieben hatte. Wir mussten
südwärts, doch am Mittwoch wehte ein schwacher
Südost. Es hatte weder Sinn, damit durch die Schären
zu dümpeln, noch den langen Schlag nach Jütland
anzugehen - also blieben wir vor Ort und machten einen Wellnesstag.
Lediglich „Frieda“ legte zweimal ab und besorgte
aus den naheliegenden Häfen zunächst Wasser, dann
Grillgut. Letzteres besorgten wir in Mollösund - eine
dreiköpfige Delegation erlebte die schwedische Version eines
pickepackevollen Hafens, und es gab keine andere Möglichkeit,
als dass „Frieda“ und ich sie an einer der
Tankstellen absetzten und später wieder abholten. Dazwischen
segelten wir den Sund auf und ab und fühlten uns
prächtig dabei, zumal es statt Flaute eine hübsche
Seebrise gab. Als die Drei wieder an der Pier auftauchten, legte ich
trotz Strömung, engem Raum und wuseligem Verkehr routiniert
und gelungen dort an, woraufhin sich ein deutscher Tourist berufen
fühlte, dem schwedischen Tankwart zu erklären:
„He's a very experienced sailor. That was
mustergültig!“
Hier verließ
uns das sagenhafte Glück mit dem Wind, der uns bisher so
verlässlich vorangetrieben hatte. Wir mussten
südwärts, doch am Mittwoch wehte ein schwacher
Südost. Es hatte weder Sinn, damit durch die Schären
zu dümpeln, noch den langen Schlag nach Jütland
anzugehen - also blieben wir vor Ort und machten einen Wellnesstag.
Lediglich „Frieda“ legte zweimal ab und besorgte
aus den naheliegenden Häfen zunächst Wasser, dann
Grillgut. Letzteres besorgten wir in Mollösund - eine
dreiköpfige Delegation erlebte die schwedische Version eines
pickepackevollen Hafens, und es gab keine andere Möglichkeit,
als dass „Frieda“ und ich sie an einer der
Tankstellen absetzten und später wieder abholten. Dazwischen
segelten wir den Sund auf und ab und fühlten uns
prächtig dabei, zumal es statt Flaute eine hübsche
Seebrise gab. Als die Drei wieder an der Pier auftauchten, legte ich
trotz Strömung, engem Raum und wuseligem Verkehr routiniert
und gelungen dort an, woraufhin sich ein deutscher Tourist berufen
fühlte, dem schwedischen Tankwart zu erklären:
„He's a very experienced sailor. That was
mustergültig!“
Damit hatten wir zwar einen running
gag gefunden, doch auf derlei Lob aus zweifelhafter Quelle sollte man
tunlichst nicht zu viel geben. Als wir morgens ausliefen, um die
Schären endgültig hinter uns zu lassen, setzte ich
„Paula“ in einem Anflug von Sorglosigkeit - rumms!
- auf einen mir eigentlich bekannten Unterwasserfelsen. Zum
Glück fuhren wir nur mit zwei Knoten und kamen gleich wieder
frei. But it wasn't mustergültig at all.
 Zuvor
genossen wir einen perfekten Sommerabend mit Grillen. Björn
und ich
mischten uns ein bisschen mehr unters Volk, als wir es bisher getan
hatten - wobei der Eindruck einer hermetischen Trennung falsch
wäre, aber es handelte sich meistens um
Einzelgespräche und dann wieder um die Ansage an die
Gesamtgruppe, wohin die Tagesetappe uns führen sollte und was
dabei navigatorisch zu beachten war.
Zuvor
genossen wir einen perfekten Sommerabend mit Grillen. Björn
und ich
mischten uns ein bisschen mehr unters Volk, als wir es bisher getan
hatten - wobei der Eindruck einer hermetischen Trennung falsch
wäre, aber es handelte sich meistens um
Einzelgespräche und dann wieder um die Ansage an die
Gesamtgruppe, wohin die Tagesetappe uns führen sollte und was
dabei navigatorisch zu beachten war.
 Nach diesem Ruhetag war die
Rutsche übers Kattegat nun, da wir entlang der schwedischen
Küste nicht vorankamen, unaufschiebbar. Nach Skagen
waren es immerhin nur vierzig Meilen offenes Wasser statt der siebzig
auf dem Hinweg, aber der Wind - mit deutlich südlicherem
Einschlag als der versprochene Südost - zwang uns, furchtbar
viel Höhe zu laufen, und bei kaum mehr als drei Beaufort wurde
es mehr als zäh. Wacker segelten wir uns durch Beinaheflauten
und erreichten gegen 21 Uhr den Hafen. Wieder einmal
war es ein beachtlicher Kontrast: Von der Schäre der letzten
beiden
Tage in einen riesigen Industrie- und Fischereihafen nebst
Kreuzfahrtterminal (morgens erwachten wir im Schatten der
„Mein Schiff 4“, die zweifellos die
höchste Erhebung Nordjütlands darstellte). Im
Yachthafen lagen die Boote in Siebenerpäckchen, beim Segelclub
fanden wir neben der Slipbahn fast sensationellerweise noch einen
Platz, an dem „Paula“ mal wieder
längsseits gehen und ihre Schwestern erwarten konnte.
Nach diesem Ruhetag war die
Rutsche übers Kattegat nun, da wir entlang der schwedischen
Küste nicht vorankamen, unaufschiebbar. Nach Skagen
waren es immerhin nur vierzig Meilen offenes Wasser statt der siebzig
auf dem Hinweg, aber der Wind - mit deutlich südlicherem
Einschlag als der versprochene Südost - zwang uns, furchtbar
viel Höhe zu laufen, und bei kaum mehr als drei Beaufort wurde
es mehr als zäh. Wacker segelten wir uns durch Beinaheflauten
und erreichten gegen 21 Uhr den Hafen. Wieder einmal
war es ein beachtlicher Kontrast: Von der Schäre der letzten
beiden
Tage in einen riesigen Industrie- und Fischereihafen nebst
Kreuzfahrtterminal (morgens erwachten wir im Schatten der
„Mein Schiff 4“, die zweifellos die
höchste Erhebung Nordjütlands darstellte). Im
Yachthafen lagen die Boote in Siebenerpäckchen, beim Segelclub
fanden wir neben der Slipbahn fast sensationellerweise noch einen
Platz, an dem „Paula“ mal wieder
längsseits gehen und ihre Schwestern erwarten konnte.
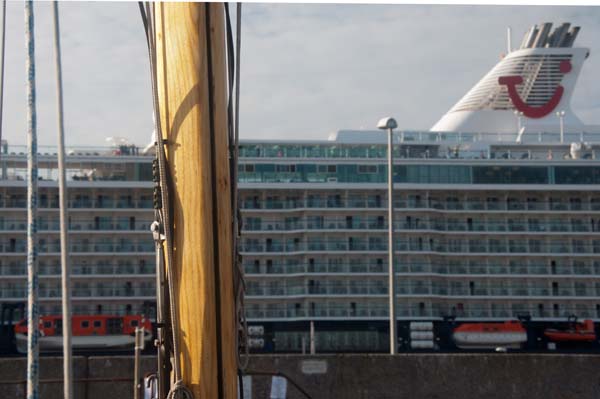 Dank
Björn als Mitsegler war die Rutsche nicht so
ermüdend, wie ich sie einhand empfunden hätte, aber
die Stimmung an Bord war nicht gerade
überschwänglich. Und es lief auch weiterhin nicht: Am
nächsten Tag hatten wir keine andere Wahl, als bei
Süd zwei bis drei Stunde um Stunde gegenan zu motoren, und der
nordlaufende Strom machte das erneut ausgesprochen langwierig - drei
Stunden für die ersten zehn der fast vierzig Meilen waren
nicht gerade prickelnd, und der ungewohnt kleine
Kartenmaßstab - in den Schären segelten wir in einer
Stunde aufs nächste Blatt, nun lag zwischen zwei Wegpunkten
eine halbe Tagesreise - verstärkte das Gefühl, kaum
vom Fleck zu kommen. Über Funk kamen die ersten Meldungen
knapp werdender Benzinvorräte, und auch
„Paulas“ Tank fühlte sich inzwischen
unangenehm leicht an.
Dank
Björn als Mitsegler war die Rutsche nicht so
ermüdend, wie ich sie einhand empfunden hätte, aber
die Stimmung an Bord war nicht gerade
überschwänglich. Und es lief auch weiterhin nicht: Am
nächsten Tag hatten wir keine andere Wahl, als bei
Süd zwei bis drei Stunde um Stunde gegenan zu motoren, und der
nordlaufende Strom machte das erneut ausgesprochen langwierig - drei
Stunden für die ersten zehn der fast vierzig Meilen waren
nicht gerade prickelnd, und der ungewohnt kleine
Kartenmaßstab - in den Schären segelten wir in einer
Stunde aufs nächste Blatt, nun lag zwischen zwei Wegpunkten
eine halbe Tagesreise - verstärkte das Gefühl, kaum
vom Fleck zu kommen. Über Funk kamen die ersten Meldungen
knapp werdender Benzinvorräte, und auch
„Paulas“ Tank fühlte sich inzwischen
unangenehm leicht an.

„Fünf Holzfolkeboote
in Asaa -
das gibt's nur einmal!“
 Südlich von Saeby rundeten wir eine
grüne Tonne und
konnten dreißig Grad abfallen - und hier fanden wir das
Glück wieder: Wir konnten segeln, mit fast fünf
Knoten sogar schneller als alles, was wir unter Motor den ganzen Tag
geschafft hatten. In der Abendsonne liefen wir nach Asaa ein, einem
kleinen Fischer- und Yachthafen zehn Meilen nördlich des
Limfjords, den ich bei meinen zwei bisherigen Besuchen ausgesprochen
liebgewonnen hatte. Man darf sich fragen, was die alle in Skagen wollen
- der gemütliche Hafen war nicht einmal halb voll,
mühelos fanden wir Platz im Fischerbecken, es lockte ein
Sandstrand und eine wunderbar altertümliche
Atmosphäre. Zur Krönung platzten wir mitten ins
Hafenfest, eine Kapelle spielte von einem musealen LKW, der als
Bühne diente, wir genossen kühles Bier vom Fass. Und
wurden natürlich zur heimlichen Sensation.
Südlich von Saeby rundeten wir eine
grüne Tonne und
konnten dreißig Grad abfallen - und hier fanden wir das
Glück wieder: Wir konnten segeln, mit fast fünf
Knoten sogar schneller als alles, was wir unter Motor den ganzen Tag
geschafft hatten. In der Abendsonne liefen wir nach Asaa ein, einem
kleinen Fischer- und Yachthafen zehn Meilen nördlich des
Limfjords, den ich bei meinen zwei bisherigen Besuchen ausgesprochen
liebgewonnen hatte. Man darf sich fragen, was die alle in Skagen wollen
- der gemütliche Hafen war nicht einmal halb voll,
mühelos fanden wir Platz im Fischerbecken, es lockte ein
Sandstrand und eine wunderbar altertümliche
Atmosphäre. Zur Krönung platzten wir mitten ins
Hafenfest, eine Kapelle spielte von einem musealen LKW, der als
Bühne diente, wir genossen kühles Bier vom Fass. Und
wurden natürlich zur heimlichen Sensation.
 Einer der
„Locals“ fand unseren Auftritt so grandios, dass er
dem Hafenmeister sagte: „Fünf Holzfolkeboote in Asaa
- das gibt's nur einmal. Und du musst nett zu den Leuten sein, dann
bleiben sie vielleicht noch eine Nacht.“ Endlich einmal
machte es sich bezahlt, dass ich ein paar Brocken Dänisch
gelernt habe, denn der Hafenmeister sprach keine andere Sprache. Nett
zu uns war er aber allemal, statt dreißig Euro in Skagen
zahlten wir hier nur sieben Euro pro Boot. Gratis-Fahrräder
für den Einkaufsbummel in den Ort und zur Tankstelle wurden
uns morgens auch hingestellt. Ich dankte es mit der
wahrheitsgemäßen Aussage, dies sei der beste Hafen
in Nordjütland. Vielleicht sogar darüber hinaus.
Einer der
„Locals“ fand unseren Auftritt so grandios, dass er
dem Hafenmeister sagte: „Fünf Holzfolkeboote in Asaa
- das gibt's nur einmal. Und du musst nett zu den Leuten sein, dann
bleiben sie vielleicht noch eine Nacht.“ Endlich einmal
machte es sich bezahlt, dass ich ein paar Brocken Dänisch
gelernt habe, denn der Hafenmeister sprach keine andere Sprache. Nett
zu uns war er aber allemal, statt dreißig Euro in Skagen
zahlten wir hier nur sieben Euro pro Boot. Gratis-Fahrräder
für den Einkaufsbummel in den Ort und zur Tankstelle wurden
uns morgens auch hingestellt. Ich dankte es mit der
wahrheitsgemäßen Aussage, dies sei der beste Hafen
in Nordjütland. Vielleicht sogar darüber hinaus.
 Während die Gruppe nach der Kapelle
wieder Gitarren und
Quetschen auspackte und unsere Boote wieder und wieder fotografiert
wurden, erlebten Björn und ich auf dem Molenkopf einen
rasanten Mondaufgang.
Ich war ein bisschen stolz, nicht nur auf meine wunderbaren Boote, die
dies alles möglich machten, sondern auch darauf, wieder einmal
alles - oder doch das Meiste - richtig gemacht zu haben. Spontan
beschloss ich in Absprache mit Björn, angesichts der
samstäglichen Flaute die kraftraubende Fortsetzung der langen
Schläge um einen Tag hinauszuzögern und
tatsächlich bis Sonntag zu bleiben, zumal das beschauliche
Hafenfest nun auch erst richtig in Schwung kommen würde. Dann
aber gab es kein Zögern und Abwarten mehr - es blieben sechs
Tage für immer noch gut zweihundert Seemeilen, und der
allmählich wieder in Gang kommende Wind drohte
beständig aus ungünstiger Richtung zu wehen.
Während die Gruppe nach der Kapelle
wieder Gitarren und
Quetschen auspackte und unsere Boote wieder und wieder fotografiert
wurden, erlebten Björn und ich auf dem Molenkopf einen
rasanten Mondaufgang.
Ich war ein bisschen stolz, nicht nur auf meine wunderbaren Boote, die
dies alles möglich machten, sondern auch darauf, wieder einmal
alles - oder doch das Meiste - richtig gemacht zu haben. Spontan
beschloss ich in Absprache mit Björn, angesichts der
samstäglichen Flaute die kraftraubende Fortsetzung der langen
Schläge um einen Tag hinauszuzögern und
tatsächlich bis Sonntag zu bleiben, zumal das beschauliche
Hafenfest nun auch erst richtig in Schwung kommen würde. Dann
aber gab es kein Zögern und Abwarten mehr - es blieben sechs
Tage für immer noch gut zweihundert Seemeilen, und der
allmählich wieder in Gang kommende Wind drohte
beständig aus ungünstiger Richtung zu wehen.
 Ich rechnete kaum damit, dass wir die geplante
Strecke - 32 Meilen bis Udbyhøj eingangs des Randers Fjordes
- überhaupt schaffen würden. Dass wir sie auch noch
komplett segeln konnten, war ein großes Glück; als
Bonus erlebten wir zuerst die wunderbar-trübe Morgenstimmung
und segelten als letzte Aktion auf einen traumhaften Sonnenuntergang
zu. Damit ist schon gesagt, dass sich das Ganze ziemlich in die
Länge zog, ein Schnitt von unter drei Knoten ist wirklich
nicht toll. Der Hafen selbst ist, nun, eben ein Hafen. Ich fand es
nicht schlimm, dass wir spät ankamen und morgens um acht
gleich wieder ablegten.
Ich rechnete kaum damit, dass wir die geplante
Strecke - 32 Meilen bis Udbyhøj eingangs des Randers Fjordes
- überhaupt schaffen würden. Dass wir sie auch noch
komplett segeln konnten, war ein großes Glück; als
Bonus erlebten wir zuerst die wunderbar-trübe Morgenstimmung
und segelten als letzte Aktion auf einen traumhaften Sonnenuntergang
zu. Damit ist schon gesagt, dass sich das Ganze ziemlich in die
Länge zog, ein Schnitt von unter drei Knoten ist wirklich
nicht toll. Der Hafen selbst ist, nun, eben ein Hafen. Ich fand es
nicht schlimm, dass wir spät ankamen und morgens um acht
gleich wieder ablegten.
Unter den Gästen regte sich aber die
Sorge, dass der Rest der Reise so verlaufen würde: Dass wir
die Tage auf dem Wasser und die Nächte in der Koje verbringen
würden, ohne Gelegenheit, sich auch mal die schönen
Ort, an denen wir anlegten, ansehen zu können. Wir besprachen
das Thema vor dem Ablegen, und die Sorge schien unberechtigt, als wir
mit gut fünf Knoten aus dem Fjord sausten. Der Zwischenstopp
am Randers Fjord war wohlkalkuliert, hatten wir doch nun wieder
Südwind und
konnten bei einem zu laufenden Kurs von hundert Grad ausnahmsweise mal
etwas damit anfangen.
Leider war der Spaß nach zwei Meilen zu
Ende, die erste Flaute begann. Wenn sich später noch einmal
etwas regte - zeitweise gab es mit vier Beaufort sogar richtiges Segeln
- kam es aus Südost. Björn
und ich wählten den Motor, wann immer es nicht voranging, und
„Paula“ brauchte acht Stunden, davon fünf
unter Segeln, für das eigentlich gar nicht so lange
Stück nach, ja, wieder einmal Grenaa. Die Charterer, die eben
noch auf früheres Ankommen am Tagesziel bestanden hatten,
saßen, so weit wir erkennen konnten, jede zweite Flaute aus.
Im diesigen Grau in Grau waren wir bald außer Sicht und
Funkreichweite. Dafür schlüpfte
„Paula“ in ihre von vor drei Wochen vertraute Box.
Wir verbrachten einen schönen Abend an den Grills vorm
Clubhaus, wo wir in anderer Zusammensetzung vor gut zwei Wochen auf den
Ritt übers Kattegat gewartet hatten. In aller Frühe
brachen wir nun südwärts auf mit dem Ziel, gute
fünfzig Meilen zurückzulegen. Es dauerte zwei
Stunden, bis Wind aufkam, und mittags - gerade hatten wir Hjelm
passiert - schlief er auch schon wieder ein. Meine Stimmung erreichte
den tiefsten Tiefpunkt der letzten Jahre. Ich schrieb ins Logbuch, so
einen Törn zu buchen könne man niemandem empfehlen.
Verzweifelt sorgte ich mich um die Gäste - die allerdings,
ohne dass ich es sehen konnte, einigermaßen fröhlich
auf ihren Booten chillten - und darum, ob wir es überhaupt
noch rechtzeitig für die nächsten Buchungen
zurück schaffen würden. Björn wachte auf und
übernahm das Ruder. Ich legte mich in die Koje, ohne dringend
benötigten Schlaf auch zu finden. Was mich wieder an Deck
rief, war die Tatsache, dass wir in der Strömung achteraus
trieben.
 Über Funk gab ich Anweisung, die
Außenborder zu starten und das Alternativziel
Langør anzusteuern. Da segelten die Meisten noch mit
zufriedenstellendem Wind, doch der schlief dann um uns herum
überall ein, kam in Form einer Schauerbö aus
ungünstiger Richtung zurück und pegelte sich
schließlich auf einen Südsüdost ein, der
uns an dieses Ziel brachte, ohne für Ambitionierteres zu
taugen. Ich kam mir so verarscht vor wie selten, als wir am
frühen Nachmittag mit sechs Knoten auf den Hafen zuschossen,
während wir Meilen dringender brauchten als alles Andere. Doch
die Entscheidung erwies sich als richtig: Wir erwischten die
fünf letzten freien Boxen. Hätten es zum
nächsten Hafen Ballen nur mit Mühe geschafft und dort
wahrscheinlich keinen Platz bekommen. Konnten den warmen, sonnigen
Abend an einem wunderschönen, landschaftlich einzigartigen Ort
zu ausgiebigem Landgang und geruhsamem Ausklang nutzen. Und uns
motivieren für die nächste Episode des Abenteuers.
Über Funk gab ich Anweisung, die
Außenborder zu starten und das Alternativziel
Langør anzusteuern. Da segelten die Meisten noch mit
zufriedenstellendem Wind, doch der schlief dann um uns herum
überall ein, kam in Form einer Schauerbö aus
ungünstiger Richtung zurück und pegelte sich
schließlich auf einen Südsüdost ein, der
uns an dieses Ziel brachte, ohne für Ambitionierteres zu
taugen. Ich kam mir so verarscht vor wie selten, als wir am
frühen Nachmittag mit sechs Knoten auf den Hafen zuschossen,
während wir Meilen dringender brauchten als alles Andere. Doch
die Entscheidung erwies sich als richtig: Wir erwischten die
fünf letzten freien Boxen. Hätten es zum
nächsten Hafen Ballen nur mit Mühe geschafft und dort
wahrscheinlich keinen Platz bekommen. Konnten den warmen, sonnigen
Abend an einem wunderschönen, landschaftlich einzigartigen Ort
zu ausgiebigem Landgang und geruhsamem Ausklang nutzen. Und uns
motivieren für die nächste Episode des Abenteuers.

Special Move Time
 „Paula“ legte als Letzte ab.
Björn hatte
sich längst stillschweigend damit abgefunden, dass
„Paula“ nicht anders als einhand gesegelt werden
kann, und dass ich derjenige bin, der die Entscheidungen trifft. Ich
selbst hatte inzwischen begriffen, dass ich aus meiner Haut nicht
herauskonnte. Das funktionierte bestens - Björn formulierte es
später so: Hätten wir zusammen ein Boot gechartert,
wären wir aneinandergeraten. Aber auf
„Paula“, soviel war ihm schon vorher klar, ordnete
er sich unter. Während die Charterboote aus
der von Untiefen durchzogenen Bucht motorten, segelten wir mit
eineinhalb Knoten durch die Morgenstimmung. Björn legte sich
wieder schlafen. „Paula“ und ich warteten an der
letzten Fahrwassertonne auf Wind. Begannen zu kreuzen. Jammerten
über die gegenläufige Strömung, die uns die
Laune verdarb. Ich startete den Motor und gab solange Gas, bis wir
„Oliese“ eingeholt hatten und mit direktem
Kurs auf die Südspitze von Samsø segeln konnten.
Und nun begann der Spaß!
„Paula“ legte als Letzte ab.
Björn hatte
sich längst stillschweigend damit abgefunden, dass
„Paula“ nicht anders als einhand gesegelt werden
kann, und dass ich derjenige bin, der die Entscheidungen trifft. Ich
selbst hatte inzwischen begriffen, dass ich aus meiner Haut nicht
herauskonnte. Das funktionierte bestens - Björn formulierte es
später so: Hätten wir zusammen ein Boot gechartert,
wären wir aneinandergeraten. Aber auf
„Paula“, soviel war ihm schon vorher klar, ordnete
er sich unter. Während die Charterboote aus
der von Untiefen durchzogenen Bucht motorten, segelten wir mit
eineinhalb Knoten durch die Morgenstimmung. Björn legte sich
wieder schlafen. „Paula“ und ich warteten an der
letzten Fahrwassertonne auf Wind. Begannen zu kreuzen. Jammerten
über die gegenläufige Strömung, die uns die
Laune verdarb. Ich startete den Motor und gab solange Gas, bis wir
„Oliese“ eingeholt hatten und mit direktem
Kurs auf die Südspitze von Samsø segeln konnten.
Und nun begann der Spaß!
 Mit Schrick auf den Schoten sausten wir mit
fünfeinhalb Knoten
„Oliese“ davon, näherten uns
„Salty“ und dem Windpark, nahmen Kurs auf
Aebelø. Ich war zufrieden - zum ersten Mal seit drei
Tagen. Und ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie erleichtert und
begeistert die Gäste jetzt waren, als es sich endlich wieder
wie richtiges Segeln anfühlte und die gut
fünfzig Meilen wie ein Katzensprung erschienen. Hin und wieder
spritzte Gischt ins Cockpit und rechtfertigte das Tragen des
Ölzeugs. Irgendwann tauchte Björn wieder auf und
übernahm. Mein dringend benötigter Schlaf litt unter
der Schräglage und der Tatsache, dass nur die luvseitige Koje
zur Verfügung stand - ich musste die Füße
in die andere Koje stecken, um einigermaßen meine Position zu
fixieren, und diese Haltung erinnerte mich an lange
zurückliegende Bahnreisen mir Interrail, während
derer ich zwischen und unter Sitzen schlief.
Mit Schrick auf den Schoten sausten wir mit
fünfeinhalb Knoten
„Oliese“ davon, näherten uns
„Salty“ und dem Windpark, nahmen Kurs auf
Aebelø. Ich war zufrieden - zum ersten Mal seit drei
Tagen. Und ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie erleichtert und
begeistert die Gäste jetzt waren, als es sich endlich wieder
wie richtiges Segeln anfühlte und die gut
fünfzig Meilen wie ein Katzensprung erschienen. Hin und wieder
spritzte Gischt ins Cockpit und rechtfertigte das Tragen des
Ölzeugs. Irgendwann tauchte Björn wieder auf und
übernahm. Mein dringend benötigter Schlaf litt unter
der Schräglage und der Tatsache, dass nur die luvseitige Koje
zur Verfügung stand - ich musste die Füße
in die andere Koje stecken, um einigermaßen meine Position zu
fixieren, und diese Haltung erinnerte mich an lange
zurückliegende Bahnreisen mir Interrail, während
derer ich zwischen und unter Sitzen schlief.
Hinter Aebelø
ging ich wieder ans Ruder - der funktionale Name „Anne
Pinne“ wurde geboren. Als wir uns Fredericia
näherten und in den Trichter einliefen, musste ich
Höhe verschenken und einem Kümo ausweichen, der
seinen Platz auf Reede suchte und dabei beharrlich Schallsignale
aussandte. Sich die Augen reibend krauchte Björn aus der Koje
und fragte: „Haste mir n Wecker gestellt?“ Dann
wurde unsere zügige Fahrt jäh gebremst.
Strömung....! Sie lief uns mit zwei Knoten entgegen, und die
nach Luftlinie kurze Reise in den Yachthafen von Middelfart drohte eine
mühsames, langwieriges Unterfangen zu werden. Es wurde Zeit
für das, was die Gäste später
„special move“ nannten...
 „Salty“ war querab in Lee,
„Oliese“ eine halbe Meile achteraus.
„Martha“ und „Frieda“ segelten
außer Sicht irgendwo voraus, „Martha“ gab
über Funk irgendwelche schlauen Tipps an die Flottille, die
jedoch vollkommen unverständlich blieben. Wir
amüsierten uns darüber und kämpften uns
luvwärts, denn am südlichen Ufer erwartete ich eine
schwächere Strömung. Als wir am Strand beim
Leuchtfeuer Strib gar eine Gegenströmung erwischten und ohne
großen Druck im Segel sechs Knoten über Grund
liefen, war ich begeistert. Die Kante zwischen Strom und Gegenstrom war
in der Folge gut zu erkennen, und es war klar, dass wir an der Biegung
möglichst geradlinig ans gegenüberliegende Ufer
gelangen mussten.
„Salty“ war querab in Lee,
„Oliese“ eine halbe Meile achteraus.
„Martha“ und „Frieda“ segelten
außer Sicht irgendwo voraus, „Martha“ gab
über Funk irgendwelche schlauen Tipps an die Flottille, die
jedoch vollkommen unverständlich blieben. Wir
amüsierten uns darüber und kämpften uns
luvwärts, denn am südlichen Ufer erwartete ich eine
schwächere Strömung. Als wir am Strand beim
Leuchtfeuer Strib gar eine Gegenströmung erwischten und ohne
großen Druck im Segel sechs Knoten über Grund
liefen, war ich begeistert. Die Kante zwischen Strom und Gegenstrom war
in der Folge gut zu erkennen, und es war klar, dass wir an der Biegung
möglichst geradlinig ans gegenüberliegende Ufer
gelangen mussten.
„Paula“ lief sagenhaft viel
Höhe. „Salty“ hinter uns vertrieb beinahe
in den Industriehafen von Fredericia. „Oliese“
staunte, „Martha“ schickte weitere schlaue Tipps.
Am Ufer fanden wir eine ziemlich breite Zone mit mitlaufender
Strömung und ausreichend Wind -
gerade eben schlugen die Segel nicht, doch wir liefen
fünfeinhalb
Knoten. Zwei Holeschläge waren trotzdem nötig,
dann sausten wir unter der Autobahnbrücke hindurch. Und sahen
„Martha“, die gerade stadtseitig in der Abdeckung
verhungerte. An der Eisenbahnbrücke hatten wir sie hinter uns.
Der Yachthafen von Middelfart ist seiner traumhaft schönen,
romantischen Umgebung definitiv nicht würdig. Wir waren
trotzdem froh über einen Liegeplatz nach diesem aufregenden
Tag. Im Besonderen galt das für die
„Oliese“-Crew, denn als im Faenø Sund
der Wind einschlief, startete der abgesoffene Außenborder
nicht. Björn, „Paula“ und ich liefen also
noch einmal aus, um den Havaristen zu schleppen, was allerdings schon
eine kleine Motoryacht tat.
Während ich neben her tuckerte und
darauf wartete, den Schlepp zu übernehmen, ahnte ich nicht,
wie dramatisch es noch einmal werden sollte. Ich wusste
nämlich nicht, dass die Motoryacht von einem
Gebärdensprachler in Begleitung zweier Kinder gesteuert wurde.
Ich wunderte mich also nur, dass zwischen "Oliese"-Crew und Motorboot
offenbar keine Kommunikation stattfand. Dass der Mann sich
überdies nicht im Klaren war, dass ein Folkeboot im Vergleich
zu einem kleinen Motorboot unendlich lange ausläuft, wenn es
einmal richtig in Fahrt ist, sah ich auch nicht kommen. Die Situation
eskalierte, als der Schleppverband unvermittelt und in voller Fahrt die
ersten freien Boxen im Hafen ansteuerte, ohne dass die Schleppleine
gelöst wurde. "Oliese" dreht im letzten Moment ab, die
Schleppleine kam steif, das Motorboot tat einen Satz. Dann war endlich
Ruhe.
 Der
Außenborder startete problemlos, und wir blickten endlich mal
wieder auf einen vollauf gelungenen
Segeltag zurück, der uns so viel Strecke beschert hatte, dass
die Schlei nun in Reichweite lag. Die fehlenden sechzig Meilen
würden wir an den zwei restlichen Tagen auch noch schaffen.
Der
Außenborder startete problemlos, und wir blickten endlich mal
wieder auf einen vollauf gelungenen
Segeltag zurück, der uns so viel Strecke beschert hatte, dass
die Schlei nun in Reichweite lag. Die fehlenden sechzig Meilen
würden wir an den zwei restlichen Tagen auch noch schaffen.
Nach all der Aufregung beteiligten Björn und ich uns
erstmals an der Anlegerzeremonie: Eine Buddel Rum machte die Runde, und
dann wurde die Flottillenflagge weitergereicht. Sie wurde allabendlich
an das Boot verliehen, das sie sich an diesem Tag besonders verdient
hatte. Diesmal fiel diese Ehre "Paula" zu - für die
heldenhafte Rettung "Olieses" und für den "Special Move" in
der Neerströmung, der auf den anderen Booten offenbar
mächtig Eindruck hinterlassen hatte.
 Am nächsten
Abend in Fyns Hav, es war ja der letzte Abend, hätte ich die
entzückenden Gäste allesamt knuddeln und mit der
Flottillenflagge auszeichnen wollen - unendliches
Durchhaltevermögen, durchweg ruhige, bemerkenswert problemlose
Anlegemanöver und die Tatsache, dass alle Boot heil geblieben
waren, waren Grund genug. Doch ich konnte das Tuch ja nicht teilen.
Also gab ich es der "Salty"-Crew, die das geliebte Schiffchen
rehabilitiert hatte: Auf dem Hinweg segelte "Salty" beharrlich am
langsamsten, ohne dass Trimmfehler erkennbar oder andere
Erklärungen zu
finden waren. Jetzt fuhr das gleiche Boot munter vorneweg, weder die
chronisch schnelle "Frieda" noch die schwer beladene "Paula" hatten
eine Chance.
Am nächsten
Abend in Fyns Hav, es war ja der letzte Abend, hätte ich die
entzückenden Gäste allesamt knuddeln und mit der
Flottillenflagge auszeichnen wollen - unendliches
Durchhaltevermögen, durchweg ruhige, bemerkenswert problemlose
Anlegemanöver und die Tatsache, dass alle Boot heil geblieben
waren, waren Grund genug. Doch ich konnte das Tuch ja nicht teilen.
Also gab ich es der "Salty"-Crew, die das geliebte Schiffchen
rehabilitiert hatte: Auf dem Hinweg segelte "Salty" beharrlich am
langsamsten, ohne dass Trimmfehler erkennbar oder andere
Erklärungen zu
finden waren. Jetzt fuhr das gleiche Boot munter vorneweg, weder die
chronisch schnelle "Frieda" noch die schwer beladene "Paula" hatten
eine Chance.
Es wurden noch einmal die Musikinstrumente gestimmt, und
wir trafen Folkeboot "Havfruen" mit Fotograf Michael Müller,
unterwegs im Rahmen eines Fotoprojekts über Folkeboote und die
Menschen an Bord. Nachdem er uns mit dem Auto noch einmal zur
Tankstelle gefahren hatte, dümpelten wir in der morgendlichen
Flaute mit schlaffen Segeln aus dem Hafen und ließen uns
ablichten.
 Der letzte Tag darf ja gerne zum
Abgewöhnen sein,
damit das Absteigen leichter fällt. Wir rechneten nicht mit
Wind, hatten dank Michael genügend Benzin, um die ganze
Strecke zu motoren. Doch kaum hatten wir Mommark passiert, kam eine
wunderbare Brise auf, die bald auf Westsüdwest drehte und uns
für manchen Flautentag entschädigte. "Special Move
Time" war diesmal in Schleimünde, wo "Paula" und "Salty" sich,
anstatt vorm Leuchtturm die Segel zu bergen und den
Außenborder zu starten, bei fünf Beaufort mit drei
Bootslängen Abstand auf eine spannende Kreuz machten. Ich bin
ja schon manches Mal in die Schlei gekreuzt, aber noch nie unter
Regattabedingungen. "Paula" gelang es tatsächlich, ihre
Schwester zu überholen.
Der letzte Tag darf ja gerne zum
Abgewöhnen sein,
damit das Absteigen leichter fällt. Wir rechneten nicht mit
Wind, hatten dank Michael genügend Benzin, um die ganze
Strecke zu motoren. Doch kaum hatten wir Mommark passiert, kam eine
wunderbare Brise auf, die bald auf Westsüdwest drehte und uns
für manchen Flautentag entschädigte. "Special Move
Time" war diesmal in Schleimünde, wo "Paula" und "Salty" sich,
anstatt vorm Leuchtturm die Segel zu bergen und den
Außenborder zu starten, bei fünf Beaufort mit drei
Bootslängen Abstand auf eine spannende Kreuz machten. Ich bin
ja schon manches Mal in die Schlei gekreuzt, aber noch nie unter
Regattabedingungen. "Paula" gelang es tatsächlich, ihre
Schwester zu überholen.
Und dann, pünktlich um 16 Uhr
15, waren alle Boote in Arnis fest. Drei Stunden später
standen schon die ersten neuen Gäste auf dem Steg. Vor uns
stand die schwierige Aufgabe, den Sprung zurück in den Alltag
zu schaffen. Ein bisschen verändert hatten wir uns, kein
Wunder bei so vielen intensiven Erlebnissen in kurzer Folge - und
möge dieser Eindruck lange anhalten.

Persönliches
Fazit
 Mehrere Teilnehmer fragten während der
Reise, wie das Ganze
denn für mich sei - es entging ihnen nicht, dass das, was
für sie Urlaub bedeutete, für mich nicht nur dem
Namen nach eine Dienstreise war. Dabei war die Idee, in dieser Form
eine Schwedenreise anzubieten, keineswegs ohne Eigennutz, und damit
meine ich nicht in erster Linie die Chartergebühr.
Mehrere Teilnehmer fragten während der
Reise, wie das Ganze
denn für mich sei - es entging ihnen nicht, dass das, was
für sie Urlaub bedeutete, für mich nicht nur dem
Namen nach eine Dienstreise war. Dabei war die Idee, in dieser Form
eine Schwedenreise anzubieten, keineswegs ohne Eigennutz, und damit
meine ich nicht in erster Linie die Chartergebühr.
Es war nach
der Rückkehr von „Paulas“ und meiner
letzten Schwedenreise 2012, als ich mich entschloss, meinen bisherigen
Job aufzugeben und den Charterbetrieb zu übernehmen. Die
Hoffnung, irgendwann wieder auf eine größere Reise
gehen zu können, war von Anfang an im Spiel. Zunächst
dachte ich daran, für zwei oder drei Wochenenden eine
Vertretung zu organisieren - doch eine Person mit den entsprechenden
menschlichen, bootsbauerischen, organisatorischen und seglerischen
Kompetenzen zu finden, die gleichzeitig nur so sporadisch Geld
verdient, ist einigermaßen utopisch. Einigermaßen
spontan sprach ich also Charterer und Flottillenteilnehmer auf die Idee
einer Schwedenreise an, und der Törn war relativ schnell
ausgebucht.
 Als leidenschaftlicher Segler war ich bisher
sehr zufrieden
damit, all die schönen Häfen, Ankerplätze
und Orte abklappern zu können, die außerhalb der
Reichweite eines Wochenendtörns liegen und bei
längeren Reisen notgedrungen am Rande der Strecke bleiben.
„Paula“ und ich haben ja immer mal wieder vier,
fünf, sechs Tage Zeit, während die Charterboote
unterwegs sind, und die einwöchigen Flottillentörns
in die Dänische Südsee gewähren uns auch
einen gewissen Auslauf. Vor zwei Jahren verwöhnte
„Paula“ mich damit, dass sie eigenhändig
das Kommando übernahm und mich zwang, mit ihr in sechs Tagen
rund Fünen zu segeln, weil sie wusste, dass ich so gerne mal
wieder nach Korshavn wollte.
Als leidenschaftlicher Segler war ich bisher
sehr zufrieden
damit, all die schönen Häfen, Ankerplätze
und Orte abklappern zu können, die außerhalb der
Reichweite eines Wochenendtörns liegen und bei
längeren Reisen notgedrungen am Rande der Strecke bleiben.
„Paula“ und ich haben ja immer mal wieder vier,
fünf, sechs Tage Zeit, während die Charterboote
unterwegs sind, und die einwöchigen Flottillentörns
in die Dänische Südsee gewähren uns auch
einen gewissen Auslauf. Vor zwei Jahren verwöhnte
„Paula“ mich damit, dass sie eigenhändig
das Kommando übernahm und mich zwang, mit ihr in sechs Tagen
rund Fünen zu segeln, weil sie wusste, dass ich so gerne mal
wieder nach Korshavn wollte.
Nun war es also amtlich, dass wir nach
Göteborg sollten - dorthin hatte die Hinweggruppe gebucht,
dort erwartete uns die Rückwegggruppe.
„Paula“ lag seltsam im Wasser, vorne war ihr
Wasserpass nicht zu sehen, war doch die Vorpiel mit Werkzeug und
Ersatzteilen vollgestopft. Entsprechend gemächlich
wühlte sie sich bisweilen durch die See. Und
natürlich war eine gemeinsame Reise mit den Charterbooten
nicht das Gleiche wie ein schöner Urlaub allein: Auf dem
Hinweg war die „Oliese“-Crew nicht das einzige
Problem, es musste hier und da eine Schraube angezogen, ein Teil
repariert, ein Ausrüstungsgegenstand ersetzt werden. Auf dem
Rückweg war längst nicht nur mein eigenes
Durchhaltevermögen gefragt, sondern auch das der
Gäste, denen ich dennoch so viel Schönes wie
möglich zu bieten hatte, und obendrein hatten wir auch noch
Björn an Bord, den ich als Mitsegler zu akzeptieren
beabsichtigte, nicht als reinen Passagier und keinesfalls als
Störfaktor - war er angesichts meines engen
Verhältnisses zu meinem Boot durchaus hätte sein
können.
 Wenn ich nun sage, „ich mache das
nochmal“, liegt es wesentlich an den mitreisenden Charterern,
die - jede und jeder auf seine und ihre Weise - unersetzlicher Teil des
Ganzen waren. Aber es gab auch ganz persönliche
Gefühle, die einen Törn wie diesen unverzichtbar
machten: Die Begeisterung, die mich umgab, die Dankbarkeit, dieses
Erlebnis ermöglicht zu haben. Die Wertschätzung
dafür, dass ich meine Erfahrung Allen zugute kommen
ließ. Meine geliebten Charterboote in ihrem angestammten
Habitat zu sehen, sich fröhlich in die See stürzend,
anstatt einen gemütlichen Schleitörn zu segeln, war
eine ganz besondere Freude.
Wenn ich nun sage, „ich mache das
nochmal“, liegt es wesentlich an den mitreisenden Charterern,
die - jede und jeder auf seine und ihre Weise - unersetzlicher Teil des
Ganzen waren. Aber es gab auch ganz persönliche
Gefühle, die einen Törn wie diesen unverzichtbar
machten: Die Begeisterung, die mich umgab, die Dankbarkeit, dieses
Erlebnis ermöglicht zu haben. Die Wertschätzung
dafür, dass ich meine Erfahrung Allen zugute kommen
ließ. Meine geliebten Charterboote in ihrem angestammten
Habitat zu sehen, sich fröhlich in die See stürzend,
anstatt einen gemütlichen Schleitörn zu segeln, war
eine ganz besondere Freude.
Vor allem aber gab es Momente, in denen mir
die Tränen in die Augen schossen: Als wir die
Südspitze Samsøs umrundeten und vor uns erstmal die
Weite des Kattegats sahen, die wir in den nächsten Tagen
durchqueren sollten, musste ich wirklich weinen. Vier Jahre hatten wir
darauf verzichtet, und erst hier, als mir das bewusst wurde,
spürte ich, wie sehr wir es vermisst hatten. Als wir dann
„Frieda“ im Kielwasser ließen und nach
siebzig Meilen am Kungsbackafjord die ersten Schären
erreichten, war das wieder so ein rührender Moment.
 Ich sprang und tanzte
über die Felsen, die ich bereits kannte. Erkundete vorsichtig
die neuen. Freute mich darüber, auf Aastol und in Marstrand
sein zu dürfen. Genoss es mit einem gewissen Stolz, dass meine
fünf Boote hier lagen und glückliche Crews an Bord
hatten. Verzweifelte tiefer als die Gäste an den Flautenphasen
des Rückwegs. Atmete um so vernehmlicher auf, als es wieder
voranging. Bedurfte immer wieder „Paulas“
Rückhalt, die nicht nur sagenhaft segelte, sondern auch ihre
fabelhafte Selbstsicherheit ausstrahlte, egal wie es lief. Die mir
ständig zu verstehen gab, dass meine Entscheidungen niemals
absurd falsch, meistens goldrichtig waren. Ich hätte platzen
mögen vor Genugtuung, als wir pünktlich in Arnis
einliefen. Es war wirklich eine außergewöhnliche
Reise, und bestimmt gefiel mir das besser, als endlich mal wieder das
Gleiche zu tun, das ich bereits mehrfach gehabt hatte.
Ich sprang und tanzte
über die Felsen, die ich bereits kannte. Erkundete vorsichtig
die neuen. Freute mich darüber, auf Aastol und in Marstrand
sein zu dürfen. Genoss es mit einem gewissen Stolz, dass meine
fünf Boote hier lagen und glückliche Crews an Bord
hatten. Verzweifelte tiefer als die Gäste an den Flautenphasen
des Rückwegs. Atmete um so vernehmlicher auf, als es wieder
voranging. Bedurfte immer wieder „Paulas“
Rückhalt, die nicht nur sagenhaft segelte, sondern auch ihre
fabelhafte Selbstsicherheit ausstrahlte, egal wie es lief. Die mir
ständig zu verstehen gab, dass meine Entscheidungen niemals
absurd falsch, meistens goldrichtig waren. Ich hätte platzen
mögen vor Genugtuung, als wir pünktlich in Arnis
einliefen. Es war wirklich eine außergewöhnliche
Reise, und bestimmt gefiel mir das besser, als endlich mal wieder das
Gleiche zu tun, das ich bereits mehrfach gehabt hatte.
 Eine neue
Schwedenreise wird also sicher ihren Weg in den Törnplan
finden, mit neuen Gästen und ganz anderen Erlebnissen und
Herausforderungen. Sie kann und wird keine Wiederholung sein, sondern
ein ganz eigenständiges Abenteuer, dessen Verlauf von den
Teilnehmern und der Wetterlage viel mehr bestimmt sein werden als von
meinem eigenen Geschick. Wer mich also fragt, wie es für mich
gewesen ist, wird zu hören bekommen: „Ja, danke
dafür, es war großartig, und nächstes Jahr
will ich da wieder hin.“
Eine neue
Schwedenreise wird also sicher ihren Weg in den Törnplan
finden, mit neuen Gästen und ganz anderen Erlebnissen und
Herausforderungen. Sie kann und wird keine Wiederholung sein, sondern
ein ganz eigenständiges Abenteuer, dessen Verlauf von den
Teilnehmern und der Wetterlage viel mehr bestimmt sein werden als von
meinem eigenen Geschick. Wer mich also fragt, wie es für mich
gewesen ist, wird zu hören bekommen: „Ja, danke
dafür, es war großartig, und nächstes Jahr
will ich da wieder hin.“
weiter: Hin und her in der Dänischen Südsee

