| Paulas Törnberichte | 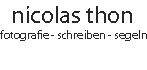 |
|||||
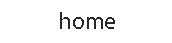 |
 |
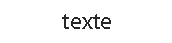 |
 |
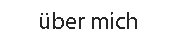 |
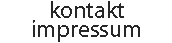
|
|

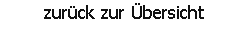
Teeclipper
statt Marstalschoner
Schmutzig-braun gurgelt die Themse unter der Westminster Bridge.
Auflaufend Wasser und bummelig halbe Tide, die Strömung ist
gewaltig. Die Kapitäne der Fähren und Ausflugsdampfer
haben beim Anlegen ihre liebe Not: Erstmal am Ponton vorbei, dann volle
Kraft rückwärts und hoffen, dass der Gehilfe mit dem
Festmacher auf Anhieb den Poller trifft. Ah, klappt erst im dritten
Versuch – ein Knall von Stahl gegen Beton verrät
eine ruppige Landung.
Dezember 2022
 Bei
meinem letzten Besuch in London hatte ich überhaupt noch
keinen Blick für sowas. Ist also schon lange her,
über zehn Jahre. Seitdem habe ich keinen Urlaub mehr gemacht,
außer ein paar Tagen mit Paula. Ich fand, zum
Jubiläum der „Wildgänse“ sei eine
kleine Reise in die große Stadt genau das Richtige. Und es
gibt ja noch viel mehr zu bestaunen als schmutziges Wasser und
gurgelnde Strömung – die überwiegend
asiatischen Touristen wählen als Hintergrund ihrer Selfies die
untergehende Sonne und das Parlamentsgebäude. Inmitten der
Massen fallen zwei Fotografen mit ganz großer
Ausrüstung auf: Stativ, Objektive mit gigantischer Brennweite
– das sind keine ziellos umherflanierenden Touristen. Sie
wirken eher wie professionelle…. womöglich
Plainspotter? Ich folge ihrem Blick zum Himmel. Und ja, was da
majestätisch angeschwebt kommt, ist nichts Geringeres als ein
Airbus A380 der British Airways im Anflug auf Heathrow. Ich tue mein
Bestes, dem Augenblick mit meinem Standardobjektiv gerecht zu werden.
Bei
meinem letzten Besuch in London hatte ich überhaupt noch
keinen Blick für sowas. Ist also schon lange her,
über zehn Jahre. Seitdem habe ich keinen Urlaub mehr gemacht,
außer ein paar Tagen mit Paula. Ich fand, zum
Jubiläum der „Wildgänse“ sei eine
kleine Reise in die große Stadt genau das Richtige. Und es
gibt ja noch viel mehr zu bestaunen als schmutziges Wasser und
gurgelnde Strömung – die überwiegend
asiatischen Touristen wählen als Hintergrund ihrer Selfies die
untergehende Sonne und das Parlamentsgebäude. Inmitten der
Massen fallen zwei Fotografen mit ganz großer
Ausrüstung auf: Stativ, Objektive mit gigantischer Brennweite
– das sind keine ziellos umherflanierenden Touristen. Sie
wirken eher wie professionelle…. womöglich
Plainspotter? Ich folge ihrem Blick zum Himmel. Und ja, was da
majestätisch angeschwebt kommt, ist nichts Geringeres als ein
Airbus A380 der British Airways im Anflug auf Heathrow. Ich tue mein
Bestes, dem Augenblick mit meinem Standardobjektiv gerecht zu werden.
 Mein
eigener Anflug am späten Vormittag war schon ein
herausragendes touristisches Highlight. Von Osten her haben auch wir in
geringer Höhe das gesamte Stadtzentrum überflogen,
wie es der „Super“ gerade tut. Bei wolkenlosem
Himmel ist es ein Genuss, wie die Wolkenkratzerformationen der Isle of
Dogs und der City aus dem Häusermeer ragen. Die Themse, die
Brücken, die Parks und alle wesentlichen
Sehenswürdigkeiten sind dann schonmal abgehakt. Was man aus
der Kabine leider nicht sieht, ist die Myrtle Avenue, jene
Wohnstraße wenige hundert Meter vor dem Aufsetzpunkt von
Runway 27L, wo jetzt bestimmt auch eine ganze Gruppe Plainspotter
lauert.
Mein
eigener Anflug am späten Vormittag war schon ein
herausragendes touristisches Highlight. Von Osten her haben auch wir in
geringer Höhe das gesamte Stadtzentrum überflogen,
wie es der „Super“ gerade tut. Bei wolkenlosem
Himmel ist es ein Genuss, wie die Wolkenkratzerformationen der Isle of
Dogs und der City aus dem Häusermeer ragen. Die Themse, die
Brücken, die Parks und alle wesentlichen
Sehenswürdigkeiten sind dann schonmal abgehakt. Was man aus
der Kabine leider nicht sieht, ist die Myrtle Avenue, jene
Wohnstraße wenige hundert Meter vor dem Aufsetzpunkt von
Runway 27L, wo jetzt bestimmt auch eine ganze Gruppe Plainspotter
lauert.
 Die
Straße ist auch ein Symbol meiner erheblichen Bedenken:
Sollte ich das wirklich machen? Urlaub mitten in der Hauptphase der
Winterarbeit? Fliegen in Zeiten der Klimaveränderung? Halte
ich es überhaupt noch aus in einer Großstadt? Die
Idee eines Kurzurlaubs kam mir schon letzten Winter. Über den
Sommer plante ich ein überschaubares Programm, bestehend aus
Musical, Cutty Sark und einer Fahrt mit der brandneuen Elizabeth Line.
Im Herbst buchte ich Flug, Hotel und Tickets und beantrage - es gab ja
den Brexit - einen neuen Reisepass. Noch einen Tag vor dem
Abflug zweifelte ich, ob ich nicht besser einfach zu Hause bliebe.
Allein schon bei winterlichem Wetter nach Hamburg zum Flughafen zu
fahren, wirkte alles Andere als verlockend.
Die
Straße ist auch ein Symbol meiner erheblichen Bedenken:
Sollte ich das wirklich machen? Urlaub mitten in der Hauptphase der
Winterarbeit? Fliegen in Zeiten der Klimaveränderung? Halte
ich es überhaupt noch aus in einer Großstadt? Die
Idee eines Kurzurlaubs kam mir schon letzten Winter. Über den
Sommer plante ich ein überschaubares Programm, bestehend aus
Musical, Cutty Sark und einer Fahrt mit der brandneuen Elizabeth Line.
Im Herbst buchte ich Flug, Hotel und Tickets und beantrage - es gab ja
den Brexit - einen neuen Reisepass. Noch einen Tag vor dem
Abflug zweifelte ich, ob ich nicht besser einfach zu Hause bliebe.
Allein schon bei winterlichem Wetter nach Hamburg zum Flughafen zu
fahren, wirkte alles Andere als verlockend.
Dass alles gebucht und bezahlt ist und verfallen würde, ist
mir beinahe egal. Den Ausschlag gibt, dass wir
bootsbaumäßig ganz gut in der Zeit liegen, eine
Pause aber meinem Elan und meiner Stimmung sicher nicht schaden
würde. Alle zehn Jahre soll man mal etwas Anderes sehen und
erleben anstelle des immer Gleichen.
 Zwischendurch
wird mir bewusst, worüber ich bisher gar nicht nachgedacht
habe: Als Reiseveranstalter in die Rolle des Touristen zu
schlüpfen, ist ein willkommener Perspektivwechsel. Eine
Segelreise bedeutet für mich ja kaum mehr, als die Kuchenbude
abzubauen, die Leinen zu lösen und mir womöglich erst
dann ein Tagesziel zu überlegen. Meinen
Chartergästen, das wird mir gerade bewusst, geht es vor dem
Segeltörn ähnlich wie mir in Vorbereitung des
Londonaufenthalts: Sie müssen langfristig einen Termin
aussuchen, ihn rechtzeitig buchen, alles Nötige einpacken (der
Adapter für die englischen Steckdosen kam mir im allerletzten
Moment in den Sinn), die Anreise zum Hafen planen, und wenn der in
Dänemark oder Schweden ist, womöglich eine
Fähre buchen und zusehen, dass sie die Abfahrt nicht
verpassen. Das kann mindestens so stressig sein wie eine
frühmorgendliche Fahrt auf der A7 durch zeitweise dichtes
Schneetreiben – wie gut, dass ich so megafrüh
losgefahren bin, über fünf Stunden vorm Abflug, der
sich dann auch noch um eine Dreiviertelstunde verspätet.
Zwischendurch
wird mir bewusst, worüber ich bisher gar nicht nachgedacht
habe: Als Reiseveranstalter in die Rolle des Touristen zu
schlüpfen, ist ein willkommener Perspektivwechsel. Eine
Segelreise bedeutet für mich ja kaum mehr, als die Kuchenbude
abzubauen, die Leinen zu lösen und mir womöglich erst
dann ein Tagesziel zu überlegen. Meinen
Chartergästen, das wird mir gerade bewusst, geht es vor dem
Segeltörn ähnlich wie mir in Vorbereitung des
Londonaufenthalts: Sie müssen langfristig einen Termin
aussuchen, ihn rechtzeitig buchen, alles Nötige einpacken (der
Adapter für die englischen Steckdosen kam mir im allerletzten
Moment in den Sinn), die Anreise zum Hafen planen, und wenn der in
Dänemark oder Schweden ist, womöglich eine
Fähre buchen und zusehen, dass sie die Abfahrt nicht
verpassen. Das kann mindestens so stressig sein wie eine
frühmorgendliche Fahrt auf der A7 durch zeitweise dichtes
Schneetreiben – wie gut, dass ich so megafrüh
losgefahren bin, über fünf Stunden vorm Abflug, der
sich dann auch noch um eine Dreiviertelstunde verspätet.
 Der
Flug war dann großartig: Das Gefühl, beim Start
in den Sitz gedrückt zu werden, habe ich tatsächlich
vermisst. Nach dem Abheben beobachte ich das Einfahren der Klappen, wir
verschwinden kurz in der Wolkendecke, danach gibt es außer
Sonne und leuchtend greller Watte wenig zu sehen – Zeit
für den Mittagsschlaf. Als ich über dem englischen
Kanal aufwache, ist der Himmel fast wolkenlos. Ich betrachte mit
wachsender Begeisterung den dichten Frachterverkehr über den
Themsemündung, die verschneite Landschaft von Essex und
schließlich die ersehnte, gefürchtete
Großstadt aus sicherer Perspektive. Fuhlsbüttel ist
ein vergleichsweise winziger Airport, der überwiegend
Mittelstrecken bedient. Unser unspektakulärer A320
gehört dort zu den größeren Flugzeugen. Auf
dem Taxiway in Heathrow kommen wir an den richtig großen
Verkehrsmaschinen vorbei: Ich sehe zwei A380, zwei Dreamliner, mehrere
777 – willkommen in einer Weltstadt.
Der
Flug war dann großartig: Das Gefühl, beim Start
in den Sitz gedrückt zu werden, habe ich tatsächlich
vermisst. Nach dem Abheben beobachte ich das Einfahren der Klappen, wir
verschwinden kurz in der Wolkendecke, danach gibt es außer
Sonne und leuchtend greller Watte wenig zu sehen – Zeit
für den Mittagsschlaf. Als ich über dem englischen
Kanal aufwache, ist der Himmel fast wolkenlos. Ich betrachte mit
wachsender Begeisterung den dichten Frachterverkehr über den
Themsemündung, die verschneite Landschaft von Essex und
schließlich die ersehnte, gefürchtete
Großstadt aus sicherer Perspektive. Fuhlsbüttel ist
ein vergleichsweise winziger Airport, der überwiegend
Mittelstrecken bedient. Unser unspektakulärer A320
gehört dort zu den größeren Flugzeugen. Auf
dem Taxiway in Heathrow kommen wir an den richtig großen
Verkehrsmaschinen vorbei: Ich sehe zwei A380, zwei Dreamliner, mehrere
777 – willkommen in einer Weltstadt.
 Von
allen Städten, in denen ich nicht gewohnt habe, kenne ich
London am besten – falls man von einer Stadt dieser
Größe überhaupt sagen kann, dass man sie
kennt. Kaum bin ich auf der Straße, entdecke ich gleich etwas
Neues: Es ist hier unüblich, an einer roten
Fußgängerampel zu warten, wenn gar kein Auto kommt.
Zur Orientierung steht an jeder Einmündung und jeder
Verkehrsinsel, in welche Richtung man gucken soll. „Look
left“ und „look right“ kenne ich und
finde es einen guten Service. Die dritte Variante ist naheliegend, aber
sie ist mir bei all den bisherigen Besuchen nirgendwo aufgefallen:
„Look both ways.“
Von
allen Städten, in denen ich nicht gewohnt habe, kenne ich
London am besten – falls man von einer Stadt dieser
Größe überhaupt sagen kann, dass man sie
kennt. Kaum bin ich auf der Straße, entdecke ich gleich etwas
Neues: Es ist hier unüblich, an einer roten
Fußgängerampel zu warten, wenn gar kein Auto kommt.
Zur Orientierung steht an jeder Einmündung und jeder
Verkehrsinsel, in welche Richtung man gucken soll. „Look
left“ und „look right“ kenne ich und
finde es einen guten Service. Die dritte Variante ist naheliegend, aber
sie ist mir bei all den bisherigen Besuchen nirgendwo aufgefallen:
„Look both ways.“
Das Hotel ist klein, gemütlich und günstig gelegen:
Von Bloomsbury ist es eine Viertelstunde zu Fuß zum Theater
im Westend und von dort eine weitere halbe Stunde zur Themse. Den
ersten Nachmittag verbringe ich damit, das auszuprobieren, um mich
morgen gut zurechtzufinden. Ich finde, eine Stadt erschließt
sich am besten zu Fuß (mit der entsprechenden App
könnte ich mir auch ein Fahrrad leihen, aber Temperaturen um
den Gefrierpunkt sind nicht mein bevorzugtes Fahrradwetter). Morgen bin
ich mit einem Stammkunden zum Lunch verabredet, der seit Jahrzehnten in
London wohnt. Abends gehe ich – selten kommt es vor
– ins Theater. Zwischendurch werden es etliche Kilometer
Fußweg bis kurz vor der Erschöpfung, aber das ahne
ich noch nicht.
 Seven
Dials muss zu Charles Dickens Zeiten ein berüchtigtes
Arme-Leute-Viertel gewesen sein, wo die Cholera wütete und es
wenig zu lachen gab. Inzwischen Teil von
„Theatreland“ im Westend, wirkt es jetzt lebhaft
und ausgesprochen interessant. Ausleger für Taljen lassen auf
alte Warenhäuser schließen, in der Markthalle gibt
es exotisches street food aus allen Kontinenten. Der Name des Viertels
stammt von dem kleinen Platz mit sieben abgehenden Straßen
und entsprechend spitzwinkligen Gebäudefronten. Hier befindet
sich auch das Cambridge Theatre, wo seit mittlerweile elf Jahren
durchgehend das vielleicht einzige Musical läuft, das ich mir
jemals ansehen werde: Matilda (nach dem wundervollen Kinderbuch von
Roald Dahl). Drehbuchautor und Songkomponist bekamen damals zu
hören, sie hätten alle Regeln für ein
erfolgreiches Musical gebrochen. Es ist anders als die typischen,
pompösen Produktionen aus dem Hause Disney, und zweifellos
gibt es ein Publikum dafür. Trotzdem wäre ich nie auf
die Idee gekommen – nicht meine Mucke, kein
Rock’n’Roll, und in Hamburg bedeutete eine Wohnung
in der Nähe eines Musicaltheaters hauptsächlich, dass
ich erst nach Ende der Vorstellung wieder einen Parkplatz fand.
Seven
Dials muss zu Charles Dickens Zeiten ein berüchtigtes
Arme-Leute-Viertel gewesen sein, wo die Cholera wütete und es
wenig zu lachen gab. Inzwischen Teil von
„Theatreland“ im Westend, wirkt es jetzt lebhaft
und ausgesprochen interessant. Ausleger für Taljen lassen auf
alte Warenhäuser schließen, in der Markthalle gibt
es exotisches street food aus allen Kontinenten. Der Name des Viertels
stammt von dem kleinen Platz mit sieben abgehenden Straßen
und entsprechend spitzwinkligen Gebäudefronten. Hier befindet
sich auch das Cambridge Theatre, wo seit mittlerweile elf Jahren
durchgehend das vielleicht einzige Musical läuft, das ich mir
jemals ansehen werde: Matilda (nach dem wundervollen Kinderbuch von
Roald Dahl). Drehbuchautor und Songkomponist bekamen damals zu
hören, sie hätten alle Regeln für ein
erfolgreiches Musical gebrochen. Es ist anders als die typischen,
pompösen Produktionen aus dem Hause Disney, und zweifellos
gibt es ein Publikum dafür. Trotzdem wäre ich nie auf
die Idee gekommen – nicht meine Mucke, kein
Rock’n’Roll, und in Hamburg bedeutete eine Wohnung
in der Nähe eines Musicaltheaters hauptsächlich, dass
ich erst nach Ende der Vorstellung wieder einen Parkplatz fand.
 Doch
am
Ende eines besonders anstrengenden Arbeitstages schlug mir YouTube zur
Entspannung einen Auftritt der zehnjährigen Hauptfigur bei
West End Live 2016 vor –
YouTube ist toll, gerade weil der
Algorithmus solche Schlenker ins Profil einbaut. Ich guckte mir das
also an – und war selten so begeistert von etwas, das mich
eben noch kein Stück interessiert hat. Ich las erstmal das
Buch und dann alles, was das Internet über das Musical
hergibt, und fand, die Figur eines lesebegeisterten
fünfjährigen Mädchens, das seine
hoffnungslos ignoranten, fernsehsüchtigen Eltern entsorgt, mit
purer Willenskraft die tyrannische Schulleiterin in die Flucht treibt
und nebenbei der um ihr Erbe betrogenen Klassenlehrerin zu
Gerechtigkeit verhilft, sei genau das Richtige für mich.
Doch
am
Ende eines besonders anstrengenden Arbeitstages schlug mir YouTube zur
Entspannung einen Auftritt der zehnjährigen Hauptfigur bei
West End Live 2016 vor –
YouTube ist toll, gerade weil der
Algorithmus solche Schlenker ins Profil einbaut. Ich guckte mir das
also an – und war selten so begeistert von etwas, das mich
eben noch kein Stück interessiert hat. Ich las erstmal das
Buch und dann alles, was das Internet über das Musical
hergibt, und fand, die Figur eines lesebegeisterten
fünfjährigen Mädchens, das seine
hoffnungslos ignoranten, fernsehsüchtigen Eltern entsorgt, mit
purer Willenskraft die tyrannische Schulleiterin in die Flucht treibt
und nebenbei der um ihr Erbe betrogenen Klassenlehrerin zu
Gerechtigkeit verhilft, sei genau das Richtige für mich.
 Doch
zuvor bin ich ja zum Lunch verabredet, und zwar erneut an der
Themse. Der Weg führt unweigerlich an den ersten bekannten
Sehenswürdigkeiten vorbei. Ich flaniere eine Weile am
Südufer entlang, dann begebe ich mich zum Treffpunkt. Mir ist
nicht ganz klar, dass Jörg sich den ganzen Nachmittag
freigehalten hat für eine Innenstadtführung abseits
der Touristenströme. Es wird ein langer Fußweg kreuz
und quer über den Fluss. Auf verschlungenen Wegen
führt er mich zu Shakespeare’s
Globe (einer Rekonstruktion seines berühmten
Theaters), einem
der ältesten Pubs der City, aber auch dem Kirkaldy Testing
Museum und dem Nachbau von Francis Drakes Schiff Golden Hinde. Als er auch
noch einen Abstecher zum St. Katherine’s Doch machen will,
meutere ich – ich will mich vorm Theater nochmal ausruhen.
Wir gehen also auf halbwegs direktem Weg über Holborn und
Barbican an Charles Dickens Wohnhaus vorbei zurück zum Hotel.
Doch
zuvor bin ich ja zum Lunch verabredet, und zwar erneut an der
Themse. Der Weg führt unweigerlich an den ersten bekannten
Sehenswürdigkeiten vorbei. Ich flaniere eine Weile am
Südufer entlang, dann begebe ich mich zum Treffpunkt. Mir ist
nicht ganz klar, dass Jörg sich den ganzen Nachmittag
freigehalten hat für eine Innenstadtführung abseits
der Touristenströme. Es wird ein langer Fußweg kreuz
und quer über den Fluss. Auf verschlungenen Wegen
führt er mich zu Shakespeare’s
Globe (einer Rekonstruktion seines berühmten
Theaters), einem
der ältesten Pubs der City, aber auch dem Kirkaldy Testing
Museum und dem Nachbau von Francis Drakes Schiff Golden Hinde. Als er auch
noch einen Abstecher zum St. Katherine’s Doch machen will,
meutere ich – ich will mich vorm Theater nochmal ausruhen.
Wir gehen also auf halbwegs direktem Weg über Holborn und
Barbican an Charles Dickens Wohnhaus vorbei zurück zum Hotel.
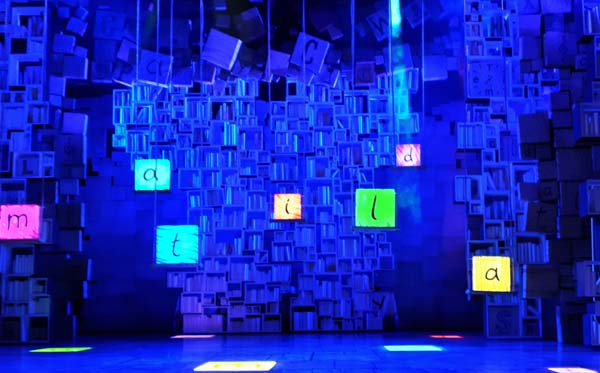 Dickens
passt ausgezeichnet zu meinen weiteren
Plänen: Er gilt als Wegbereiter programmatischer Namen
für seine Charaktere, die beim Leser gleich die richtige
Assoziation hervorrufen. Dahl hat das zweifellos aufgegriffen: In
"Matilda" heißen die Leute sicher nicht zufällig Wormwood, Trunchbull (svw.
Knüppelbulle) oder Bogtrotter
(das ist kaum zu übersetzen, das Internet schlägt
unter Anderem "Breikopp" vor, aber wenn man weiß, dass ein bog ein Moor ist,
umgangssprachlich aber auch Klo bedeutet, und das to trot traben
heißt, trot
aber wiederum umgangssprachlich auch Durchfall heißen kann,
und wenn man weiterhin weiß, dass Bruce Bogtrotter ein
Pummelchen ist, das Miss Trunchbull ein Stück Kuchen klaut und
zur Strafe den kompletten Kuchen bis zum letzten Krümel
aufessen muss - dann ist klar, worum es geht).
Dickens
passt ausgezeichnet zu meinen weiteren
Plänen: Er gilt als Wegbereiter programmatischer Namen
für seine Charaktere, die beim Leser gleich die richtige
Assoziation hervorrufen. Dahl hat das zweifellos aufgegriffen: In
"Matilda" heißen die Leute sicher nicht zufällig Wormwood, Trunchbull (svw.
Knüppelbulle) oder Bogtrotter
(das ist kaum zu übersetzen, das Internet schlägt
unter Anderem "Breikopp" vor, aber wenn man weiß, dass ein bog ein Moor ist,
umgangssprachlich aber auch Klo bedeutet, und das to trot traben
heißt, trot
aber wiederum umgangssprachlich auch Durchfall heißen kann,
und wenn man weiterhin weiß, dass Bruce Bogtrotter ein
Pummelchen ist, das Miss Trunchbull ein Stück Kuchen klaut und
zur Strafe den kompletten Kuchen bis zum letzten Krümel
aufessen muss - dann ist klar, worum es geht).
 Und
so sitze ich erwartungsvoll im Theater. Mein Platz ist bewusst
gewählt: vierte Reihe direkt am Mittelgang. In
Augenhöhe mit der Bühne. Bei „When I grow
up“ werden die Schaukeln über mir ausschwingen. Bei
„Revolting Children“ habe ich vielleicht die
Chance, eines der Papierflugzeuge zu fangen, die die Kinder ins
Publikum werfen. Doch erstmal lasse ich die Atmosphäre auf
mich wirken. Das ganze Gebäude ist so eng, wie es von
außen betrachtet zu erwarten war. Die Bühne ist
liebevoll gestaltet, die Technik faszinierend: Im Laufe der Vorstellung
fahren die Pulte der Schüler aus dem Boden, das elterliche
Badezimmer klappt hoch, andere Kulissen schweben von der Decke oder
fahren an Laufkatzen von der Seite ins Bild. Was sonst noch an
Turngeräten und Mobiliar benötigt wird, rollern die
Schauspieler eilig auf die Bühne und später aus dem
Weg.
Und
so sitze ich erwartungsvoll im Theater. Mein Platz ist bewusst
gewählt: vierte Reihe direkt am Mittelgang. In
Augenhöhe mit der Bühne. Bei „When I grow
up“ werden die Schaukeln über mir ausschwingen. Bei
„Revolting Children“ habe ich vielleicht die
Chance, eines der Papierflugzeuge zu fangen, die die Kinder ins
Publikum werfen. Doch erstmal lasse ich die Atmosphäre auf
mich wirken. Das ganze Gebäude ist so eng, wie es von
außen betrachtet zu erwarten war. Die Bühne ist
liebevoll gestaltet, die Technik faszinierend: Im Laufe der Vorstellung
fahren die Pulte der Schüler aus dem Boden, das elterliche
Badezimmer klappt hoch, andere Kulissen schweben von der Decke oder
fahren an Laufkatzen von der Seite ins Bild. Was sonst noch an
Turngeräten und Mobiliar benötigt wird, rollern die
Schauspieler eilig auf die Bühne und später aus dem
Weg.
 Das
Stück beginnt schillernd-bunt und etwas langatmig. Dann
betritt Matilda erstmals die Bühne, heute gespielt von Heidi
Williams. Die Rolle teilen sich immer vier Mädchen um die zehn
Jahre. Beim Casting ist die Körpergröße
wichtig – die Darstellerinnen sind immer nur einen
Wachstumsschub entfernt von dem Moment, ab dem sie nicht mehr
glaubwürdig die Rolle einer erst
Fünfjährigen spielen können. Es ist eine
ernste Rolle: Wenn sie auf der Bühne stehen, auch bei den
Proben, dürfen die Mädchen nicht lachen. Heidi wirkt
tatsächlich geradezu winzig und verwundbar – der
Saal füllt sich mit Persönlichkeit.
Das
Stück beginnt schillernd-bunt und etwas langatmig. Dann
betritt Matilda erstmals die Bühne, heute gespielt von Heidi
Williams. Die Rolle teilen sich immer vier Mädchen um die zehn
Jahre. Beim Casting ist die Körpergröße
wichtig – die Darstellerinnen sind immer nur einen
Wachstumsschub entfernt von dem Moment, ab dem sie nicht mehr
glaubwürdig die Rolle einer erst
Fünfjährigen spielen können. Es ist eine
ernste Rolle: Wenn sie auf der Bühne stehen, auch bei den
Proben, dürfen die Mädchen nicht lachen. Heidi wirkt
tatsächlich geradezu winzig und verwundbar – der
Saal füllt sich mit Persönlichkeit.
 Matilda
the Musical wurde gerade für Netflix verfilmt und
läuft vorab in den Kinos – wo ich schon dabei bin,
gehe ich am nächsten Nachmittag auch noch in eine Vorstellung
am Leicester Square. Im Theater werde ich trotz hoher Erwartungen nicht
enttäuscht. Ich stelle aber fest, dass ich zu gut vorbereitet
bin: Der einzige Teil der Handlung, den ich noch nicht auswendig kann
– die tragische Geschichte des
Entfesselungskünstlers und der Akrobatin, die Matilda der
Bibliothekarin erzählt, ohne zu ahnen, dass es die Geschichte
ihrer Lehrerin ist – fesselt mich am meisten. Ansonsten bin
ich vielleicht zu sehr hin und hergerissen zwischen der Handlung und
ihrer Darbietung. Oder mir liegt gewohnheitsbedingt Kino näher
als Theater – auf jeden Fall schafft der Film, was dem
Theater misslingt: Mich zu Tränen zu rühren.
Matilda
the Musical wurde gerade für Netflix verfilmt und
läuft vorab in den Kinos – wo ich schon dabei bin,
gehe ich am nächsten Nachmittag auch noch in eine Vorstellung
am Leicester Square. Im Theater werde ich trotz hoher Erwartungen nicht
enttäuscht. Ich stelle aber fest, dass ich zu gut vorbereitet
bin: Der einzige Teil der Handlung, den ich noch nicht auswendig kann
– die tragische Geschichte des
Entfesselungskünstlers und der Akrobatin, die Matilda der
Bibliothekarin erzählt, ohne zu ahnen, dass es die Geschichte
ihrer Lehrerin ist – fesselt mich am meisten. Ansonsten bin
ich vielleicht zu sehr hin und hergerissen zwischen der Handlung und
ihrer Darbietung. Oder mir liegt gewohnheitsbedingt Kino näher
als Theater – auf jeden Fall schafft der Film, was dem
Theater misslingt: Mich zu Tränen zu rühren.
 Kontrastprogramm
am Sonntag: In London sind nicht nur die Flugzeuge
eine Nummer größer. Teeclipper statt Marstalschoner:
Cutty Sark ist einer der wenigen erhaltenen, letztgebauten und
schnellsten ihrer Art. Die Aufgabe, Tee aus Indien und China nach
London zu bringen, erfüllte sie nur wenige Jahre –
mit dem Bau des Suezkanals hatten Dampfschiffe einen zu deutlichen
Zeitvorteil. Sie fuhr dann mit Wolle und Kohle zwischen England und
Australien, wurde nach Portugal verkauft und kam als Segelschulschiff
zurück nach England. Seit 1954 steht sie als Museumsschiff in
ihrem Trockendock in Greenwich.
Kontrastprogramm
am Sonntag: In London sind nicht nur die Flugzeuge
eine Nummer größer. Teeclipper statt Marstalschoner:
Cutty Sark ist einer der wenigen erhaltenen, letztgebauten und
schnellsten ihrer Art. Die Aufgabe, Tee aus Indien und China nach
London zu bringen, erfüllte sie nur wenige Jahre –
mit dem Bau des Suezkanals hatten Dampfschiffe einen zu deutlichen
Zeitvorteil. Sie fuhr dann mit Wolle und Kohle zwischen England und
Australien, wurde nach Portugal verkauft und kam als Segelschulschiff
zurück nach England. Seit 1954 steht sie als Museumsschiff in
ihrem Trockendock in Greenwich.
 Bei
meinem letzten London-Aufenthalt wurde sie gerade restauriert,
wobei auch noch unter Deck ein Feuer ausbrach – seitdem
wollte ich gerne diese Bildungslücke schließen. Die
Restaurierung wurde notwendig, weil nach den Jahrzehnten an Land, mit
dem vollen Gewicht auf dem Kiel stehend, die rostigen Bodenwrangen und
Spanten nachgaben. Cutty Sark ging aus der Form, wurde bauchig wie ein
Marstalschoner oder Fischkutter, und dabei ist neben der sportlichen
Beseglung der schlanke Rumpf doch gerade der Clou eines Clippers und
Grund seiner enormen Schnelligkeit. Cutty Sarks Rumpf wird jetzt von
diagonalen Streben gestützt, der Kiel hängt in der
Luft. In der Ausstellung hängt ein Foto von der feierlichen
Wiedereröffnung mit Würdenträgern aus
Wirtschaft, Politik und Königshaus. Die Leute sitzen in ihren
feinen Klamotten an einem langen Bankett direkt unter dem Schiff.
Bei
meinem letzten London-Aufenthalt wurde sie gerade restauriert,
wobei auch noch unter Deck ein Feuer ausbrach – seitdem
wollte ich gerne diese Bildungslücke schließen. Die
Restaurierung wurde notwendig, weil nach den Jahrzehnten an Land, mit
dem vollen Gewicht auf dem Kiel stehend, die rostigen Bodenwrangen und
Spanten nachgaben. Cutty Sark ging aus der Form, wurde bauchig wie ein
Marstalschoner oder Fischkutter, und dabei ist neben der sportlichen
Beseglung der schlanke Rumpf doch gerade der Clou eines Clippers und
Grund seiner enormen Schnelligkeit. Cutty Sarks Rumpf wird jetzt von
diagonalen Streben gestützt, der Kiel hängt in der
Luft. In der Ausstellung hängt ein Foto von der feierlichen
Wiedereröffnung mit Würdenträgern aus
Wirtschaft, Politik und Königshaus. Die Leute sitzen in ihren
feinen Klamotten an einem langen Bankett direkt unter dem Schiff.
 Jetzt
laufe auch ich unbefangen unter dem gewaltigen Rumpf herum und
bin angemessen beeindruckt. Laderaum, Salon, Kabinen und Aufbauten sind
liebevoll so hergerichtet, wie es damals auf den weiten Reisen hier
ausgesehen haben muss. Das haben die wirklich hübsch gemacht,
man bekommt einen lebhaften Eindruck. An Deck ist das Rumlaufen ein
wenig eingeschränkt: Leichter Regen fällt auf das Eis
und den Schnee der vergangenen Tage.
Jetzt
laufe auch ich unbefangen unter dem gewaltigen Rumpf herum und
bin angemessen beeindruckt. Laderaum, Salon, Kabinen und Aufbauten sind
liebevoll so hergerichtet, wie es damals auf den weiten Reisen hier
ausgesehen haben muss. Das haben die wirklich hübsch gemacht,
man bekommt einen lebhaften Eindruck. An Deck ist das Rumlaufen ein
wenig eingeschränkt: Leichter Regen fällt auf das Eis
und den Schnee der vergangenen Tage.
 Auf
dem Weg nach Greenwich fahre ich mit der im Sommer
eröffneten Elizabeth Line. Vom Flughafen zum Hotel scheiterte
das daran, dass sie wegen des Streiks Terminal 5 nicht bediente. Zur
Wahl standen die Piccadilly Line, die zum Westend fast eine Stunde
braucht, und der Heathrow Express, der für stolze
dreißig Euro in einer Viertelstunde nach Paddington
fährt. Immerhin nimmt er die gleiche oberirdische Strecke wie
die Elizabeth Line, allerdings ohne Zwischenhalt. Das Londoner
U-Bahn-Netz stammt größtenteils aus dem 19.
Jahrhundert. Wer die Tube kennt, denkt an stickige Luft, enge, kurvige,
verwinkelte Gänge, viel zu schmale Bahnsteige und den
ständigen Sicherheitshinweis „mind the
gap“. Dafür haben viele Details der Stationen den
Krieg und die Modernisierung überdauert und wirken jetzt
liebevoll-altbacken. Die Elizabeth Line ist vollkommen anders: Hell,
großzügig und ultramodern. In der rush hour mag es
anders aussehen – am Sonntagvormittag habe ich den Eindruck,
diesen Tempel beinahe allein zum Gebet zu betreten.
Auf
dem Weg nach Greenwich fahre ich mit der im Sommer
eröffneten Elizabeth Line. Vom Flughafen zum Hotel scheiterte
das daran, dass sie wegen des Streiks Terminal 5 nicht bediente. Zur
Wahl standen die Piccadilly Line, die zum Westend fast eine Stunde
braucht, und der Heathrow Express, der für stolze
dreißig Euro in einer Viertelstunde nach Paddington
fährt. Immerhin nimmt er die gleiche oberirdische Strecke wie
die Elizabeth Line, allerdings ohne Zwischenhalt. Das Londoner
U-Bahn-Netz stammt größtenteils aus dem 19.
Jahrhundert. Wer die Tube kennt, denkt an stickige Luft, enge, kurvige,
verwinkelte Gänge, viel zu schmale Bahnsteige und den
ständigen Sicherheitshinweis „mind the
gap“. Dafür haben viele Details der Stationen den
Krieg und die Modernisierung überdauert und wirken jetzt
liebevoll-altbacken. Die Elizabeth Line ist vollkommen anders: Hell,
großzügig und ultramodern. In der rush hour mag es
anders aussehen – am Sonntagvormittag habe ich den Eindruck,
diesen Tempel beinahe allein zum Gebet zu betreten.
 Für
den Rückweg nach Heathrow – gestreikt
wird erst Heiligabend wieder - rechne ich die verschiedenen
Möglichkeiten ein bisschen genauer durch: Heathrow Express?
Elizabeth Line? Wenn ich Fußwege und Umstiege einkalkuliere,
ist die Piccadilly Line ab Russell Square tatsächlich die bei
weitem schnellste Variante.
Für
den Rückweg nach Heathrow – gestreikt
wird erst Heiligabend wieder - rechne ich die verschiedenen
Möglichkeiten ein bisschen genauer durch: Heathrow Express?
Elizabeth Line? Wenn ich Fußwege und Umstiege einkalkuliere,
ist die Piccadilly Line ab Russell Square tatsächlich die bei
weitem schnellste Variante.
Zwischen Cutty Sark und Kino treibt mich der Hunger in einen Pub ums
Eck vom Hotel: Sonntag ist traditioneller Bratentag. Der ultimative
Klassiker - Lammbraten mit Minzsoße und Yorkshire Pudding
– reizt mich, aber er überzeugt mich nicht: Ich
bestelle Fish’n’Chips. Zurück zu Hause
beschleicht mich das Gefühl: Ich muss unbedingt
nochmal dahin.
weiter: Der
Seeerfolgsvogel
zurück:
Spielend Folkeboot segeln

