| Paulas Törnberichte | 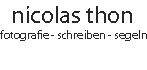 |
|||||
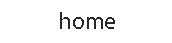 |
 |
 |
 |
 |

|
|
|
|
||||||

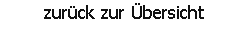
"Ich hab mich nicht eine Sekunde unsicher
gefühlt" - Ein wildes Abenteuer, Teil eins
Die Sommerreise beginnt mit einem Paket. Die
Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Boote segelklar. Paula liegt
tief im Wasser, bestückt mit Reservesegeln,
Ersatzaußenborder, Werkzeug und Proviant. Ich habe mir
– die Reise verspricht aufregend und spannend, aber auch
anstrengend zu werden – eine Mittagsstunde gegönnt.
Wenig erholt von wirren Träumen, rappele ich mich aus der Koje
und blinzele gegen die Nachmittagssonne. Auf der Kranplatte steht auf
einer Palette dieser riesige Karton.
Juli 2018
 Er
kommt mir eigentümlich vertraut vor. Wo könnte ich
ihn
schonmal gesehen haben? Ah, richtig, auf einem Foto: Peter, eine
Hälfte der mit der Bahn anreisenden Oliese-Crew, hat es mir
gemailt, damit ich es gleich wiedererkenne, wenn seine
persönliche
Ausrüstung und der komplette Proviant eintreffen. Das
Mobiltelefon
meldet bereits eine Vielzahl zunehmend nervöser Nachfragen: Ob
das
Paket endlich angekommen sei. Ob es auch sicher das richtige Paket sei.
Und so weiter.
Er
kommt mir eigentümlich vertraut vor. Wo könnte ich
ihn
schonmal gesehen haben? Ah, richtig, auf einem Foto: Peter, eine
Hälfte der mit der Bahn anreisenden Oliese-Crew, hat es mir
gemailt, damit ich es gleich wiedererkenne, wenn seine
persönliche
Ausrüstung und der komplette Proviant eintreffen. Das
Mobiltelefon
meldet bereits eine Vielzahl zunehmend nervöser Nachfragen: Ob
das
Paket endlich angekommen sei. Ob es auch sicher das richtige Paket sei.
Und so weiter.
Ich trenne das Klebeband auf und werfe einen Blick ins Innere. In der
Wärme schwitzen unter Anderem bergeweise Kekspackungen und
Milchtüten. Peter muss jetzt noch ein bisschen warten auf die
ersehnte Empfangsbestätigung – erstmal muss das Zeug
aus der
Sonne. Ich hole Oliese an die Kranpier. Schlure den schweren Karton an
den Liegeplatz, was nur mit der Hilfe eines freundlichen Nachbarn
gelingt. Fange an, den Paketinhalt in die Kojen umzuladen.
Als das Schwerste raus ist, gelingt es mir, den Karton auf die Seite zu
kippen. Nun kann ich vom Cockpit aus reingreifen, anstatt jedes Mal an
Land zu klettern. Es ist tückisch: „Halt! Oh nein!
Das
Dosenbier!“ Reaktionsschnell fange ich alles auf, was mir
entgegenrollt. Interessant finde ich die kleinen Plastiktüten
mit
einem braunen Pulver, das eine Backmischung sein könnte, nur
dass
nichts von Dr. Oetker zu lesen ist. Die ersten Schaulustigen erkundigen
sich neugierig, was ich da mache, und werfen schmunzelnd einen Blick in
den Karton. „Das gehört jetzt bei uns zum
Service“,
brummele ich schwitzend. Nach einer Stunde liegt Oli wieder in ihrer
Box, Karton und Palette warten im vorher schon vollen Auto auf die
Fahrt zum Recyclinghof, und ich schreibe Peter eine Mail:
„Das
Paket ist da. Und auch schon wieder weg. Dazwischen habe ich den Inhalt
an Bord gepackt.“
 Freitagabend.
Eben sind die letzten Gäste eingetroffen, nun essen wir
gemeinsam
bei Specht’s zu Abend: Vier einander bisher fremde Crews, die
– so viel ist sicher – morgen oder
übermorgen bereits
den Eindruck erwecken werden, sie segelten schon ewig gemeinsam.
Ansonsten scheint gar nichts sicher: Die Vorfreude ist gewaltig, die
Erwartungen sind hoch, aber diffus, die Nervosität ist
spürbar. Wer gedacht hat, bei Windstärke 5-6
würden wir
gar nicht erst auslaufen, hat sich getäuscht:
„Lieber
wäre ich bei halbem Wind 3-4 gemütlich das kleine
Stück
bis Marstal gesegelt, um am Sonntag richtig durchzustarten. Aber
Sonntag ist Flaute, Montag Starkwind, da sind knapp dreißig
Meilen am ersten Tag nicht genug." An Segelerfahrung mangelt es nicht -
Ernst war bei der Schwedenreise vor zwei Jahren schon dabei,
und
außer seinem Vorschoter Peter sind alle schon Folkeboot
gesegelt.
Trotzdem müssen sie sich erst "einsegeln", da ist der pustige
Beginn wenig hilfreich. Oder doch? Wenn die Segel erstmal stehen,
erwarte ich keine gravierenden Schwierigkeiten, und danach wird
die Gäste während der restlichen Reise nichts mehr
schocken
können.
Freitagabend.
Eben sind die letzten Gäste eingetroffen, nun essen wir
gemeinsam
bei Specht’s zu Abend: Vier einander bisher fremde Crews, die
– so viel ist sicher – morgen oder
übermorgen bereits
den Eindruck erwecken werden, sie segelten schon ewig gemeinsam.
Ansonsten scheint gar nichts sicher: Die Vorfreude ist gewaltig, die
Erwartungen sind hoch, aber diffus, die Nervosität ist
spürbar. Wer gedacht hat, bei Windstärke 5-6
würden wir
gar nicht erst auslaufen, hat sich getäuscht:
„Lieber
wäre ich bei halbem Wind 3-4 gemütlich das kleine
Stück
bis Marstal gesegelt, um am Sonntag richtig durchzustarten. Aber
Sonntag ist Flaute, Montag Starkwind, da sind knapp dreißig
Meilen am ersten Tag nicht genug." An Segelerfahrung mangelt es nicht -
Ernst war bei der Schwedenreise vor zwei Jahren schon dabei,
und
außer seinem Vorschoter Peter sind alle schon Folkeboot
gesegelt.
Trotzdem müssen sie sich erst "einsegeln", da ist der pustige
Beginn wenig hilfreich. Oder doch? Wenn die Segel erstmal stehen,
erwarte ich keine gravierenden Schwierigkeiten, und danach wird
die Gäste während der restlichen Reise nichts mehr
schocken
können.
Einzig Martha hat ein Problem: Zuerst findet die Einweisung
notgedrungen in der Dunkelheit statt. Dann erweist sich die Schiene,
die Marthas
Baum
am Mast hält, als zu schwach ausgeführt. Zwei Saisons
lang
ging das gut, jetzt ist sie auseinandergebogen und spuckt gelegentlich
den Lümmelbeschlag aus. Das unerwartete
Ärgernis hat ausgerechnet beim ersten
Segelsetzen dieser langen Reise seine Premiere.
Als wir die Schlei verlassen, funktioniert vorerst alles einwandfrei,
und wir segeln raumschots nach Marstal, kreuzen durch die enge Rinne,
lassen den Hafen links liegen und sausen mit Rauschefahrt weiter. Am
frühen Abend fällt Paulas Anker nach ordentlichen 42
Seemeilen in der Lunke Bugt. Die Anderen legen sich ins
Päckchen,
nach und nach bringen wir ihre Anker aus – wir bauen unsere
eigene Insel. Auf Oliese müssen wir zwei Stündchen
warten
– eine vermasselte Wende vor Marstal genügte, damit
die Crew
dort auf Schlepphilfe warten musste, um wieder frei zu kommen.
 Diese
Verzögerung hält Peter aber nicht davon ab, das
Geheimnis der
keinen Plastiktüten zu lüften: Der gelernte Koch
reicht zur
Nachspeise frisch gebackenen Rotweinkuchen von Boot zu Boot. Nicht nur
deswegen ist die Stimmung prächtig: Der erste Tag war schon
ein
ausgewachsenes, kontrastreiches Abenteuer. Wir haben gut Strecke
geschafft. Und ich bin über den vielen Wind gar nicht mehr so
böse – nach diesem Auftakt ist der Alltag aus den
Köpfen, und nichts wird die Gäste mehr schocken
können.
Diese
Verzögerung hält Peter aber nicht davon ab, das
Geheimnis der
keinen Plastiktüten zu lüften: Der gelernte Koch
reicht zur
Nachspeise frisch gebackenen Rotweinkuchen von Boot zu Boot. Nicht nur
deswegen ist die Stimmung prächtig: Der erste Tag war schon
ein
ausgewachsenes, kontrastreiches Abenteuer. Wir haben gut Strecke
geschafft. Und ich bin über den vielen Wind gar nicht mehr so
böse – nach diesem Auftakt ist der Alltag aus den
Köpfen, und nichts wird die Gäste mehr schocken
können.
Auch nicht die fünfzig Meilen von Lundeborg nach
Sejerø an
Tag drei– ungerefft hoch am Wind bei zeitweise 6-7. Der Tag
hat
es in sich: Das Monstrum Großer-Belt-Brücke
wäre
beinahe schon Nervenkitzel genug. Gegen Wind und Strömung
haben
wir den Vorteil, dass wir in die Abdeckung und Turbulenzen der
Brückenpfeiler geraten, bevor wir die Durchfahrt erreichen. Es
ist
also Platz für eine Wende, es wäre auch Platz,
abzudrehen und
einen zweiten Anlauf zu unternehmen oder den Motor zu Hilfe zu nehmen.
Ist aber nicht nötig.
 Nördlich
der Brücke weht eine ausgewachsene 5, aber es rollt uns eine
wirklich unangenehme See frontal entgegen. Es handelt sich unverkennbar
um eine Dünung von weiter nördlich, wo der Wind
stärker
ist und erst noch auf West drehen muss. Die Welle lässt sich
nicht
aussteuern, Paulas Bug kracht wieder und wieder unsanft ins Wellental.
Eine gute Stunde geht das so, dann brist es auf, was sich mit
Gegenbauch im Groß und unter Akzeptanz des einen oder anderen
Schluck Wasser über die Kante gut aushalten lässt,
und die
Welle fällt nun passend zum Wind seitlich ein. Und wie
erwartet
hat sich der Wind, als wir den Großen Belt verlassen und auf
Ostkurs gehen, weitgehend ausgetobt. Friedlich und ruhig segeln wir in
den geräumigen Inselhafen.
Nördlich
der Brücke weht eine ausgewachsene 5, aber es rollt uns eine
wirklich unangenehme See frontal entgegen. Es handelt sich unverkennbar
um eine Dünung von weiter nördlich, wo der Wind
stärker
ist und erst noch auf West drehen muss. Die Welle lässt sich
nicht
aussteuern, Paulas Bug kracht wieder und wieder unsanft ins Wellental.
Eine gute Stunde geht das so, dann brist es auf, was sich mit
Gegenbauch im Groß und unter Akzeptanz des einen oder anderen
Schluck Wasser über die Kante gut aushalten lässt,
und die
Welle fällt nun passend zum Wind seitlich ein. Und wie
erwartet
hat sich der Wind, als wir den Großen Belt verlassen und auf
Ostkurs gehen, weitgehend ausgetobt. Friedlich und ruhig segeln wir in
den geräumigen Inselhafen.
 Zwar
machen mich die widersprüchlichen schlauen Tipps anderer
Hafenlieger fast wahnsinnig, bis klar ist, dass wir im leeren
Fischerhafen tatsächlich liegen dürfen. Zwar
scheitert der
Versuch, Frieda unter Segeln anzulegen, wieder und wieder daran, dass
der Aufschießer in der Abdeckung der Außenmole
misslingt
und ich das viel zu schnelle Boot zu einem erneuten Versuch wegschicke.
Zwar kommt Paula beim Verholen von dort zur Fischerpier –
unter
Fock, ich fange doch auf die letzten fünfzig Meter nicht an zu
motoren – beinahe Salty in die Quere. Doch ich rege mich
nicht
auf, sondern beauftrage sie, Oliese freizuschleppen, die beim Warten
zuerst mit schlagenden Segeln der ablegenden Fähre im Weg
stand
und dann im Vorhafen schon wieder in den Schlick geraten ist. Zwar
verlangt Martha nun danach, die blöde Schiene abzumontieren,
sie
mit Schraubzwingen, so gut es geht, zusammen zu biegen und zu hoffen,
dass sie danach für den Rest der Reise keinen Ärger
mehr
macht. Zwar haben alle lahme Arme vom Ruderdruck und auch sonst
erschöpfte Glieder von der erheblichen Mühsal, sich
bei
vierzig Grad Schräglage und fast zwei Metern Welle
einigermaßen in Position zu halten. Zwar ist einiges an
Seekarten
und Kojenpolstern mehr als nur ein bisschen nass geworden.
Zwar
machen mich die widersprüchlichen schlauen Tipps anderer
Hafenlieger fast wahnsinnig, bis klar ist, dass wir im leeren
Fischerhafen tatsächlich liegen dürfen. Zwar
scheitert der
Versuch, Frieda unter Segeln anzulegen, wieder und wieder daran, dass
der Aufschießer in der Abdeckung der Außenmole
misslingt
und ich das viel zu schnelle Boot zu einem erneuten Versuch wegschicke.
Zwar kommt Paula beim Verholen von dort zur Fischerpier –
unter
Fock, ich fange doch auf die letzten fünfzig Meter nicht an zu
motoren – beinahe Salty in die Quere. Doch ich rege mich
nicht
auf, sondern beauftrage sie, Oliese freizuschleppen, die beim Warten
zuerst mit schlagenden Segeln der ablegenden Fähre im Weg
stand
und dann im Vorhafen schon wieder in den Schlick geraten ist. Zwar
verlangt Martha nun danach, die blöde Schiene abzumontieren,
sie
mit Schraubzwingen, so gut es geht, zusammen zu biegen und zu hoffen,
dass sie danach für den Rest der Reise keinen Ärger
mehr
macht. Zwar haben alle lahme Arme vom Ruderdruck und auch sonst
erschöpfte Glieder von der erheblichen Mühsal, sich
bei
vierzig Grad Schräglage und fast zwei Metern Welle
einigermaßen in Position zu halten. Zwar ist einiges an
Seekarten
und Kojenpolstern mehr als nur ein bisschen nass geworden.
Doch auf müden, wettergegerbten Gesichtern sehe ich mindestens
ein
Lächeln, wenn nicht gar ein breites Grinsen, und der Tenor
lautet:
„Ich habe ich nicht eine Sekunde lang unsicher
gefühlt auf
diesem Boot.“ Meine Boote – sie werden eifrig
bestaunt ob
ihrer Schönheit – sind vielleicht ein bisschen
gerupft, aber
sie wirken mächtig stolz und glücklich, ihre
Tapferkeit und
ihre unerschütterliche Seetauglichkeit mal wieder richtig
unter
Beweis gestellt zu haben.
Für die schöne Insel haben wir leider keine Zeit.
Nach
flautigem Beginn wird es endlich das ersehnte
Schönwettersegeln
bei halbem Wind aus Ost 3-4, und das bringt uns nach Grenaa. Nach vier
strammen Segeltagen können wir einen Tag Pause gut gebrauchen,
und
da trifft es sich gut, dass es bei Nordost vorerst nicht wirklich
weiter geht.
 Es ist eine Reise der Kontraste: Das mulmige Gefühl zu Beginn
einer Abenteuerreise ins Unbekannte, die inzwischen entstandene
Vertrautheit mit dem Boot, dem zuvor ungewohnten
Päckchenliegen,
der Gruppe. Flautengedümpel und Starkwind. Knifflige
Engstellen
offenes Wasser – als nächster Programmpunkt liegt
vor uns
die Weite des Kattegats. Quirlige, volle Häfen, bald jedoch
die
Ruhe und Einsamkeit in den Schären. Und immer wieder die
überwältigende Schönheit der Natur in all
ihren
Facetten.
Es ist eine Reise der Kontraste: Das mulmige Gefühl zu Beginn
einer Abenteuerreise ins Unbekannte, die inzwischen entstandene
Vertrautheit mit dem Boot, dem zuvor ungewohnten
Päckchenliegen,
der Gruppe. Flautengedümpel und Starkwind. Knifflige
Engstellen
offenes Wasser – als nächster Programmpunkt liegt
vor uns
die Weite des Kattegats. Quirlige, volle Häfen, bald jedoch
die
Ruhe und Einsamkeit in den Schären. Und immer wieder die
überwältigende Schönheit der Natur in all
ihren
Facetten.
 In
dieser Hinsicht fällt Grenaa zweifellos aus dem Rahmen. Hier
ist
es nicht im eigentlichen Sinne schön. Dass man immer und immer
wieder hier landet, hat einen anderen Grund: Von Süden, von
Samsø oder Sejerø kommend, gibt es auf gut
dreißig
Meilen keinen Hafen. Nördlich biegt die Küste nach
Westen ab,
an Grenaa vorbei weiterzusegeln bedeutet also eine erheblich
längere Strecke. Von Grenaa haben wir die kürzeste
Überfahrt zur schwedischen Küste, und wir werden sie
sogar
mit einem Zwischenstopp auf Anholt halbieren. Doch zuvor gilt es
unseren Liegetag zu genießen, und dazu bietet der Ort
genügend Möglichkeiten: Es gibt ein ausgezeichnetes
Fischgeschäft, und das passt ausgezeichnet zu den im Hafen
reichlich vorhandenen Grills. Profi Peter und die ambitionierten
Hobbyköche wetteifern um die kreativste Zubereitung. Zuvor
begebe
ich mich zur Abwrackwerft und sehe staunend zu, wie ein Bagger mit
einem Werkzeug, dass einer riesigen Rohrzange ähnelt, aber
auch
die Silhouette und den Charme eines Tyrannosaurus Rex trägt,
einen
ausgedienten Fischkutter in handliche Brocken zerknabbert.
In
dieser Hinsicht fällt Grenaa zweifellos aus dem Rahmen. Hier
ist
es nicht im eigentlichen Sinne schön. Dass man immer und immer
wieder hier landet, hat einen anderen Grund: Von Süden, von
Samsø oder Sejerø kommend, gibt es auf gut
dreißig
Meilen keinen Hafen. Nördlich biegt die Küste nach
Westen ab,
an Grenaa vorbei weiterzusegeln bedeutet also eine erheblich
längere Strecke. Von Grenaa haben wir die kürzeste
Überfahrt zur schwedischen Küste, und wir werden sie
sogar
mit einem Zwischenstopp auf Anholt halbieren. Doch zuvor gilt es
unseren Liegetag zu genießen, und dazu bietet der Ort
genügend Möglichkeiten: Es gibt ein ausgezeichnetes
Fischgeschäft, und das passt ausgezeichnet zu den im Hafen
reichlich vorhandenen Grills. Profi Peter und die ambitionierten
Hobbyköche wetteifern um die kreativste Zubereitung. Zuvor
begebe
ich mich zur Abwrackwerft und sehe staunend zu, wie ein Bagger mit
einem Werkzeug, dass einer riesigen Rohrzange ähnelt, aber
auch
die Silhouette und den Charme eines Tyrannosaurus Rex trägt,
einen
ausgedienten Fischkutter in handliche Brocken zerknabbert.
 Die
ausgelassene Stimmung beim Grillen
erhält mit dem Update des dänischen Seewetterberichts
einen
Dämpfer: „Auslaufen um fünf Uhr“,
gebe ich zu
Protokoll, „Wind ist nur bis mittags. Bis dahin sollten wir
Anholt erreichen.“ Erschwerend hinzu kommt, dass der folgende
Tag, an dem wir im Idealfall die ersten Schären, zumindest
aber
die schwedische Küste schaffen müssen, auch nicht
gerade
stürmisch zu werden verspricht. Also erneut Auslaufen um
fünf.
Die
ausgelassene Stimmung beim Grillen
erhält mit dem Update des dänischen Seewetterberichts
einen
Dämpfer: „Auslaufen um fünf Uhr“,
gebe ich zu
Protokoll, „Wind ist nur bis mittags. Bis dahin sollten wir
Anholt erreichen.“ Erschwerend hinzu kommt, dass der folgende
Tag, an dem wir im Idealfall die ersten Schären, zumindest
aber
die schwedische Küste schaffen müssen, auch nicht
gerade
stürmisch zu werden verspricht. Also erneut Auslaufen um
fünf.
 Thorsten auf der Frieda sagt: „Ich
fühle mich unter Segeln sicherer als mit Motor.“
Paula und ich haben schon länger den Ehrgeiz, alles seglerisch
zu lösen, wo immer es geht. So sehen es bald auch die Crews
von Martha und Salty. Peter auf der Oliese widerspricht beharrlich: Er
habe gelernt, das erste, das angeht, sei der Motor, und das letzte, das
ausgeht, ebenfalls der Motor. Das hat er allerdings auf einer
Vierzig-Fuß-Yacht gelernt, und da würde ich ihm
bedenkenlos zustimmen. An diesem frühen Morgen in Grenaa legen
alle unter Segeln ab. Und wenn es nur dazu dient, den Hafen schlafen zu
lassen. Größte Ironie: Peter sitzt am Ruder der
Königin der Morgensonne.
Thorsten auf der Frieda sagt: „Ich
fühle mich unter Segeln sicherer als mit Motor.“
Paula und ich haben schon länger den Ehrgeiz, alles seglerisch
zu lösen, wo immer es geht. So sehen es bald auch die Crews
von Martha und Salty. Peter auf der Oliese widerspricht beharrlich: Er
habe gelernt, das erste, das angeht, sei der Motor, und das letzte, das
ausgeht, ebenfalls der Motor. Das hat er allerdings auf einer
Vierzig-Fuß-Yacht gelernt, und da würde ich ihm
bedenkenlos zustimmen. An diesem frühen Morgen in Grenaa legen
alle unter Segeln ab. Und wenn es nur dazu dient, den Hafen schlafen zu
lassen. Größte Ironie: Peter sitzt am Ruder der
Königin der Morgensonne.
Bis
wir endlich unterwegs sind, ist es doch eher sechs Uhr, und
als der Wind einschläft, sind wir gerade am Windpark
vorbei, Anholt ist eben so zu erkennen. Der Windpark ist
klasse, denn seit es
ihn gibt, kann man die ganzen 27 Meilen nach Sicht fahren. Es erweist
sich aber als gewisser Fehler, ihn in Lee zu passieren: Eine ganze
Reihe von Windgeneratoren nimmt dem Wind erhebliche Kraft, und das
kostet uns wertvolle Zeit. Ist ja auch viel spannender, zwischen den
riesigen Windrädern durchzusegeln, anstatt in sicherem Abstand
zu
bleiben - also weiche ich vom ursprünglichen Plan ein bisschen
ab:
Wir kämpfen uns eine Windradreihe nach Luv.
 Anholt
erreichen Oliese und Paula schließlich unter Motor, und das
ist
gut so, denn der Hafen ist erwartungsgemäß brechend
voll,
aber wir ergattern noch einen Platz an der Zwischenmole, wo wir mit
Vorleinen vor Heckanker liegen – Trainingslager für
die
Schären. Die anderen drei Boote segeln wacker mit jeder noch
so
kleinen Brise, doch als sie ankommen, sind wir mit dem Anlegen auch
eben erst fertig geworden, und ich konnte noch mit dem
Hafenkapitän aushandeln, dass wir tatsächlich so
liegen
dürfen. Es ist wunderschön, wieder einmal unsere
eigene,
ruhige, kleine Insel, diesmal mit Landausstieg, und der Irrsinn des
Hafens liegt unsichtbar jenseits der Mole.
Anholt
erreichen Oliese und Paula schließlich unter Motor, und das
ist
gut so, denn der Hafen ist erwartungsgemäß brechend
voll,
aber wir ergattern noch einen Platz an der Zwischenmole, wo wir mit
Vorleinen vor Heckanker liegen – Trainingslager für
die
Schären. Die anderen drei Boote segeln wacker mit jeder noch
so
kleinen Brise, doch als sie ankommen, sind wir mit dem Anlegen auch
eben erst fertig geworden, und ich konnte noch mit dem
Hafenkapitän aushandeln, dass wir tatsächlich so
liegen
dürfen. Es ist wunderschön, wieder einmal unsere
eigene,
ruhige, kleine Insel, diesmal mit Landausstieg, und der Irrsinn des
Hafens liegt unsichtbar jenseits der Mole.
 Anholt
ist eine wunderschöne, vielfältige, große
Insel –
wir würden ihr auch nicht gerecht, wenn wir einen Tag bleiben
würden. Ich fasse den Plan, einen Flottillentörn im
Juni
hierhin anzubieten, und gebe bei der Besprechung mit Seekarte einen
unscheinbaren Satz von mir, der Eindruck macht: „Das letzte
Boot legt um fünf ab.“ Als ich gegen drei Uhr
aufwache, ist
etwas anders als sonst. Bisher habe ich mich, den ersten Kaffee in der
Hand, skeptisch umgeschaut und wohlwollend festgestellt, dass sich
zumindest hier und da schon jemand regt, also wenigstens nicht die
komplette Gruppe verschlafen hat. Jetzt umgibt mich
geschäftiges
Gewusel, Persenninge und Segel rascheln, Fallen werden angeschlagen,
Tatendrang erfüllt den Ort.
Anholt
ist eine wunderschöne, vielfältige, große
Insel –
wir würden ihr auch nicht gerecht, wenn wir einen Tag bleiben
würden. Ich fasse den Plan, einen Flottillentörn im
Juni
hierhin anzubieten, und gebe bei der Besprechung mit Seekarte einen
unscheinbaren Satz von mir, der Eindruck macht: „Das letzte
Boot legt um fünf ab.“ Als ich gegen drei Uhr
aufwache, ist
etwas anders als sonst. Bisher habe ich mich, den ersten Kaffee in der
Hand, skeptisch umgeschaut und wohlwollend festgestellt, dass sich
zumindest hier und da schon jemand regt, also wenigstens nicht die
komplette Gruppe verschlafen hat. Jetzt umgibt mich
geschäftiges
Gewusel, Persenninge und Segel rascheln, Fallen werden angeschlagen,
Tatendrang erfüllt den Ort.
 Und
das ist ja auch ganz richtig so, denn immerhin geht es nun nach
Schweden, von dem bisher immer nur als fernes Ziel die Rede war. Zwar
schaffen wir tatsächlich nur Varberg, und auch das nur, weil
wir,
nachdem wir unter Motor den Tiefwasserweg T gequert haben, eine
schöne Seebrise nutzen können, die sich schon von
Weitem
durch üppige Cumuluswolken angekündigt hat. Aber von
Varberg
aus geht es anderntags direkt nach Hästholmen am Eingang des
Kungsbacka Fjords: Der südlichsten Schäre, an der man
anlegen
kann.
Und
das ist ja auch ganz richtig so, denn immerhin geht es nun nach
Schweden, von dem bisher immer nur als fernes Ziel die Rede war. Zwar
schaffen wir tatsächlich nur Varberg, und auch das nur, weil
wir,
nachdem wir unter Motor den Tiefwasserweg T gequert haben, eine
schöne Seebrise nutzen können, die sich schon von
Weitem
durch üppige Cumuluswolken angekündigt hat. Aber von
Varberg
aus geht es anderntags direkt nach Hästholmen am Eingang des
Kungsbacka Fjords: Der südlichsten Schäre, an der man
anlegen
kann.
Das Groß ist geborgen, Heckanker, Bootshaken, Stechpaddel
liegen
im Cockpit bereit, Hammer und Schärenhaken auf dem Vorschiff.
Die
Anderen segeln mit der Fock in der großen Bucht auf und ab
und
warten, was Paula und ich zaubern werden. Wir haben einen Plan: Ohne
Motor an die Schäre. Mit Mut, Entschlossenheit, der
griffbereiten
Ausrüstung und voller Konzentration sollte es gelingen
– der
Felsen ist hoch und bietet bestmögliche Abdeckung, der Wind
kommt
zudem genau ablandig, Paulas Heck wird also nicht auswehen. Nervige
Strömung gibt es auch keine. Ich berge die Fock. Werfe den
Anker
– zu früh, wie sich herausstellt, die Leine ist zu
Ende,
bevor wir das Ufer erreichen.
 Also
Anker wieder auf, Fock wieder hoch, neuer Anlauf. Diesmal widerstehe
ich tunlichst dem Impuls, den Anker erneut zu früh zu werfen.
Schätze den Abstand ein, zwei Bootslängen sollen es
sein,
nicht länger. Der Anker fällt, das Segel ist unten,
Paula
treibt mit nichtmal einem halben Knoten sauber auf den Felsen zu. Ein
leises Klacken verrät den Kontakt einer Tonne Gusseisen mit
durch
Seegras gepolstertem Granit – zu flach! Wir wiederholen das
Manöver hundert Meter südlich. Und diesmal gelingt
es: Ich
steige auf einen flachen Vorsprung, halte Paulas Bug an, belege eine
Vorleine. Steige zurück an Bord, hole den Heckanker durch und
winke die Anderen herbei.
Also
Anker wieder auf, Fock wieder hoch, neuer Anlauf. Diesmal widerstehe
ich tunlichst dem Impuls, den Anker erneut zu früh zu werfen.
Schätze den Abstand ein, zwei Bootslängen sollen es
sein,
nicht länger. Der Anker fällt, das Segel ist unten,
Paula
treibt mit nichtmal einem halben Knoten sauber auf den Felsen zu. Ein
leises Klacken verrät den Kontakt einer Tonne Gusseisen mit
durch
Seegras gepolstertem Granit – zu flach! Wir wiederholen das
Manöver hundert Meter südlich. Und diesmal gelingt
es: Ich
steige auf einen flachen Vorsprung, halte Paulas Bug an, belege eine
Vorleine. Steige zurück an Bord, hole den Heckanker durch und
winke die Anderen herbei.
 Sie haben es einfacher, müssen nur langsam an Paulas Heck
herantreiben und vorher auf mein Zeichen hin den Heckanker fallen
lassen. Dann nehmen wir das jeweilige Boot ins Päckchen und
machen
eine Vorleine an Land fest. Als alle da sind, fast zwei Stunden sind
vergangen, macht Ernst mich auf das Wunder aufmerksam, das mir vor
Anspannung und Konzentration entgangen ist: Unsere erste
Schäre,
und niemand hat den Außenborder benutzt! Augenzwinkernd
fügt er hinzu:
„Wenn ich das hier Peter erzähle, wird er behaupten:
‚Das
geht doch gar nicht.‘“ Peter ist in
Varberg
abgereist, Ernsts Sohn Christoph hat seinen Platz eingenommen. Segeln
hin, Motor her - nicht
nur den
beständigen Kuchennachschub werden wir vermissen.
Sie haben es einfacher, müssen nur langsam an Paulas Heck
herantreiben und vorher auf mein Zeichen hin den Heckanker fallen
lassen. Dann nehmen wir das jeweilige Boot ins Päckchen und
machen
eine Vorleine an Land fest. Als alle da sind, fast zwei Stunden sind
vergangen, macht Ernst mich auf das Wunder aufmerksam, das mir vor
Anspannung und Konzentration entgangen ist: Unsere erste
Schäre,
und niemand hat den Außenborder benutzt! Augenzwinkernd
fügt er hinzu:
„Wenn ich das hier Peter erzähle, wird er behaupten:
‚Das
geht doch gar nicht.‘“ Peter ist in
Varberg
abgereist, Ernsts Sohn Christoph hat seinen Platz eingenommen. Segeln
hin, Motor her - nicht
nur den
beständigen Kuchennachschub werden wir vermissen.
 Die
erste Schäre also. Das ersehnte Ziel erreicht – nach
Monaten
des Hoffens und Bangens, ob die Reise überhaupt zustande
kommt;
nach anstrengender Vorbereitung und der gehörigen Anspannung
der
ersten Tage, als die Crews sich erst einruckeln mussten; nach einer
strapaziösen Segelwoche nebst kleinen Reparaturen,
täglicher
Törnplanung und wenig Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Jetzt
liegen meine geliebten Boote Seite an Seite am Felsen, die Crews sind
fleißig beim Aufklaren, doch allmählich zeigt sich
ihre
Begeisterung über den traumhaften Ort, den wir erreicht haben.
Ich
halte mich wacker. Erst beim Segelpacken spüre ich Frieda
hinter
mir sagen: „Was heulst'n du?“ Ich drehe mich zu ihr
um,
wische mir Tränchen der Freude und Rührung aus den
Augen und
sage: „Du weißt doch ganz genau, was mir das hier
bedeutet.“ Die salzige Paula bekommt ein weiteres
Küsschen.
Dann krabbele ich den Hang hinauf, um in der nach Wachholder duftenden,
steinigen Wunderwelt herumzutoben.
Die
erste Schäre also. Das ersehnte Ziel erreicht – nach
Monaten
des Hoffens und Bangens, ob die Reise überhaupt zustande
kommt;
nach anstrengender Vorbereitung und der gehörigen Anspannung
der
ersten Tage, als die Crews sich erst einruckeln mussten; nach einer
strapaziösen Segelwoche nebst kleinen Reparaturen,
täglicher
Törnplanung und wenig Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Jetzt
liegen meine geliebten Boote Seite an Seite am Felsen, die Crews sind
fleißig beim Aufklaren, doch allmählich zeigt sich
ihre
Begeisterung über den traumhaften Ort, den wir erreicht haben.
Ich
halte mich wacker. Erst beim Segelpacken spüre ich Frieda
hinter
mir sagen: „Was heulst'n du?“ Ich drehe mich zu ihr
um,
wische mir Tränchen der Freude und Rührung aus den
Augen und
sage: „Du weißt doch ganz genau, was mir das hier
bedeutet.“ Die salzige Paula bekommt ein weiteres
Küsschen.
Dann krabbele ich den Hang hinauf, um in der nach Wachholder duftenden,
steinigen Wunderwelt herumzutoben.
Etwas ist anders in diesem Sommer. Auch in Schweden hat es seit Wochen
oder gar Monaten nicht geregnet. Später werden wir von
Waldbränden hören und feststellen, dass im ganzen
Land das
Grillen verboten ist. Jetzt fällt auf, dass die kleinen
Tümpel in den Senken der Felsen komplett ausgetrocknet sind.
Das
durstige Torfmoos klingt bei Berührung kratzig wie Sandpapier.
Die
Gräser sind braun und wirken traurig. Wir bewegen uns am Rand
einer ökologischen Katastrophe. Was wir als Traumwetter
genießen, ist für die Natur zweifellos
großer Stress.
Doch die spärliche Vegetation dürfte Kummer gewohnt
sein: Der
Boden ist so flachgründig, dass vermutlich schon wenige Tage
ohne
Regen dazu führen, dass die Wurzeln kein Wasser mehr finden.
Der
schroffen Schönheit der Landschaft tut das keinen Abbruch:
Über der endlosen Weite des Wassers und der geduldigen
Unendlichkeit der Felslandschaft kommt nach einen Tag mit bedeckten
Himmel sogar noch eine goldene Abendsonne heraus.
 Der
nächste Tag beginnt mit wenig Wind und reichlich Gestampfe
beim
Verlassen der Bucht. Oliese scheint darauf keine Lust zu haben, sie
fährt beinahe überhaupt nicht los –
schlechte
Voraussetzungen für 40 Seemeilen. Irgendwann läuft es
mit um
die vier Knoten einigermaßen. Es ist der Tag, an dem wir das
Fahrwasser nach Göteborg queren und tiefer eintauchen sollen
in
die Schärenwelt: Am Anfang sind es nur einzelne Felsen hier
und
da, dann stehen sie immer dichter, bis unsere Konzentration und unser
navigatorisches Geschick vor höchste Ansprüche
gestellt
werden. Von Süden her sich anzunähern, ist didaktisch
günstig – die Gäste können
allmählich einen
Blick dafür entwickeln, worauf es hier ankommt. Vielleicht ist
es
gar nicht schlecht, wenn es dabei etwas langsamer vorangeht.
Der
nächste Tag beginnt mit wenig Wind und reichlich Gestampfe
beim
Verlassen der Bucht. Oliese scheint darauf keine Lust zu haben, sie
fährt beinahe überhaupt nicht los –
schlechte
Voraussetzungen für 40 Seemeilen. Irgendwann läuft es
mit um
die vier Knoten einigermaßen. Es ist der Tag, an dem wir das
Fahrwasser nach Göteborg queren und tiefer eintauchen sollen
in
die Schärenwelt: Am Anfang sind es nur einzelne Felsen hier
und
da, dann stehen sie immer dichter, bis unsere Konzentration und unser
navigatorisches Geschick vor höchste Ansprüche
gestellt
werden. Von Süden her sich anzunähern, ist didaktisch
günstig – die Gäste können
allmählich einen
Blick dafür entwickeln, worauf es hier ankommt. Vielleicht ist
es
gar nicht schlecht, wenn es dabei etwas langsamer vorangeht.
Gerade beginne ich, denn mäßig tollen Segeltag zu
genießen, als mich ein Funkspruch von Salty in
größte
Unruhe versetzt: Die Bilgepumpe läuft ununterbrochen! Salty
hat
seit Tagen schon verstärkt Wasser gemacht. Außer
einem
Vermerk für die Winterarbeit sah ich keinen akuten
Handlungsbedarf
– doch jetzt klingt das anders: nach einem ernsthaften, die
weitere Reise gefährdenden Problem. Ich vergewissere mich,
dass
vorläufig die Situation unter Kontrolle ist. Blättere
fieberhaft im Hafenhandbuch auf der Suche nach einem Kran, mit dessen
Hilfe ich Salty aus dem Wasser holen und Kielnähte und
Plankenstöße nachkalfaten kann. Die Wahl
fällt auf
Björkö, die eigentlich geplante Schäre
fällt aus.
„Vernünftige Entscheidung“, sagen alle.
Außer
einem Kran hat Björkö in meinen Augen nichts zu
bieten, ich
bin sogar ziemlich genervt: In dem großen geräumigen
Hafen
kurven wir eine Stunde herum, bis wir schließlich am
Kurzzeitsteg
direkt an der Einfahrt, Motorbootschwell vom Fahrwasser inklusive,
anlegen dürfen. Der winzige Gästehafen ist brechend
voll, der
Rest ist als Bootsparkplatz der Einheimischen nicht auf Gastlieger
eingestellt. Dutzende von Boxen sind frei, aber es gibt keine
Rot/Grün-Schilder, und niemand kann sagen, ob wir irgendwo
liegen
können. Kran und Mastenkran befinden sich im
Gästehafen und
sind unzugänglich, bis sich die dort liegende Meute auf den
Weg
macht.
Zum Glück ist das Problem viel einfacher zu lösen
– die
Bilgepumpe ist einfach nur verstopft. Björkö hat sich
trotzdem gelohnt, denn es gibt auch einen Bootsausrüster, und
dort
bekomme ich morgens eine neue Pumpe. Auch die Gäste wirken
zufrieden: Wir befinden uns mehr oder weniger in den Vororten
Göteborgs, mit einem eigenen Charakter, markant anders als in
den
bisherigen Häfen. „Es ist gut, einen Eindruck davon
zu
bekommen“, findet Boris stellvertretend. Als Salty wieder
eifrig
lenzt und ein hübscher Wind aufkommt, segeln wir weiter.
 So
leicht und locker das Anlegen in Hästholmen war, so knifflig
und
unelegant wird es auf Ussholmen: Der frische Wind weht schräg
zum
Ufer. Wir brauchen den Heckanker mit passend belegter Leine, damit das
Heck nicht an den Felsen treibt, während ich an Land mit der
Vorleine hantiere. Wir brauchen auch den Motor, um uns
einigermaßen im Wind zu halten und uns kontrolliert dem Ufer
zu
nähern. Im Grunde brauchen wir auch jemanden an Land. Leute
sind
genügend da, doch niemand macht Anstalten, mir zu helfen. Ich
ziehe in Erwägung, Oliese vorzuschicken – Ernst und
Christoph haben schon Erfahrung im Schärenankern, und sie sind
eben zu zweit. Aber einen Versuch will ich doch unternehmen.
So
leicht und locker das Anlegen in Hästholmen war, so knifflig
und
unelegant wird es auf Ussholmen: Der frische Wind weht schräg
zum
Ufer. Wir brauchen den Heckanker mit passend belegter Leine, damit das
Heck nicht an den Felsen treibt, während ich an Land mit der
Vorleine hantiere. Wir brauchen auch den Motor, um uns
einigermaßen im Wind zu halten und uns kontrolliert dem Ufer
zu
nähern. Im Grunde brauchen wir auch jemanden an Land. Leute
sind
genügend da, doch niemand macht Anstalten, mir zu helfen. Ich
ziehe in Erwägung, Oliese vorzuschicken – Ernst und
Christoph haben schon Erfahrung im Schärenankern, und sie sind
eben zu zweit. Aber einen Versuch will ich doch unternehmen.
Er geht einigermaßen schief. Die Ankerleine gerät in
den
Propeller. Der Wind stoppt uns auf, Paula beginnt zu vertreiben. Ich
renne nach vorne – nur ein beherzter Satz an Land kann das
Manöver noch retten. Doch der Fels ist glatt und
abschüssig
– ich lange, Vorleine in der Hand, im Wasser. Auf dem Seegras
rutsche ich immer wieder ab. Paulas Kiel steht inzwischen auf einem
Stein, was zunächst ziemlich gut ist, weil sie so immerhin
nicht
vertreibt. Endlich kommt jemand, nimmt mir die Leine ab und belegt sie
auf einem Ring, so dass ich mich daran hochziehen kann.
 Nun
ist das nächste Problem: Wie komme ich zurück an
Bord? Die
Anderen warten geduldig draußen vor der Schäre, bis
ich
über Funk die Nächsten reinrufe. Ich versuche es mit
Winken.
Dann mit Brüllen. Endlich kommt Salty und legt an. Von ihr
kann
ich auf Paula übersteigen und sie erstmal wieder von dem Stein
runterziehen. Als auch Frieda angelegt hat, versuchen wir Paula
gemeinsam ins Päckchen zu ziehen. Doch zwischen Ruderblatt und
Achtersteven hängt die Ankerleine eines benachbarten
Motorbootes
fest. Paula kommt nicht von der Stelle, das Motorboot auch nicht
– und die Leute wollen eigentlich gerade ablegen.
Nun
ist das nächste Problem: Wie komme ich zurück an
Bord? Die
Anderen warten geduldig draußen vor der Schäre, bis
ich
über Funk die Nächsten reinrufe. Ich versuche es mit
Winken.
Dann mit Brüllen. Endlich kommt Salty und legt an. Von ihr
kann
ich auf Paula übersteigen und sie erstmal wieder von dem Stein
runterziehen. Als auch Frieda angelegt hat, versuchen wir Paula
gemeinsam ins Päckchen zu ziehen. Doch zwischen Ruderblatt und
Achtersteven hängt die Ankerleine eines benachbarten
Motorbootes
fest. Paula kommt nicht von der Stelle, das Motorboot auch nicht
– und die Leute wollen eigentlich gerade ablegen.
Annia taucht. Zerrt und stochert. Findet schließlich die
entscheidende Information: Die Leine hat sich nicht etwa von unten
eingefädelt, sondern zwischen dem untersten und dem mittleren
Scharnier. Mit anderen Worten: Ich muss sie nur mit dem Bootshaken
aufholen, schon kann ich sie mit einem kräftigen Ruck
lösen.
Die Motorboot-Crew sieht amüsiert und geduldig zu: Die wollten
eigentlich gerade ablegen. Was sie mit zehn Minuten
Verzögerung ja
auch können. Paula ist frei. Und auch dieses Abenteuer nimmt
einen
glücklichen Ausgang.
Ussholmen ist eine Außenschäre. Schroff, karg, kaum
bewachsen und wunderschön, dazu mit freiem Blick aufs offene
Wasser. Boris und Katrin laden zum Sundowner auf dem höchsten
Punkt der Insel ein. Wir freuen uns darauf – doch es gibt ein
Problem: Wolken ziehen auf, über dem Festland beginnt es zu
donnern. „Ich fürchte, aus dem Sundowner wird
nichts“,
unke ich. Was ich viel eher kommen sehe, sind fünf Crews die
im
strömenden Regen ihr Boot vom Felsen abhalten, weil die
Bö
von hinten einfällt und die Heckanker das nicht halten. Doch
die
Bucht ist schmal genug, um per Schlauchboot eine Achterleine zum
anderen Ufer auszubringen – Katrin erledigt das
souverän,
und nun liegen wir nach meinem Gefühl bei allen Windrichtungen
sicher. Weil das Gewitter über dem Festland bleibt, ist der
Sundowner gerettet.
 Und
er beschert uns ein echtes Schauspiel. Die Abendsonne glitzert
spektakulär zwischen bizarren Wolkenformationen hindurch. Auf
der
anderen Seite blitzt es, und die benachbarten Schären
hüllen
sich in einen gruseligen Schleier aus Dunkelheit und Regen. Dazwischen
sitzen wir und genießen dieses 360°-Kino in vollen
Zügen. Spätestens jetzt kann sich niemand mehr der
Faszination entziehen, auf eigenem Kiel in diese Wunderwelt gelangt zu
sein, sich die Belohnung erarbeitet und bisweilen erkämpft zu
haben, begleitet von einem Skipper und Törnplaner, der
für
jedes Problem eine Lösung findet und Tag für Tag ein
Ziel
auswählt, das ganz anders ist als alle bisherigen.
Und
er beschert uns ein echtes Schauspiel. Die Abendsonne glitzert
spektakulär zwischen bizarren Wolkenformationen hindurch. Auf
der
anderen Seite blitzt es, und die benachbarten Schären
hüllen
sich in einen gruseligen Schleier aus Dunkelheit und Regen. Dazwischen
sitzen wir und genießen dieses 360°-Kino in vollen
Zügen. Spätestens jetzt kann sich niemand mehr der
Faszination entziehen, auf eigenem Kiel in diese Wunderwelt gelangt zu
sein, sich die Belohnung erarbeitet und bisweilen erkämpft zu
haben, begleitet von einem Skipper und Törnplaner, der
für
jedes Problem eine Lösung findet und Tag für Tag ein
Ziel
auswählt, das ganz anders ist als alle bisherigen.
Am nächsten Tag wollen wir nach Åstol. Das ist diese
Insel
im Marstrands Fjord, die aus der Ferne nur aus Häusern zu
bestehen
scheint. Wir brauchen einen Hafen, denn wieder sind Gewitter
angekündigt, und diesmal sind Auffrischen und Drehen des
Windes
sogar dem Seewetterbericht zu entnehmen. Eine Schäre, wo wir
dabei
sicher liegen könnten, finde ich nicht. Dafür lockt
mein
Versprechen von Kaffee und Kuchen in einem netten Café. Ich
schlage vor, statt den sechs Meilen außenrum einen Abstecher
von
elf Meilen durchs Innenfahrwasser zu machen.
 Doch
mein Timing geht diesmal komplett schief. Als das letzte Boot abgelegt
und die Segel gesetzt hat, schläft der Wind ein. Wir treiben
in
absoluter Flaute, nehmen ab und zu, wenn uns die Strömung zu
dicht
an einen Felsen bringt, das Stechpaddel, und vertreiben uns mit
Badespaß und Schwimmen von Boot zu Boot die Zeit. Nach zwei
Stunden verliert das seinen Reiz, wir wählen die
kürzere
Strecke und den Außenborder. Kurz vorm Hafen kommt wieder
Wind
auf. Und als am vom Hafenkapitän angewiesenen Liegeplatz - wir
alle längsseits an einer winzigen Motoryacht - das letzte Boot
angelegt hat, was passiert da? Genau: Der Innenlieger möchte
auslaufen.
Doch
mein Timing geht diesmal komplett schief. Als das letzte Boot abgelegt
und die Segel gesetzt hat, schläft der Wind ein. Wir treiben
in
absoluter Flaute, nehmen ab und zu, wenn uns die Strömung zu
dicht
an einen Felsen bringt, das Stechpaddel, und vertreiben uns mit
Badespaß und Schwimmen von Boot zu Boot die Zeit. Nach zwei
Stunden verliert das seinen Reiz, wir wählen die
kürzere
Strecke und den Außenborder. Kurz vorm Hafen kommt wieder
Wind
auf. Und als am vom Hafenkapitän angewiesenen Liegeplatz - wir
alle längsseits an einer winzigen Motoryacht - das letzte Boot
angelegt hat, was passiert da? Genau: Der Innenlieger möchte
auslaufen.
Die Insel Åstol gliedert sich in zwei schmalen
Hälften um
die langgezogene Bucht, die heute der Hafen ist. An der Westspitze der
Insel ist eine hübsche Badestelle. Das ganze Ensemble ist
schnuckelig und gepflegt wie aus dem Reiseführer. Auf der
Ostseite
befindet sich die Hafeneinfahrt, dann kommt der Fähranleger.
Vorsicht, Schraubenwasser: In dieser Gegend gibt es zahlreiche kleine
Personenfähren, die nicht eigentlich anlegen, sondern in eine
Gummiwulst am Bug eindampfen. Obwohl die Fähre also im Hafen
liegt, erzeugt sie stetig Schraubenwasser – wer unvorbereitet
daran vorbeituckert, fährt zwei abrupte Schlenker. Das
Schraubenwasser sehe ich frühzeitig – und reagiere
dennoch
viel zu spät.
 Das
Café haben wir mit unserem Liegeplatz fast genau getroffen.
Für das abendliche Grillen ergibt sich zwanglos ein
Spaziergang um
die halbe Insel zur Nordseite des Hafens, wo wir vor zwei Jahren
gelegen haben. Der freundliche Hafenkapitän erinnert sich
daran.
Als das Fleisch fertig ist, haben wir es ein bisschen eilig: Das
Gewitter zieht auf. Doch wir bleiben ruhig sitzen. Boris und ich
unterhalten uns stoisch weiter, als die ersten Tropfen die Anderen
unter Deck treiben. Es kommt ein bisschen Wind auf, wir schlendern
zurück, ziehen Ölzeug über und korrigieren
die
Festmacher. Vorwiegend die des Nachbarpäckchens, das als Block
einen Satz auf uns zu gemacht hat – Paulas Ruderkopf kratzt
am
Gelcoat eines modernen Heckspiegels, ihre Bugspitze an dem
Schlängel, an dem unsere Vorleinen hängen. Ich wende
mich
eindringlich an die fröhlich im Cockpit sitzenden Nachbarn:
„You need to go forward!“ Als alle Boote wieder an
ihrem
Platz liegen, hört der Regen schon wieder auf, und wir leeren
zu
dritt noch eine Flasche Portwein.
Das
Café haben wir mit unserem Liegeplatz fast genau getroffen.
Für das abendliche Grillen ergibt sich zwanglos ein
Spaziergang um
die halbe Insel zur Nordseite des Hafens, wo wir vor zwei Jahren
gelegen haben. Der freundliche Hafenkapitän erinnert sich
daran.
Als das Fleisch fertig ist, haben wir es ein bisschen eilig: Das
Gewitter zieht auf. Doch wir bleiben ruhig sitzen. Boris und ich
unterhalten uns stoisch weiter, als die ersten Tropfen die Anderen
unter Deck treiben. Es kommt ein bisschen Wind auf, wir schlendern
zurück, ziehen Ölzeug über und korrigieren
die
Festmacher. Vorwiegend die des Nachbarpäckchens, das als Block
einen Satz auf uns zu gemacht hat – Paulas Ruderkopf kratzt
am
Gelcoat eines modernen Heckspiegels, ihre Bugspitze an dem
Schlängel, an dem unsere Vorleinen hängen. Ich wende
mich
eindringlich an die fröhlich im Cockpit sitzenden Nachbarn:
„You need to go forward!“ Als alle Boote wieder an
ihrem
Platz liegen, hört der Regen schon wieder auf, und wir leeren
zu
dritt noch eine Flasche Portwein.
 "Wildgänse"
im Formationsflug: Von Åstol aus begeben wir uns in den
engsten,
navigatorisch anspruchsvollsten, aber auch schönsten und
vielfältigsten Teil des Reviers. Und zwar bei bedecktem
Himmel,
ein neuerliches Gewitter über dem Festland kritisch
beäugend.
Hinter Paula segeln die Anderen dicht zusammen und teilweise
nebeneinander. Das sieht ungemein schön aus, das Fotografieren
ist
aber gar nicht einfach, weil außer uns noch weitere Boote
unterwegs sind, denen wir gelegentlich auch mal ausweichen
müssen.
Und denen die fünf beharrlich segelnden Folkeboote vermutlich
ziemlich nervig im Weg sind.
"Wildgänse"
im Formationsflug: Von Åstol aus begeben wir uns in den
engsten,
navigatorisch anspruchsvollsten, aber auch schönsten und
vielfältigsten Teil des Reviers. Und zwar bei bedecktem
Himmel,
ein neuerliches Gewitter über dem Festland kritisch
beäugend.
Hinter Paula segeln die Anderen dicht zusammen und teilweise
nebeneinander. Das sieht ungemein schön aus, das Fotografieren
ist
aber gar nicht einfach, weil außer uns noch weitere Boote
unterwegs sind, denen wir gelegentlich auch mal ausweichen
müssen.
Und denen die fünf beharrlich segelnden Folkeboote vermutlich
ziemlich nervig im Weg sind.
 Wir
erreichen die „Jungfrauenloch“ genannte Schikane am
Südeingang des Hjärterösundes. Dass man hier
nicht
nebeneinander durchfahren kann, habe ich nicht extra erwähnt
– ich ging davon aus, die Formulierung „richtig,
richtig
eng und knifflig“ sei ausreichend, zumal zur
Ergänzung eines
Blicks in die Seekarte und schließlich auf die Felsformation
selbst. Paula schlüpft gekonnt hindurch. Im
anschließenden
Becken drehen wir ein paar Runden, und ich nutze die Gelegenheit
für weitere Fotos. Dann aber segeln Oliese und Salty
wahrhaftig
parallel in die Engstelle. Heraus kommt vorerst nur Oli –
Salty
bleibt auf einem Stein hängen. „Wir wollten Oliese
mehr
Platz geben“, jammert die Crew, „aber wir sind
mindestens
zwei Meter von der Bake weggeblieben.“
Wir
erreichen die „Jungfrauenloch“ genannte Schikane am
Südeingang des Hjärterösundes. Dass man hier
nicht
nebeneinander durchfahren kann, habe ich nicht extra erwähnt
– ich ging davon aus, die Formulierung „richtig,
richtig
eng und knifflig“ sei ausreichend, zumal zur
Ergänzung eines
Blicks in die Seekarte und schließlich auf die Felsformation
selbst. Paula schlüpft gekonnt hindurch. Im
anschließenden
Becken drehen wir ein paar Runden, und ich nutze die Gelegenheit
für weitere Fotos. Dann aber segeln Oliese und Salty
wahrhaftig
parallel in die Engstelle. Heraus kommt vorerst nur Oli –
Salty
bleibt auf einem Stein hängen. „Wir wollten Oliese
mehr
Platz geben“, jammert die Crew, „aber wir sind
mindestens
zwei Meter von der Bake weggeblieben.“
 Das
wird künftig Bestandteil meiner Einweisung sein: Eine Bake
steht,
anders als eine schwimmende, auf dem Grund verankerte Tonne, auf einem
Stein. Und der hat eine Ausdehnung, größer null und
größer als der Umfang der Bake. Salty kommt aber aus
eigener
Kraft schnell wieder frei. Die Crew ist beeindruckt, aber nicht allzu
verstört, und so kann die Reise weitergehen: durch den
nördlichen Ausgang des Hjärterösundes, und
der hat es
kaum weniger in sich, jedenfalls bei Westnordwest. Fünf Wenden
auf
fünfzig Metern, vorbei an mehreren Fahrwassertonnen in
unmittelbarer Nähe bedrohlichen Granits – soll man
keiner
sagen, Folkeboote seien nicht wendig.
Das
wird künftig Bestandteil meiner Einweisung sein: Eine Bake
steht,
anders als eine schwimmende, auf dem Grund verankerte Tonne, auf einem
Stein. Und der hat eine Ausdehnung, größer null und
größer als der Umfang der Bake. Salty kommt aber aus
eigener
Kraft schnell wieder frei. Die Crew ist beeindruckt, aber nicht allzu
verstört, und so kann die Reise weitergehen: durch den
nördlichen Ausgang des Hjärterösundes, und
der hat es
kaum weniger in sich, jedenfalls bei Westnordwest. Fünf Wenden
auf
fünfzig Metern, vorbei an mehreren Fahrwassertonnen in
unmittelbarer Nähe bedrohlichen Granits – soll man
keiner
sagen, Folkeboote seien nicht wendig.
 Segeltrimm bei Leichtwind. Überleben bei Starkwind. An- und
Ablegen in der Box und im Päckchen. Segelmanöver auf
engstem
Raum. Navigation in den Schären und auf dem Kattegat.
Funkverkehr.
Umgang mit ausgeklinkten Großbäumen und
ausgefallenen
Bilgepumpen. Mit Grundberührungen auf Sand und Granit. Die
Reise
bedeutet ständiges Lernen. Ohne dass wir einander wirklich
konkret
helfen könnten, wenn wirklich etwas schiefginge, gibt die
Gruppe
unglaubliche Sicherheit. Und das tägliche Nachbesprechen des
Erlebten, das Vorbesprechen des Kommenden, unterstützt die
Fortschritte. Am nahenden Ende der Reise werden diese vier Crews mehr
zu erzählen haben, als sie vermutlich in Worte fassen
können.
Und ich sollte ihnen ein Diplom ausstellen: „Mit dem
Folkeboot in
die Schären – Europas letztes großes
Abenteuer.“
Segeltrimm bei Leichtwind. Überleben bei Starkwind. An- und
Ablegen in der Box und im Päckchen. Segelmanöver auf
engstem
Raum. Navigation in den Schären und auf dem Kattegat.
Funkverkehr.
Umgang mit ausgeklinkten Großbäumen und
ausgefallenen
Bilgepumpen. Mit Grundberührungen auf Sand und Granit. Die
Reise
bedeutet ständiges Lernen. Ohne dass wir einander wirklich
konkret
helfen könnten, wenn wirklich etwas schiefginge, gibt die
Gruppe
unglaubliche Sicherheit. Und das tägliche Nachbesprechen des
Erlebten, das Vorbesprechen des Kommenden, unterstützt die
Fortschritte. Am nahenden Ende der Reise werden diese vier Crews mehr
zu erzählen haben, als sie vermutlich in Worte fassen
können.
Und ich sollte ihnen ein Diplom ausstellen: „Mit dem
Folkeboot in
die Schären – Europas letztes großes
Abenteuer.“
 Wir
hangeln uns noch ein Stündchen durch enge Sunde,
einschließlich der phantastischen Passage des
Kråksundsgap
mit seiner Brandung und den zwei Leuchttürmen. Um Kyrkesund
fahren
wir lieber außenrum. Und dann sind wir auch schon am
nördlichen Punkt der ersten zwei Wochen: Skaboholmen. Wie
Ussholmen ist es eine neue Schäre für Paula und mich.
Wir
segeln zunächst das westliche Becken ab – mit dem
Erfolg,
dass es unter uns knirscht und ich einsehe, dass das hier eher ein
Platz für Motorboote ist. Im schmalen östlichen
Becken finden
wir hingegen, inzwischen unter Motor, einen traumhaften Platz. Und wir
legen einen Anleger hin, der vom Nachbarfelsen mit Beifall bedacht
wird. „Nicht erschrecken, wir werden insgesamt
fünf“,
warne ich die Nachbarn vor. Die sitzen später in Olieses
Cockpit,
weil der eine selbst lange ein Folkeboot hatte und nochmal das
romantische Gefühl an Bord erleben möchte. Es ist ein
sehr
nettes Gespräch über Boote und übers Segeln
in den
Schären. Er zeigt uns auf der Karte die Stelle – sie
liegt
weit draußen, umgeben von tiefem Wasser – wo er
sich
neulich zum ersten Mal in seinem Leben festgesegelt hat. Und wieder
kommt zum Abend hin die Sonne raus.
Wir
hangeln uns noch ein Stündchen durch enge Sunde,
einschließlich der phantastischen Passage des
Kråksundsgap
mit seiner Brandung und den zwei Leuchttürmen. Um Kyrkesund
fahren
wir lieber außenrum. Und dann sind wir auch schon am
nördlichen Punkt der ersten zwei Wochen: Skaboholmen. Wie
Ussholmen ist es eine neue Schäre für Paula und mich.
Wir
segeln zunächst das westliche Becken ab – mit dem
Erfolg,
dass es unter uns knirscht und ich einsehe, dass das hier eher ein
Platz für Motorboote ist. Im schmalen östlichen
Becken finden
wir hingegen, inzwischen unter Motor, einen traumhaften Platz. Und wir
legen einen Anleger hin, der vom Nachbarfelsen mit Beifall bedacht
wird. „Nicht erschrecken, wir werden insgesamt
fünf“,
warne ich die Nachbarn vor. Die sitzen später in Olieses
Cockpit,
weil der eine selbst lange ein Folkeboot hatte und nochmal das
romantische Gefühl an Bord erleben möchte. Es ist ein
sehr
nettes Gespräch über Boote und übers Segeln
in den
Schären. Er zeigt uns auf der Karte die Stelle – sie
liegt
weit draußen, umgeben von tiefem Wasser – wo er
sich
neulich zum ersten Mal in seinem Leben festgesegelt hat. Und wieder
kommt zum Abend hin die Sonne raus.
 Es
ist der vorletzte Tag vor dem Crewwechsel. Allzu weit nach Norden
dürfen wir nicht vordringen, also ist
Hjärterö das
geplante Ziel. Wie immer sprechen wir eine oder zwei Alternativen
durch, denn es gibt eine Einschränkung: Wir segeln bei
Westwind,
doch abends und nachts soll er auf Süd drehen und auffrischen.
Ich
blättere also lange im Ankerplatzführer auf der Suche
nach
Schären, wo wir bei Westwind sicher anlegen und bei
Südwind
ruhig liegen können. Für Hjärterö
gilt: Wir
brauchen es für uns allein. Denn wir müssen in die
kleine,
dreieckige Bucht hinein und uns dann mit Leinen zum anderen Ufer
sichern. Zwar könnte man auch außerhalb der Bucht
vor
Heckanker liegen, aber bei Südwind wird das unruhig, und wenn
die
Heckanker nicht halten, bekommen wir ein gravierendes Problem. Das
Timing ist entscheidend, denn wir dürfen nicht zu
spät
kommen, wenn da schon Andere sich aufs Übernachten
eingerichtet
haben, aber auch nicht zu früh, wenn noch
Tagesausflügler mit
ihren Motoryachten die Sonne und Ruhe genießen.
Es
ist der vorletzte Tag vor dem Crewwechsel. Allzu weit nach Norden
dürfen wir nicht vordringen, also ist
Hjärterö das
geplante Ziel. Wie immer sprechen wir eine oder zwei Alternativen
durch, denn es gibt eine Einschränkung: Wir segeln bei
Westwind,
doch abends und nachts soll er auf Süd drehen und auffrischen.
Ich
blättere also lange im Ankerplatzführer auf der Suche
nach
Schären, wo wir bei Westwind sicher anlegen und bei
Südwind
ruhig liegen können. Für Hjärterö
gilt: Wir
brauchen es für uns allein. Denn wir müssen in die
kleine,
dreieckige Bucht hinein und uns dann mit Leinen zum anderen Ufer
sichern. Zwar könnte man auch außerhalb der Bucht
vor
Heckanker liegen, aber bei Südwind wird das unruhig, und wenn
die
Heckanker nicht halten, bekommen wir ein gravierendes Problem. Das
Timing ist entscheidend, denn wir dürfen nicht zu
spät
kommen, wenn da schon Andere sich aufs Übernachten
eingerichtet
haben, aber auch nicht zu früh, wenn noch
Tagesausflügler mit
ihren Motoryachten die Sonne und Ruhe genießen.
 Die
Strecke ist kurz, also segeln wir noch bis Härön
nordwärts durch die Schären und dann, inklusive einer
kleinen
Kreuz, außenrum zurück nach Süden. Bei
Kyrkesund
fädeln wir uns ins Innenfahrwasser ein, denn den kleinen,
über beide Ufer eines wahrhaft schmalen Sundes verteilten Ort
haben wir gestern ausgelassen. Heute bin ich guter Dinge, diese engste
aller Engen bei Westwind auf Südkurs durchsegeln zu
können.
Die
Strecke ist kurz, also segeln wir noch bis Härön
nordwärts durch die Schären und dann, inklusive einer
kleinen
Kreuz, außenrum zurück nach Süden. Bei
Kyrkesund
fädeln wir uns ins Innenfahrwasser ein, denn den kleinen,
über beide Ufer eines wahrhaft schmalen Sundes verteilten Ort
haben wir gestern ausgelassen. Heute bin ich guter Dinge, diese engste
aller Engen bei Westwind auf Südkurs durchsegeln zu
können.
Als wir sie erreichen, sind Oliese, Frieda und Paula beinahe gleichauf,
und eine weitere Yacht kämpft sich neben uns mit Abdeckung,
Winddrehern, gegenläufiger Strömung und
überholenden
Ausflugsdampfern ab. Wir nehmen uns gegenseitig den Wind. Frieda
versucht, am Leeufer mehr Wind einzufangen, gerät dadurch aber
zwangsläufig dem Gegenverkehr in die Quere. Als auch noch die
Fähre zu ihrer fünfzig Meter weiten Reise aufbricht,
startet
Oliese den Motor. Ich mache das Gleiche – er läuft
neunzig
Sekunden, bis wir alle Hürden hinter uns und wieder Wind in
den
Segeln haben. In diesem Fall fühlt sich das Motoren nicht wie
eine
Niederlage an, sondern wie gute Seemannschaft. Frieda zeigt, dass es
geht (glaube ich, vielleicht sind die auch ein Stück motort).
Längst hat Thorsten uns plastisch geschildert, dass das, was
von
außen immer nach eingespielter, an einem Strang ziehender
Crew
aussieht, intern keineswegs immer so harmonisch ist: „Ihr
müsstet mal hören, was bei uns immer los
ist!“ Wenn er
darauf beharrt, sich unter Segeln sicherer zu fühlen und dem
Motor
nicht zu trauen, heißt das von Frau und Tochter bisweilen:
„Nimm die Segel runter! Mach den Motor an!“ Wie
auch immer
sie es diesmal anstellen, sie passieren Kyrkesund, und wir erreichen
Hjärterö.
 Ein
einziges kleines Motorboot liegt in der Bucht, an Land toben Kinder
– die werden wohl kaum übernachten. Ich wittere die
Chance.
Frage die Anderen gar nicht erst, ob sie Lust hätten, zur
nächsten Alternative zu segeln – besser
können wir es
nicht treffen. Paula und ich fahren erneut einen fluffigen Anleger,
allerdings wieder unter Motor. Für einen Versuch unter Segeln
ist
es mit zu windig. Dann begutachte ich die Südseite der kleinen
Bucht. Und was stelle ich fest? Der Fels geht senkrecht tief nach unten
– hier können wir längsseits liegen! Und
zwar so weit
innen, dass der bei frischem Südwind zu erwartende Schwell uns
nicht wird durchschütteln können.
Ein
einziges kleines Motorboot liegt in der Bucht, an Land toben Kinder
– die werden wohl kaum übernachten. Ich wittere die
Chance.
Frage die Anderen gar nicht erst, ob sie Lust hätten, zur
nächsten Alternative zu segeln – besser
können wir es
nicht treffen. Paula und ich fahren erneut einen fluffigen Anleger,
allerdings wieder unter Motor. Für einen Versuch unter Segeln
ist
es mit zu windig. Dann begutachte ich die Südseite der kleinen
Bucht. Und was stelle ich fest? Der Fels geht senkrecht tief nach unten
– hier können wir längsseits liegen! Und
zwar so weit
innen, dass der bei frischem Südwind zu erwartende Schwell uns
nicht wird durchschütteln können.
Ich winke Oliese heran. Es braucht ein bisschen Gekletter, bis sie mit
drei Leinen fest ist, aber dann können die Anderen kommen.
Paula
sammelt noch ihren Heckanker ein und lässt sich dann an ihren
Platz ziehen: Außen im Päckchen. Nachdem das
Motorboot wie
erwartet abgereist ist, bringen wir zwei Leinen zum Nordufer aus, die
das Päckchen auseinanderziehen wie ein Akkordeon und Oliese
von
der Last ihrer Schwestern befreien.
 Die
Badefreunde der Gruppe erkennen sofort, dass Paulas Achterleine eine
prime Slackline abgibt, und studieren eine kleine Choreographie ein.
Ist vielleicht nicht perfekt synchron und ganz bestimmt nicht
olympiareif, aber sie ist ein gutes Beispiel für den
Riesenspaß auch abseits des Segelns, den die Gruppe hatte.
Ich
sehe mir das eine Weile mit Freude an, dann breche ich auf zum
Landgang. Hjärterö ist nämlich meine liebste
Lieblingsschäre. 2011 waren wir zum ersten Mal hier
– da
stand über unserem Liegeplatz ein Stuhl, der mich zu einem
ziemlich einzigartigen Foto inspirierte. Von den Schafen abgesehen,
hatte ich die Insel für mich allein, und es entstanden auch
eine
Menge unveröffentlichter Selbstportraits im Stil griechischer
Heldendarstellungen. 2016 lagen wir hier mit der Rückweggruppe
und
Mitsegler Björn, behütet und geschützt,
während es
vom Skagerrak her gewaltig pustete und eine spektakuläre
Brandung
auf die Felsen und Klüfte eindrosch. Björns
Kommentar:
„Der Westenwind ist ein Schaumschläger.“
Hjärterö ist ziemlich hoch, über vierzig
Meter, und die
Aussicht ist dementsprechend beeindruckend. Das finden auch die
diesjährigen Gäste, die ich, so eindringlich ich
kann, rauf
auf den Felsen schicke.
Die
Badefreunde der Gruppe erkennen sofort, dass Paulas Achterleine eine
prime Slackline abgibt, und studieren eine kleine Choreographie ein.
Ist vielleicht nicht perfekt synchron und ganz bestimmt nicht
olympiareif, aber sie ist ein gutes Beispiel für den
Riesenspaß auch abseits des Segelns, den die Gruppe hatte.
Ich
sehe mir das eine Weile mit Freude an, dann breche ich auf zum
Landgang. Hjärterö ist nämlich meine liebste
Lieblingsschäre. 2011 waren wir zum ersten Mal hier
– da
stand über unserem Liegeplatz ein Stuhl, der mich zu einem
ziemlich einzigartigen Foto inspirierte. Von den Schafen abgesehen,
hatte ich die Insel für mich allein, und es entstanden auch
eine
Menge unveröffentlichter Selbstportraits im Stil griechischer
Heldendarstellungen. 2016 lagen wir hier mit der Rückweggruppe
und
Mitsegler Björn, behütet und geschützt,
während es
vom Skagerrak her gewaltig pustete und eine spektakuläre
Brandung
auf die Felsen und Klüfte eindrosch. Björns
Kommentar:
„Der Westenwind ist ein Schaumschläger.“
Hjärterö ist ziemlich hoch, über vierzig
Meter, und die
Aussicht ist dementsprechend beeindruckend. Das finden auch die
diesjährigen Gäste, die ich, so eindringlich ich
kann, rauf
auf den Felsen schicke.
 Paula
als Außenliegerin - das ist neu und bedeutet, dass wir als
Erste
ablegen. Bisher habe ich immer die letzte Leine gehalten, dem
Schiffchen – oft unbemerkt von der Crew - eine kleine Drehung
oder ein bisschen Schwung verpasst. Nach zwei Wochen traue ich den
Gästen – jedenfalls diesen Gästen
– ohne Bedenken
zu, dass sie ohne meine Hilfestellung und klugen Ratschläge
vom
Felsen loskommen. Paula und ich setzen Segel und legen ab. Beobachten
noch, wie Salty uns folgt, dann räumen wir die Bucht und
segeln
unsere Warteschleifen im angrenzenden nördlichen Becken.
Nördlich, weil wir bei Südwind nicht durch das
inzwischen
gefürchtete „Jungfrauenloch“ segeln
können, aber
auch nicht motoren wollen. Und wir haben es nicht eilig – im
chronisch vollen Marstrand habe ich Liegeplätze reserviert,
und
alle werden bis Samstag bleiben. Aus der Wunderwelt der Felsen
nähern wir uns langsam – im Marstrands Fjord
müssen wir
kreuzen, und der Wind schwächelt – aber unaufhaltsam
dem
quirligen Treiben im Hafen und auf der Promenade. Erste Vorzeichen sind
die grimmige Festung, eine belebte Badestelle, die ersten
Häuser
– und schließlich die vollen Stege und Dutzende von
Yachten
auf der Suche nach freien Liegeplätzen.
Paula
als Außenliegerin - das ist neu und bedeutet, dass wir als
Erste
ablegen. Bisher habe ich immer die letzte Leine gehalten, dem
Schiffchen – oft unbemerkt von der Crew - eine kleine Drehung
oder ein bisschen Schwung verpasst. Nach zwei Wochen traue ich den
Gästen – jedenfalls diesen Gästen
– ohne Bedenken
zu, dass sie ohne meine Hilfestellung und klugen Ratschläge
vom
Felsen loskommen. Paula und ich setzen Segel und legen ab. Beobachten
noch, wie Salty uns folgt, dann räumen wir die Bucht und
segeln
unsere Warteschleifen im angrenzenden nördlichen Becken.
Nördlich, weil wir bei Südwind nicht durch das
inzwischen
gefürchtete „Jungfrauenloch“ segeln
können, aber
auch nicht motoren wollen. Und wir haben es nicht eilig – im
chronisch vollen Marstrand habe ich Liegeplätze reserviert,
und
alle werden bis Samstag bleiben. Aus der Wunderwelt der Felsen
nähern wir uns langsam – im Marstrands Fjord
müssen wir
kreuzen, und der Wind schwächelt – aber unaufhaltsam
dem
quirligen Treiben im Hafen und auf der Promenade. Erste Vorzeichen sind
die grimmige Festung, eine belebte Badestelle, die ersten
Häuser
– und schließlich die vollen Stege und Dutzende von
Yachten
auf der Suche nach freien Liegeplätzen.
 „Marstrand
ist wirklich ein toller Ort für den Crewwechsel“,
findet
Annia. Und sie meint nicht, dass es per Bus von Göteborg gut
erreichbar ist und alle nötigen Möglichkeiten der
Versorgung
bietet. Sie meint vor allem, dass ihr angesichts des pulsierenden
Lebens hier schlagartig bewusst wird, dass die tolle Reise hier endet.
Und dass das auch gut und stimmig ist. Unser erster Weg nach dem
Aufklaren führt uns zum traumhaften Konditor, um uns durch
schwedische Köstlichkeiten aus Blätterteig zu
knabbern.
Unterwegs sammeln wir die Crew von Folkeboot Lotte auf, mit der ich
mich locker hier verabredet habe. Special Agent Oliese setzt uns
über zur Tankstelle – die neue Gruppe erwartet mit
Recht
vollgetankte Boote. Der Verbrauch begeistert mich: Was noch in den
Kanistern ist, reicht, um die Tanks randvoll zu machen. Wir sind
wahrhaft wenig motort.
„Marstrand
ist wirklich ein toller Ort für den Crewwechsel“,
findet
Annia. Und sie meint nicht, dass es per Bus von Göteborg gut
erreichbar ist und alle nötigen Möglichkeiten der
Versorgung
bietet. Sie meint vor allem, dass ihr angesichts des pulsierenden
Lebens hier schlagartig bewusst wird, dass die tolle Reise hier endet.
Und dass das auch gut und stimmig ist. Unser erster Weg nach dem
Aufklaren führt uns zum traumhaften Konditor, um uns durch
schwedische Köstlichkeiten aus Blätterteig zu
knabbern.
Unterwegs sammeln wir die Crew von Folkeboot Lotte auf, mit der ich
mich locker hier verabredet habe. Special Agent Oliese setzt uns
über zur Tankstelle – die neue Gruppe erwartet mit
Recht
vollgetankte Boote. Der Verbrauch begeistert mich: Was noch in den
Kanistern ist, reicht, um die Tanks randvoll zu machen. Wir sind
wahrhaft wenig motort.
Abends – ich sitze gerade mit Björn und Robert
zusammen und
empfehle ihnen Schären für die nächsten Tage
–
kommt Oliver Berking im Tuckerboot vorbei und interessiert sich
brennend für meine Flotte und das, was wir hier machen. Und ob
wir
seine Werft in Flensburg kennen. Ich speise ihn einigermaßen
knapp ab, denn die Gäste sitzen in einer Kneipe und haben mir
schon ein Bier bestellt. Es ist unser letzter gemeinsamer Abend, und
sie waren so großartig, dass es das Mindeste ist, jetzt
endlich
im Galopp dort aufzuschlagen.
Als ich eintreffe, bin ich einigermaßen gerührt: Als
Dankeschön für die Organisation, meinen Eifer,
bisweilen
meine Geduld, und überhaupt für den unglaublichen
Urlaub
bekomme ich ein üppiges Trinkgeld, mit Bordmitteln zu einem
Orden
umgestaltet. Und meine Getränke gehen
selbstverständlich auf
Kosten der Gruppe. Nicht erst jetzt weiß ich, dass ich sie
alle
vermissen werde, sobald sie im Laufe des Vormittags abgereist sind.
Aber es wird keine Zeit sein, darüber nachzudenken: Mit den
neuen
Gästen kommt die Herausforderung, sie fit zu machen
für die
Schären. Bei Windstärke 6...
weiter: "Raus
aus der Komfortzone" - Ein wildes Abenteuer, Teil 2

