| Paulas Törnberichte | 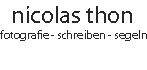 |
|||||
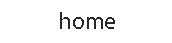 |
 |
 |
 |
 |

|
|
|
|
||||||

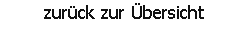
"Raus aus der Komfortzone" - Ein wildes
Abenteuer, Teil zwei
Die Boote sind betankt. So gut wie angesichts der
Wasserknappheit möglich gesäubert. Die
Vollständigkeit der Ausrüstung ist kontrolliert.
Paulas Proviant ist vervollständigt, ich bin frisch geduscht
und rasiert und dank ausgiebigem Schlaf, wann immer es möglich
war, einigermaßen ausgeruht. Die Nervosität steigt.
Ist es wirklich wahr, dass die vertrauten Gäste nun abreisen
und neue kommen, die ab morgen unfallfrei durch die Schären
segeln sollen? Der Wind passt ganz herrlich: Ist ja nur
Windstärke 6...
Juli/August
2018
 Nach
und nach treffen die neuen Crews ein. Bekannte Gesichter, und sei es
nur vom Vortreffen im Februar oder einem verregneten, pustigen, kalten
Tag Skippertraining Anfang Mai, an dem wir leider viel zu wenig tun
konnten, um die einzige Crew, die noch nie Folkeboot gesegelt ist,
wirklich fit zu machen. Julia und Claudia werden ein bisschen zu
kämpfen haben, das steht bereits fest. Aber in gewisser Weise
gilt
das für uns alle.
Nach
und nach treffen die neuen Crews ein. Bekannte Gesichter, und sei es
nur vom Vortreffen im Februar oder einem verregneten, pustigen, kalten
Tag Skippertraining Anfang Mai, an dem wir leider viel zu wenig tun
konnten, um die einzige Crew, die noch nie Folkeboot gesegelt ist,
wirklich fit zu machen. Julia und Claudia werden ein bisschen zu
kämpfen haben, das steht bereits fest. Aber in gewisser Weise
gilt
das für uns alle.
Denn anstatt sich langsam heranzutasten an diese ungewohnte,
anspruchsvolle Umgebung, starten die „Neuen“ mitten
im
engsten, kniffligsten Teil der wunderschönen, bedrohlichen
Felsenwelt. Erwartungsvoll haben sie die lange Anreise hinter sich
gebracht, per SMS noch angeboten, von der Fähre zollfreies
Bier
mitzubringen – dann haben sie sich zum Teil noch mit ihren
Vorgängercrews die Klinke in die Hand gegeben und unredigierte
Erlebnisberichte des Hinwegs zu hören bekommen.
Äußerlich ruhig, ist doch jeder und jedem die
wachsende
Anspannung anzusehen.
Es gilt, ein Mindestmaß an Einweisung und
Eingewöhnung zu
gewährleisten und gleichzeitig einen baldmöglichen
Absprung
aus dem quirligen Hafen zu schaffen. Unser bewährter
Zaubertrick
besteht in kleinen Runden um den Pudding inklusive einer Kreuz durch
unbetonntes Terrain zwischen kleinen, großen und unsichtbaren
Felsen mit mir als Skipper – danach sollten alle sowohl das
Boot
im Griff, als auch einen Blick für die Herausforderungen des
Reviers entwickelt haben.
 Zweimal
laufen wir aus, Samstagnachmittag und Sonntagmorgen, jeweils mit der
Hälfte der Gruppe. Gerne hätte ich das bei angenehmen
drei
bis vier Windstärken gemacht. Doch die Realität
lautet
fünf bis sechs. Didaktisch lässt sich alles
schönreden,
selbst das – der Hinweg lässt
grüßen: Wer diese
Tour überstanden hat, ist anschließend durch nichts
mehr zu
schocken. Als alle Boote klar zum endgültigen Auslaufen sind,
habe
ich ein zusätzliches Problem: Fürs Kattegat sind 5-6,
fürs Skagerrak eine stramme 7 angekündigt. Die Grenze
zwischen den beiden Seegebieten verläuft geradewegs durch den
Fjord nördlich von Marstrand. Und ich habe inzwischen
verstanden,
dass das trotz seiner an afrikanische Kolonialgrenzen erinnernden
Geradlinigkeit nicht nur ein willkürlicher Strich auf der
Seekarte
ist, sondern dass hier Prozesse der Natur eine Rolle spielen. Skagerrak
und Kattegat gehen vielleicht gelegentlich allmählich und
fließend ineinander über. Doch manchmal, zum
Beispiel heute,
ist der Übergang abrupt.
Zweimal
laufen wir aus, Samstagnachmittag und Sonntagmorgen, jeweils mit der
Hälfte der Gruppe. Gerne hätte ich das bei angenehmen
drei
bis vier Windstärken gemacht. Doch die Realität
lautet
fünf bis sechs. Didaktisch lässt sich alles
schönreden,
selbst das – der Hinweg lässt
grüßen: Wer diese
Tour überstanden hat, ist anschließend durch nichts
mehr zu
schocken. Als alle Boote klar zum endgültigen Auslaufen sind,
habe
ich ein zusätzliches Problem: Fürs Kattegat sind 5-6,
fürs Skagerrak eine stramme 7 angekündigt. Die Grenze
zwischen den beiden Seegebieten verläuft geradewegs durch den
Fjord nördlich von Marstrand. Und ich habe inzwischen
verstanden,
dass das trotz seiner an afrikanische Kolonialgrenzen erinnernden
Geradlinigkeit nicht nur ein willkürlicher Strich auf der
Seekarte
ist, sondern dass hier Prozesse der Natur eine Rolle spielen. Skagerrak
und Kattegat gehen vielleicht gelegentlich allmählich und
fließend ineinander über. Doch manchmal, zum
Beispiel heute,
ist der Übergang abrupt.
 Bleiben
ist keine Option: Die Gäste sind nicht angereist, um in einem
vollen, lauten Hafen auf passenden Wind zu warten. Das müssten
wir
bei Sturm machen, aber nicht, solange man irgendwie unfallfrei segeln
kann. Zudem läuft die Reservierung unserer Plätze
aus, wir
müssten uns neue suchen, aber der Hafen wirkt voll, voll und
vor
allem voll. Nach Süden geht auch nicht: In diese Richtung
müssen wir früh genug sowieso, aber die
schönsten
Stellen der Gegend liegen im Norden – dort wo es tierisch
pustet.
Das Revier selbst bietet eine Lösung für dieses
Dilemma:
Anders als die Stockholmer Schären ist das Felsenrevier an der
schwedischen Westküste ein relativ schmaler Streifen. Es gibt
im
Grunde ein einziges Fahrwasser in Nord-Süd-Richtung, die
Alternative besteht darin, außen im offenen Wasser zu segeln.
Es
gibt aber auch zwei große Inseln, Tjörn und Orust,
die den
Schären nach- und dem Festland vorgelagert sind. Hinter den
Inseln
führt ein breites, geschütztes Fahrwasser zur
Industriestadt
Uddevalla, zwischen ihnen der Stig Fjord zurück zu den
schroffen,
kargen Außenschären. Bei normalem, moderatem Wind
würde
ich diesen Weg nicht in Betracht ziehen – hier stehen lauter
liebliche Bäume wie im Harz, und von der netten, kleinen Brise
kommt kaum etwas an. Ein Abstecher in diese Innenschären
nördlich von Orust vor sieben Jahren war entsprechend
enttäuschend – viel Motorbootfahren und wenig
Begeisterung
ob der Landschaft.
Bleiben
ist keine Option: Die Gäste sind nicht angereist, um in einem
vollen, lauten Hafen auf passenden Wind zu warten. Das müssten
wir
bei Sturm machen, aber nicht, solange man irgendwie unfallfrei segeln
kann. Zudem läuft die Reservierung unserer Plätze
aus, wir
müssten uns neue suchen, aber der Hafen wirkt voll, voll und
vor
allem voll. Nach Süden geht auch nicht: In diese Richtung
müssen wir früh genug sowieso, aber die
schönsten
Stellen der Gegend liegen im Norden – dort wo es tierisch
pustet.
Das Revier selbst bietet eine Lösung für dieses
Dilemma:
Anders als die Stockholmer Schären ist das Felsenrevier an der
schwedischen Westküste ein relativ schmaler Streifen. Es gibt
im
Grunde ein einziges Fahrwasser in Nord-Süd-Richtung, die
Alternative besteht darin, außen im offenen Wasser zu segeln.
Es
gibt aber auch zwei große Inseln, Tjörn und Orust,
die den
Schären nach- und dem Festland vorgelagert sind. Hinter den
Inseln
führt ein breites, geschütztes Fahrwasser zur
Industriestadt
Uddevalla, zwischen ihnen der Stig Fjord zurück zu den
schroffen,
kargen Außenschären. Bei normalem, moderatem Wind
würde
ich diesen Weg nicht in Betracht ziehen – hier stehen lauter
liebliche Bäume wie im Harz, und von der netten, kleinen Brise
kommt kaum etwas an. Ein Abstecher in diese Innenschären
nördlich von Orust vor sieben Jahren war entsprechend
enttäuschend – viel Motorbootfahren und wenig
Begeisterung
ob der Landschaft.
 Heute
jedoch brauchen wir ein geschütztes Fahrwasser, und der Hake
Fjord
östlich von Tjörn ist genau das Richtige. Auf dem Weg
dorthin
müssen wir im Marstrands Fjord kurzzeitig Höhe
laufen, nasse
Füße inklusive – danach ist es kommodes
Segeln auf
Raumschotskurs. Die Landschaft ist zunächst
unspektakulär,
weil der Fjord so breit und reizlos ist, aber zuletzt finden wir uns
dann doch zwischen idyllischen Kiefernwäldchen und
hübschen
Holzhäusern wieder und steuern Almösund an
– Tipp von
Folkeboot Lotte, die uns dort schon erwartet.
Heute
jedoch brauchen wir ein geschütztes Fahrwasser, und der Hake
Fjord
östlich von Tjörn ist genau das Richtige. Auf dem Weg
dorthin
müssen wir im Marstrands Fjord kurzzeitig Höhe
laufen, nasse
Füße inklusive – danach ist es kommodes
Segeln auf
Raumschotskurs. Die Landschaft ist zunächst
unspektakulär,
weil der Fjord so breit und reizlos ist, aber zuletzt finden wir uns
dann doch zwischen idyllischen Kiefernwäldchen und
hübschen
Holzhäusern wieder und steuern Almösund an
– Tipp von
Folkeboot Lotte, die uns dort schon erwartet.
 Für
den Auftakt war das, den Umständen geschuldet aber auch
ansonsten,
nicht schlecht. Der zweite Tag ist so ziemlich das Kontrastreichste,
das ein Segeltag bieten kann: Wir laufen aus. Relativ früh,
gegen
acht. Für Lotte ist das zu doll, Björn und Robert
sind gerade
beim ersten Kaffee. Kein Schiff weit und breit, keine Menschenseele auf
dem Wasser. Der ruppige Südwest nimmt allmählich erst
ab,
doch vorläufig befinden wir uns noch in der Abdeckung. Die
erste
kleine Kreuz führt uns in den kanalartig engen
Skåpesund. Er
lässt sich überraschend gut segeln, auch dank der
mitlaufenden Strömung. Es folgt eine unvergesslich tolle,
beinahe
unübertreffliche Kreuz durch den Stig Fjord: Wenig Verkehr,
wenig
Unterwasserfelsen, die Schären sind alle groß und
leicht
zuzuordnen, keine tückischen Unterwasserhindernisse, die
Orientierung fällt also leicht.
Für
den Auftakt war das, den Umständen geschuldet aber auch
ansonsten,
nicht schlecht. Der zweite Tag ist so ziemlich das Kontrastreichste,
das ein Segeltag bieten kann: Wir laufen aus. Relativ früh,
gegen
acht. Für Lotte ist das zu doll, Björn und Robert
sind gerade
beim ersten Kaffee. Kein Schiff weit und breit, keine Menschenseele auf
dem Wasser. Der ruppige Südwest nimmt allmählich erst
ab,
doch vorläufig befinden wir uns noch in der Abdeckung. Die
erste
kleine Kreuz führt uns in den kanalartig engen
Skåpesund. Er
lässt sich überraschend gut segeln, auch dank der
mitlaufenden Strömung. Es folgt eine unvergesslich tolle,
beinahe
unübertreffliche Kreuz durch den Stig Fjord: Wenig Verkehr,
wenig
Unterwasserfelsen, die Schären sind alle groß und
leicht
zuzuordnen, keine tückischen Unterwasserhindernisse, die
Orientierung fällt also leicht.
 Paula
ist als Letzte gestartet, und die Charterboote sind gut unterwegs,
obwohl Feintrimm das letzte sein dürfte, auf das die
Gäste an
ihrem zweiten Reisetag ein Auge haben. Ausgerechnet die sonst immer so
schnelle Frieda ist die Erste, die wir einholen. Als nächste
Oliese, die sich im weiteren Verlauf des Tages aber nicht
abschütteln lässt. Der Stig Fjord ist ein echter
Geheimtipp
für jeden, der einen traumhaften Segelvormittag verbringen
möchte!
Paula
ist als Letzte gestartet, und die Charterboote sind gut unterwegs,
obwohl Feintrimm das letzte sein dürfte, auf das die
Gäste an
ihrem zweiten Reisetag ein Auge haben. Ausgerechnet die sonst immer so
schnelle Frieda ist die Erste, die wir einholen. Als nächste
Oliese, die sich im weiteren Verlauf des Tages aber nicht
abschütteln lässt. Der Stig Fjord ist ein echter
Geheimtipp
für jeden, der einen traumhaften Segelvormittag verbringen
möchte!
Bei Smögholmarna müssen wir uns entscheiden zwischen
dem
vereinbarten Weg nördlich herum und dem offiziellen, bei dem
inzwischen auf West gedrehten Wind durchaus günstigeren, aber
längeren Weg südlich herum um das Felsenarchipel.
Martha ist
außer Sichtweite den nördlichen Weg gefahren und hat
den
Motor zu Hilfe genommen. Salty wählt den südlichen
Weg,
Oliese ebenso. Wir verpassen beinahe die Abzweigung, entscheiden uns
aber doch für die nördliche Route. Frieda folgt uns
vertrauensvoll.
 Smögholmarna
ist ein Schärenliegeplatz, der es in sich hat. Oben auf diesem
Felsen habe ich schon gestanden, senkrecht über den wie wir
jetzt
vorbeifahrenden Schiffen, und es bedauert, dass ich keine Kirschen
dabeihatte, deren Steine ich schön den Leuten aufs Deck
hätte
spucken können. Senkrecht hoch auf der einen Seite, halbwegs
Platz
auf der anderen – das ist ja halb so schlimm. Doch ausgangs
des
Fjordes liegen an Backbord, kaum mehr als zwanzig Meter von der
Steilwand entfernt, drei flache Felsen in einer Reihe. Da
müssen
wir durch. Und der Wind steht so, dass wir den passenden Kurs gerade so
nicht laufen können. Ich denke an
Hjärterösund:
Fünf Wenden auf fünfzig Metern. Jetzt also zwei
Wenden auf
zwanzig Metern. Bevor wir den Heimathafen erreichen, werden auch zehn
Wenden auf achtzig Metern ausgangs der Dyvig kein gravierendes Problem
darstellen. Also fahren wir einfach durch. Meine Sorge gilt auch
weniger Paula und mir als der nachfolgenden Frieda – doch es
besteht kein Grund: Ein Folkeboot ist eine Jolle mit einer Tonne
Ballast, und Claus und Steffi haben das längst verstanden.
Souverän kreuzen sie durch die Engstelle.
Smögholmarna
ist ein Schärenliegeplatz, der es in sich hat. Oben auf diesem
Felsen habe ich schon gestanden, senkrecht über den wie wir
jetzt
vorbeifahrenden Schiffen, und es bedauert, dass ich keine Kirschen
dabeihatte, deren Steine ich schön den Leuten aufs Deck
hätte
spucken können. Senkrecht hoch auf der einen Seite, halbwegs
Platz
auf der anderen – das ist ja halb so schlimm. Doch ausgangs
des
Fjordes liegen an Backbord, kaum mehr als zwanzig Meter von der
Steilwand entfernt, drei flache Felsen in einer Reihe. Da
müssen
wir durch. Und der Wind steht so, dass wir den passenden Kurs gerade so
nicht laufen können. Ich denke an
Hjärterösund:
Fünf Wenden auf fünfzig Metern. Jetzt also zwei
Wenden auf
zwanzig Metern. Bevor wir den Heimathafen erreichen, werden auch zehn
Wenden auf achtzig Metern ausgangs der Dyvig kein gravierendes Problem
darstellen. Also fahren wir einfach durch. Meine Sorge gilt auch
weniger Paula und mir als der nachfolgenden Frieda – doch es
besteht kein Grund: Ein Folkeboot ist eine Jolle mit einer Tonne
Ballast, und Claus und Steffi haben das längst verstanden.
Souverän kreuzen sie durch die Engstelle.
 Auf
dem Weg nach Mollösund fädeln wir uns ins
Haupt-Schärenfahrwasser ein – zufällig
genau hinter
Salty. Nächster bemerkenswerter Wegpunkt ist eine rote
Fahrwassertonne, die vermutlich jeder kennt, der in dieser Gegend
unterwegs war: Auf Nordwestkurs haben wir an Backbord eine
große
Schäre. Extrem dicht unter Land liegt die Tonne. Ein
Stück
weiter östlich steht eine Bake. Die Intuition des
Ortsunkundigen
sagt unmissverständlich: Du musst zwischen Tonne und Bake
durchfahren. Wer dem Fahrwasser schon länger folgt, hat
inzwischen
Gegenteiliges begriffen: Grüne Tonnen bleiben an Backbord,
rote
Tonnen an Steuerbord. Gleiches verrät die Seekarte, und auf
die
Symbole für die Betonnungsrichtung habe ich aus gutem Grund
schon
mehrfach hingewiesen. Doch wir sind gerade erst ins Fahrwasser
eingelaufen, dies ist die erste Tonne, der wir begegnen.
Während
ich meiner Erfahrung folge - Paula und ich fahren zum ungefähr
zehnten Mal durch diese Rinne - vertraut die Salty-Crew ihrer
Intuition.
Auf
dem Weg nach Mollösund fädeln wir uns ins
Haupt-Schärenfahrwasser ein – zufällig
genau hinter
Salty. Nächster bemerkenswerter Wegpunkt ist eine rote
Fahrwassertonne, die vermutlich jeder kennt, der in dieser Gegend
unterwegs war: Auf Nordwestkurs haben wir an Backbord eine
große
Schäre. Extrem dicht unter Land liegt die Tonne. Ein
Stück
weiter östlich steht eine Bake. Die Intuition des
Ortsunkundigen
sagt unmissverständlich: Du musst zwischen Tonne und Bake
durchfahren. Wer dem Fahrwasser schon länger folgt, hat
inzwischen
Gegenteiliges begriffen: Grüne Tonnen bleiben an Backbord,
rote
Tonnen an Steuerbord. Gleiches verrät die Seekarte, und auf
die
Symbole für die Betonnungsrichtung habe ich aus gutem Grund
schon
mehrfach hingewiesen. Doch wir sind gerade erst ins Fahrwasser
eingelaufen, dies ist die erste Tonne, der wir begegnen.
Während
ich meiner Erfahrung folge - Paula und ich fahren zum ungefähr
zehnten Mal durch diese Rinne - vertraut die Salty-Crew ihrer
Intuition.
Ich greife zur Funke und rufe Salty. Claudia meldet sich. Ich halte
mich kurz und knapp: „Die rote Tonne bleibt an Steuerbord,
ne?“ Die Reaktion geht darin unter, dass ich mich an einer
größeren, schnelleren, dusseligeren Yacht
abzuarbeiten habe,
die in Luv vorbeziehen könnte, dann aber in Lee vergeblich zu
überholen versucht und uns schließlich aus dem Kurs
drängt, weil auch sie erst im letzten Moment den Sinn der
roten
Tonne begreift. Salty jedenfalls fährt einen Schlenker, und
die
Crew ist tagelang untröstlich, weil sie ohne meinen Hinweis
einen
gravierenden Fehler begangen hätte. Wobei ich gar nicht sicher
weiß, sondern nur vermute, dass zwischen Tonne und Bake ein
Felsen lauert, auf dem schon manche Yacht hängengeblieben ist.
 Das
ist aber nur der Auftakt – nach der unbeschwerten Kreuz im
leeren
Stig Fjord ist hier ein Verkehr, wie ich ihn noch nie erlebt habe.
Dutzende von Motor- und Segelyachten bahnen sich in beiden Richtungen
einen beschwerlichen Weg durch ein stellenweise nur fünfzig
Meter
breites Fahrwasser. Zur Krönung stochert sich auch noch ein
Minensuchboot der schwedischen Marine durch dieses Chaos. Marthas Crew
wird seekrank – bei mäßigem Wind in vor
Seegang
geschütztem Terrain. Der Schwell der Motorboote, immer nervig
und
ärgerlich, ist heute wirklich kaum zu ertragen.
Das
ist aber nur der Auftakt – nach der unbeschwerten Kreuz im
leeren
Stig Fjord ist hier ein Verkehr, wie ich ihn noch nie erlebt habe.
Dutzende von Motor- und Segelyachten bahnen sich in beiden Richtungen
einen beschwerlichen Weg durch ein stellenweise nur fünfzig
Meter
breites Fahrwasser. Zur Krönung stochert sich auch noch ein
Minensuchboot der schwedischen Marine durch dieses Chaos. Marthas Crew
wird seekrank – bei mäßigem Wind in vor
Seegang
geschütztem Terrain. Der Schwell der Motorboote, immer nervig
und
ärgerlich, ist heute wirklich kaum zu ertragen.
Es ist Horror für die Einen, großes Kino
für die
Anderen. Oliese fährt bestens ausgetrimmt an der
überladenen
Paula vorbei. Die Crew hat großen Spaß. Ich mache
die
Schoten ein bisschen auf, stelle den Traveller ein, nutze, als Oli
keinen Wind hat, die Chance: Paula überholt. Dann liegt Oli
wieder
vorne. So geht es weiter, bis wir uns der engsten aller Engstellen
nähern, auf die eine kleine Kreuz zum nächsten
schmalen Sund
folgen wird. Eben hat uns eine Vierzigfußyacht
überholt. Ich
lasse dreimal die Großschot sausen, um nicht ausgerechnet
hier
wieder neben Oli aufzukommen. Das gelingt jedoch unverhofft einer
kleineren schwedischen Yacht. Eine Handvoll Motorboote quält
sich
rechts und links vorbei. Die Vierzigfußyacht beginnt
– Hut
ab! – zu kreuzen.
Wir wenden. Befinden uns in Lee, aber zwei Bootslängen vor
Oliese.
Und die sich in Lee, zwei Bootslängen vor den Schweden. Was
natürlich dazu führt, dass wir als Erste wenden
müssen,
aber nicht ohne Weiteres können. Mit Oliese klappt die
Verständigung durch Rufen. Mit den Schweden: Per Handzeichen.
Allerfeinste Seemannschaft, wunderbares Miteinander: die Schweden
wenden, Oliese wendet, Paula wendet, und mit den nächsten
Motorbötchen kommen wir auch irgendwie klar.
 Unser
Tagesziel: Vasholmarna, eine fabulöse
Außenschäre mit
sagenhafter Aussicht, außerdem einer der südlichsten
Ausläufer des roten Granits, der senkrecht abfällt,
so dass
man an vielen Stellen längsseits gehen kann. Paula und ich
sind
zum dritten Mal hier. 2012 war es bei schönstem Wetter
rappelvoll,
wir probierten zunächst einen prekären Liegeplatz und
verholten dann zu einer der kleineren Inseln des Archipels, wo wir zwar
längsseits gehen konnten, aber das Schlauchboot als Fender
unter
den Felsen stopfen mussten und ich nur per Strickleiter von Bord kam.
2016, mit den Charteryachten im Gefolge, waren wir bei bedecktem
Himmel, fröstelnder Kälte und 6-7
Windstärken die
Einzigen, die sich hier her wagten. Wir wehten prompt zwei Tage ein,
machten es uns nett, indem wir eine Seilfähre zur Hauptinsel
bauten – doch zuvor mussten wir ja erst anlegen. Für
mich
und Paula war das zu gewagt, damals schickten wir die kundige
Frieda-Crew vor.
Unser
Tagesziel: Vasholmarna, eine fabulöse
Außenschäre mit
sagenhafter Aussicht, außerdem einer der südlichsten
Ausläufer des roten Granits, der senkrecht abfällt,
so dass
man an vielen Stellen längsseits gehen kann. Paula und ich
sind
zum dritten Mal hier. 2012 war es bei schönstem Wetter
rappelvoll,
wir probierten zunächst einen prekären Liegeplatz und
verholten dann zu einer der kleineren Inseln des Archipels, wo wir zwar
längsseits gehen konnten, aber das Schlauchboot als Fender
unter
den Felsen stopfen mussten und ich nur per Strickleiter von Bord kam.
2016, mit den Charteryachten im Gefolge, waren wir bei bedecktem
Himmel, fröstelnder Kälte und 6-7
Windstärken die
Einzigen, die sich hier her wagten. Wir wehten prompt zwei Tage ein,
machten es uns nett, indem wir eine Seilfähre zur Hauptinsel
bauten – doch zuvor mussten wir ja erst anlegen. Für
mich
und Paula war das zu gewagt, damals schickten wir die kundige
Frieda-Crew vor.
Heute ist das Wetter traumhaft, der Naturhafen entsprechend
gefüllt, und uns bleibt genau die Stelle, die ich bei
ähnlicher Windrichtung vor sechs Jahren prekär und
unsicher
fand. Das Anlegen hat damals gut geklappt, jetzt ist es zumindest
für Fortgeschrittene. Der Wind weht parallel zum Ufer, und der
steil abfallende Felsen bildet lauter kleine Nischen. Da ist ein
flaches Podest, wo ich aussteigen, zwei Springs halten und auf die
Fender vertrauen kann, aber für Vor- und Achterleine muss man
klettern. Ich rufe über Funk Oliese.
 Eigentlich
wäre Oli mit der einzigen Dreiercrew prädestiniert,
als erste
hier festzumachen. Aber es ist unsere erste Schäre –
die
Crew, so fit sie seglerisch und seemännisch ist, wäre
damit
wohl überfordert. Der Plan ist also eher, dass Rolf zu uns
übersteigt, damit wir immerhin zu zweit sind. Doch erst
müssen die die Segel bergen, und darüber verliere ich
die
Geduld. Paula findet: Versuchen wir es einfach.
Eigentlich
wäre Oli mit der einzigen Dreiercrew prädestiniert,
als erste
hier festzumachen. Aber es ist unsere erste Schäre –
die
Crew, so fit sie seglerisch und seemännisch ist, wäre
damit
wohl überfordert. Der Plan ist also eher, dass Rolf zu uns
übersteigt, damit wir immerhin zu zweit sind. Doch erst
müssen die die Segel bergen, und darüber verliere ich
die
Geduld. Paula findet: Versuchen wir es einfach.
Der Versuch gelingt. Sofern man das Resultat – Heckanker
nicht
durchgeholt, Springs nur auf den Felsen gelegt, daneben Hammer und
Schärenhaken, im Galopp eine Vorleine ausgebracht, die ich
aber
nicht belegen kann, weil ich Paula im Schwell beständig
austarieren muss, damit die Fender und nicht die unabgefenderte
Bordwand am Stein scheuern, und meinen Platz deshalb nicht mehr
verlassen kann – als gelungenen Versuch bewerten
möchte. Ich
harre aus, bis Oliese herantuckert und Rolf einigermaßen
ratlos
zu Paula an Bord steigt.
Ich dirigiere ihn hierhin und dorthin. Zwischendurch halten wir beide
irgendwo irgendeine Leine, und das Werkzeug, das wir nun beide
bräuchten, liegt unerreichbar auf halben Wege zwischen uns.
Rolf
muss klettern, zehn Meter rauf mit der längsten
verfügbaren
Leine in der Hand, dann zehn Meter runter, bevor ihn ein
Gestrüpp
daran hindert, die Leine an einer Stelle zu belegen, wo sie uns helfen
könnte. Ein Motorboot-Nachbar fängt sie auf und macht
sie
fest. Paula ist einigermaßen gesichert. Und hat nur zwei
kleine
Lackschäden davongetragen. Das steckt sie weg: Einhand in den
Schären geht es nicht ohne, das ist ihr der Spaß
wert.
 Hinter
ihr ist ein etwas leichter abzufendernder Platz, an den sich nun Oliese
legt. Ich klettere. Wir brauchen Rolf, der immer noch und dann schon
wieder klettert. Ein ziemliches Hin und Her über nochmal eine
Viertelstunde, dann macht Oliese einen ganz zufriedenen Eindruck mit
ihrem Liegeplatz. Die Anderen werden hier ins Päckchen gehen.
Tunlichst nicht an Paula, die liegt wirklich präkär
und
gefährdet, sobald etwas der Wind ungünstig dreht oder
sich
ein Schärenhaken löst. Als der Wind im Gegenteil, und
wie
angekündigt und erhofft, günstig dreht, wirkt auch
sie
zufrieden: Endlich einmal nicht innen liegen mit der Last ihrer
Schwestern im Nacken, sondern vor ihnen auf
standesgemäßem
eigenen Platz. Die Gäste regeln das Problem des steilen
Aufstiegs
an Land, indem sie einen schönen Handlauf den Felsen hinauf
organisieren.
Hinter
ihr ist ein etwas leichter abzufendernder Platz, an den sich nun Oliese
legt. Ich klettere. Wir brauchen Rolf, der immer noch und dann schon
wieder klettert. Ein ziemliches Hin und Her über nochmal eine
Viertelstunde, dann macht Oliese einen ganz zufriedenen Eindruck mit
ihrem Liegeplatz. Die Anderen werden hier ins Päckchen gehen.
Tunlichst nicht an Paula, die liegt wirklich präkär
und
gefährdet, sobald etwas der Wind ungünstig dreht oder
sich
ein Schärenhaken löst. Als der Wind im Gegenteil, und
wie
angekündigt und erhofft, günstig dreht, wirkt auch
sie
zufrieden: Endlich einmal nicht innen liegen mit der Last ihrer
Schwestern im Nacken, sondern vor ihnen auf
standesgemäßem
eigenen Platz. Die Gäste regeln das Problem des steilen
Aufstiegs
an Land, indem sie einen schönen Handlauf den Felsen hinauf
organisieren.
Salty kommt als Letzte im ersten und auch im zweiten Anlauf ein
bisschen schwungvoll angeflogen, und der Heckanker hält in
beiden
Fällen nicht. Ich springe an Bord. Das Erste, das ich erfahre:
Skipperin wie Vorschoterin haben noch nie an einem Felsen angelegt,
noch nie im Päckchen gelegen und noch nie geankert. Der Anker
ist
ein kräftiges Indiz: Die Flunken sind weder ausgeklappt, noch
gesichert. Als Salty sich endlich sicher und kuschelig an Martha
schmiegt, hat die Crew erheblich dazugelernt. Und nach Stunden
trüben Wetters mobilisiere ich alle, die noch wach sind, zum
Betrachten des spektakulären Sonnenuntergangs.
 „Wie
– fahren wir etwa schon zurück?“
Gedanklich war ich
selbst schon auf einen ordentlichen Schlag nach Norden eingestellt. In
eine Gegend, in die Paula und ich es ein einziges Mal geschafft haben,
und das ist sechs Jahre her. Die Wetterinseln sollten es sein, oder
wenigstens das unübertrefflich schöne Alvö.
Wenn nicht
gar Süd-Koster. Aber zumindest noch einen Tag nach Norden zu
einer
neuen Schäre. Doch die Windprognose für die
nächste
Woche ist flautig und tendenziell südlich. „Wenn wir
heute
zwanzig Meilen nach Norden segeln“, rechne ich der kritischen
Fragerin vor, „und gleichzeitig keine zwanzig Meilen nach
Süden – dann haben wir hinterher vierzig Meilen
zusätzlich vor der Brust.“ Ich kann die
Gäste aber
beruhigen: Wir werden uns langsam durch die Schären hangeln,
so
lange wie möglich dort bleiben – und
anschließend
kommt keineswegs der beschwerliche Weg, der mir meine Boote nach Hause
bringt, sondern der zweite, im Charakter ganz andere, aber genauso
spannende Teil der Abenteuerreise. Am Ende wird sich herausstellen,
dass die Entscheidung, genau hier umzukehren, eine weitere Punktlandung
ist.
„Wie
– fahren wir etwa schon zurück?“
Gedanklich war ich
selbst schon auf einen ordentlichen Schlag nach Norden eingestellt. In
eine Gegend, in die Paula und ich es ein einziges Mal geschafft haben,
und das ist sechs Jahre her. Die Wetterinseln sollten es sein, oder
wenigstens das unübertrefflich schöne Alvö.
Wenn nicht
gar Süd-Koster. Aber zumindest noch einen Tag nach Norden zu
einer
neuen Schäre. Doch die Windprognose für die
nächste
Woche ist flautig und tendenziell südlich. „Wenn wir
heute
zwanzig Meilen nach Norden segeln“, rechne ich der kritischen
Fragerin vor, „und gleichzeitig keine zwanzig Meilen nach
Süden – dann haben wir hinterher vierzig Meilen
zusätzlich vor der Brust.“ Ich kann die
Gäste aber
beruhigen: Wir werden uns langsam durch die Schären hangeln,
so
lange wie möglich dort bleiben – und
anschließend
kommt keineswegs der beschwerliche Weg, der mir meine Boote nach Hause
bringt, sondern der zweite, im Charakter ganz andere, aber genauso
spannende Teil der Abenteuerreise. Am Ende wird sich herausstellen,
dass die Entscheidung, genau hier umzukehren, eine weitere Punktlandung
ist.
 Man
ahnt das schon an diesem Tag. Es ist bedeckt, trüb, diesig,
beinahe neblig. Obwohl vom Skagerrak eine beträchtliche
Dünung heranläuft, ist der Südwestwind eher
mau. Das
wird zum Problem, als wir außen um Härmanö
kreuzen, um
nicht im Innenfahrwasser zu motoren – bei tüchtigem
Gestampfe segelt Paula schnell an allen vorbei. Keine Kunst –
wir
haben mit Abstand die meiste Erfahrung darin, bei viel Welle und wenig
Wind einen guten Kompromiss aus Höhe und Fahrt zu finden, und
unser Trimm dürfte auch gelungener sein als der der sich erst
allmählich einsegelnden Gäste. Oliese und Martha
halten
ausgezeichnet mit. Frieda kämpft wacker. Salty ist von Beginn
an
hintenan und später kaum noch zu sehen. Genau die gleiche
Kreuz
bei identischen Bedingungen hatten wir vor zwei Jahren auch schon. Da
war die Oliese-Crew überfordert – Paula musste nach
zweistündiger Kreuz am vereinbarten Treffpunkt eineinhalb
Stunden
warten!
Man
ahnt das schon an diesem Tag. Es ist bedeckt, trüb, diesig,
beinahe neblig. Obwohl vom Skagerrak eine beträchtliche
Dünung heranläuft, ist der Südwestwind eher
mau. Das
wird zum Problem, als wir außen um Härmanö
kreuzen, um
nicht im Innenfahrwasser zu motoren – bei tüchtigem
Gestampfe segelt Paula schnell an allen vorbei. Keine Kunst –
wir
haben mit Abstand die meiste Erfahrung darin, bei viel Welle und wenig
Wind einen guten Kompromiss aus Höhe und Fahrt zu finden, und
unser Trimm dürfte auch gelungener sein als der der sich erst
allmählich einsegelnden Gäste. Oliese und Martha
halten
ausgezeichnet mit. Frieda kämpft wacker. Salty ist von Beginn
an
hintenan und später kaum noch zu sehen. Genau die gleiche
Kreuz
bei identischen Bedingungen hatten wir vor zwei Jahren auch schon. Da
war die Oliese-Crew überfordert – Paula musste nach
zweistündiger Kreuz am vereinbarten Treffpunkt eineinhalb
Stunden
warten!
 Wie
damals ist dieser Treffpunkt Hinneskär
südöstlich von
Härmanö, von wo aus wir uns wieder ins
Schärenfahrwasser
einfädeln wollen. Auf der Dünung surfen wir wie
blöde,
dann liegen wir im Schutz der Insel bei und warten. Als ich das erste
Folkeboot sehe, rufe ich Oliese, um ihr mitzuteilen, wo wir auf der
Lauer liegen. Zu meiner Überraschung stellt sich heraus, dass
es
Frieda ist, die als Nächste angekommen ist – Claus
und
Steffi haben unterwegs wohl den Dreh herausgefunden. Oder Frieda hatte
keine Lust mehr auf Hinterherfahren und hat selbst das Ruder ergriffen.
Zumindest hat sie alle überholt.
Wie
damals ist dieser Treffpunkt Hinneskär
südöstlich von
Härmanö, von wo aus wir uns wieder ins
Schärenfahrwasser
einfädeln wollen. Auf der Dünung surfen wir wie
blöde,
dann liegen wir im Schutz der Insel bei und warten. Als ich das erste
Folkeboot sehe, rufe ich Oliese, um ihr mitzuteilen, wo wir auf der
Lauer liegen. Zu meiner Überraschung stellt sich heraus, dass
es
Frieda ist, die als Nächste angekommen ist – Claus
und
Steffi haben unterwegs wohl den Dreh herausgefunden. Oder Frieda hatte
keine Lust mehr auf Hinterherfahren und hat selbst das Ruder ergriffen.
Zumindest hat sie alle überholt.
Bis Salty ums Eck surft, vergeht gerade eine gute halbe Stunde
–
im Vergleich zur letzten Schwedentour keine schlechte Zeit für
das
langsamste Boot. Wir machen uns auf den Weg nach Mollösund.
Doch
es läuft auch jetzt nicht besser. Es läuft eigentlich
überhaupt nicht mehr. Egal, was wir uns vorgenommen haben,
eine
nahegelegene Alternative muss her. Was hat der Hafenmeister von
Åstol noch empfohlen? Slubberholmen? Ist das nicht gerade
hier
ums Eck?
 Die
vier Meilen schaffen wir noch. Slubberholmen ist nach Westen offen,
doch bei Südwest hoffe ich, dass wir ruhig liegen
können,
zumal der Wind weiter abflauen und komplett einschlafen wird. Morgens
ist mit Südwind zu rechnen, gegen Mittag mit Nordwest. Wenn
wir im
richtigen Moment auslaufen, kann es traumhaft werden. Es wird sogar
noch viel besser als einfach nur traumhaft, aber zunächst
müssen wir ein Plätzchen finden in einer Bucht, an
deren
Südufer schon etliche Yachten liegen und in deren Nordteil
fleißig geankert wird. Sie ist wesentlich
geräumiger, als es
im Ankerplatzführer den Anschein hat –
kurzentschlossen
segeln wir unter Vollzeug hinein. Mein Ehrgeiz ist geweckt, heute mal
wieder auf den Außenborder zu verzichten.
Die
vier Meilen schaffen wir noch. Slubberholmen ist nach Westen offen,
doch bei Südwest hoffe ich, dass wir ruhig liegen
können,
zumal der Wind weiter abflauen und komplett einschlafen wird. Morgens
ist mit Südwind zu rechnen, gegen Mittag mit Nordwest. Wenn
wir im
richtigen Moment auslaufen, kann es traumhaft werden. Es wird sogar
noch viel besser als einfach nur traumhaft, aber zunächst
müssen wir ein Plätzchen finden in einer Bucht, an
deren
Südufer schon etliche Yachten liegen und in deren Nordteil
fleißig geankert wird. Sie ist wesentlich
geräumiger, als es
im Ankerplatzführer den Anschein hat –
kurzentschlossen
segeln wir unter Vollzeug hinein. Mein Ehrgeiz ist geweckt, heute mal
wieder auf den Außenborder zu verzichten.
 Hilfsbereite
Segler machen sich bereit, unsere Vorleine anzunehmen, als wir mit
inzwischen geborgener Fock unsere Platzrunde segeln. Ich bin skeptisch
– zum Ufer hin sieht es bannich flach aus. Wir drehen noch
eine
Runde. Paula nähert sich langsam dem Felsen, ich gehe Ausguck
auf
dem Vorschiff. Von hier ist es eindeutig: Die Tiefe reicht nicht. Das
bestätigen auch die Leute an Land, „hier sieht es
tiefer
aus“, rufen sie, aber es ist nur ein winziger Einschnitt, der
bei
jeder Winddrehung zum Problem würde. Mir kommt eine bessere
Idee.
Hilfsbereite
Segler machen sich bereit, unsere Vorleine anzunehmen, als wir mit
inzwischen geborgener Fock unsere Platzrunde segeln. Ich bin skeptisch
– zum Ufer hin sieht es bannich flach aus. Wir drehen noch
eine
Runde. Paula nähert sich langsam dem Felsen, ich gehe Ausguck
auf
dem Vorschiff. Von hier ist es eindeutig: Die Tiefe reicht nicht. Das
bestätigen auch die Leute an Land, „hier sieht es
tiefer
aus“, rufen sie, aber es ist nur ein winziger Einschnitt, der
bei
jeder Winddrehung zum Problem würde. Mir kommt eine bessere
Idee.
Die Anderen segeln hinter uns auf und ab. Chartergäste auf
dieser
Tour müssen reichlich Geduld mitbringen, bevor sie sich dann
aber
ins gemachte Nest setzen dürfen. Sie haben Anlege-Vollservice
gebucht und bekommen ihn voller Enthusiasmus, für
gewöhnlich
übernehme ich von Land aus das Ruder, aber sie müssen
mir
natürlich Zeit zur Vorbereitung geben. Ich lasse vierzig Meter
vorm Ufer den Anker fallen. Belege ihn erstmal am Bug und berge das
Großsegel. Mache das Schlauchboot klar. Bringe damit unsere
lange
Leine an Land aus. Setze den Anker ans Heck und ziehe Paula nach vorne,
bis sie fünfzehn, zwanzig Meter von der Schäre
entfernt
liegt. Hole den Heckanker durch. Dann winke ich den Nächsten
zu.
 Die
Crews helfen sich gegenseitig beim Längsseitsgehen. Was
gestern
noch „ich habe noch nie das und das gemacht“
hieß,
funktioniert nun reibungslos und beinahe routiniert – alle
neun
sind wirklich in Schweden und an Bord angekommen. Ich betrachte es
wohlwollend und kümmere mich um unsere Seilfähre. Es
wird ein
Riesenspaß, besonders, wenn die Pärchen sich mit dem
winzigen Dinghi gemeinsam abmühen. Aber dank zweier
Sorgleinen,
einer an Land und einer auf Paula belegt, können wir alle
jederzeit und unabhängig voneinander übersetzen. Und
das
lohnt sich nicht nur wegen der Toilette. Denn Slubberholmen ist nicht
schön wie Vasholmen. Es ist phantastisch. Traumhaft.
Wundervoll.
Sanft ansteigend zum hochgelegenen Aussichtspunkt. Und
spärlich
bewachsen mit wackeren Blümchen und tapferen
Sträuchern
– den Folkebooten unter den Pflanzen.
Die
Crews helfen sich gegenseitig beim Längsseitsgehen. Was
gestern
noch „ich habe noch nie das und das gemacht“
hieß,
funktioniert nun reibungslos und beinahe routiniert – alle
neun
sind wirklich in Schweden und an Bord angekommen. Ich betrachte es
wohlwollend und kümmere mich um unsere Seilfähre. Es
wird ein
Riesenspaß, besonders, wenn die Pärchen sich mit dem
winzigen Dinghi gemeinsam abmühen. Aber dank zweier
Sorgleinen,
einer an Land und einer auf Paula belegt, können wir alle
jederzeit und unabhängig voneinander übersetzen. Und
das
lohnt sich nicht nur wegen der Toilette. Denn Slubberholmen ist nicht
schön wie Vasholmen. Es ist phantastisch. Traumhaft.
Wundervoll.
Sanft ansteigend zum hochgelegenen Aussichtspunkt. Und
spärlich
bewachsen mit wackeren Blümchen und tapferen
Sträuchern
– den Folkebooten unter den Pflanzen.
Beim Landgang durchquere ich den Zeltplatz für die Kanufahrer.
Im
Augenwinkel fällt mir ein Pärchen auf, von dem ich
denke,
„die sehen aus wie Boris und Katrin“ von der
Hinweggruppe.
Als ich auf dem höchsten Punkt Slubberholmens beinahe schon
wieder
vor Rührung weinen muss, weil wir uns einen so
schönen Ort
ersegelt haben, krabbelt die Erklärung für meine
Beobachtung
hangaufwärts: Es sind Boris und Katrin.
 Dass
sie noch eine weitere Urlaubswoche in Schweden verbringen wollten,
wusste ich bereits. Kurzentschlossen haben sie sich Kanus geliehen,
dazu Zelt, Kochgeschirr und was man sonst so braucht. Und
zufällig
haben wir uns heute hier getroffen. Es ist ein bisschen skurril: Mit
ihnen und dem Rest der Hinweggruppe habe ich phantastische zwei Wochen
verbracht, die ich niemals vergessen werde. Der Abschied fiel gerade
diesen beiden erkennbar schwer, und auch mir wäre er
schwergefallen, wenn sie sich nicht mit den Nachfolgern die Klinke in
die Hand gegeben hätten, so dass ich schon voll im Arbeits-
und
Orga-Modus war. Nach der Anspannung von Einweisung, Starkwindtagen und
Unerfahrenheit der Crews beginne ich meine Dienstreise gerade von Neuem
zu genießen. Und nun treffen wir uns hier auf dem Felsen, und
ich
wirke ein wenig sprachlos.
Dass
sie noch eine weitere Urlaubswoche in Schweden verbringen wollten,
wusste ich bereits. Kurzentschlossen haben sie sich Kanus geliehen,
dazu Zelt, Kochgeschirr und was man sonst so braucht. Und
zufällig
haben wir uns heute hier getroffen. Es ist ein bisschen skurril: Mit
ihnen und dem Rest der Hinweggruppe habe ich phantastische zwei Wochen
verbracht, die ich niemals vergessen werde. Der Abschied fiel gerade
diesen beiden erkennbar schwer, und auch mir wäre er
schwergefallen, wenn sie sich nicht mit den Nachfolgern die Klinke in
die Hand gegeben hätten, so dass ich schon voll im Arbeits-
und
Orga-Modus war. Nach der Anspannung von Einweisung, Starkwindtagen und
Unerfahrenheit der Crews beginne ich meine Dienstreise gerade von Neuem
zu genießen. Und nun treffen wir uns hier auf dem Felsen, und
ich
wirke ein wenig sprachlos.
Als wir uns schon verabschiedet haben und ich mich zu unserer
Seilfähre wende, gibt mir Paula den entscheidenden Hinweis:
Sie
würde Boris und Katrin gerne auf ein Glas Wein im Cockpit
einladen. Die beiden sagen begeistert zu. Ihre Überfahrt wirkt
auch ein wenig unbeholfen – mit ihnen haben wir an unseren
vier
Schären ja immer mit direktem Ausstieg über zumindest
eines
der Boote gelegen. Doch dann wird es ein langer, wundervoller Abend,
bei dem es hauptsächlich um WG-Erfahrungen in der
Großstadt
geht – ein interessantes Thema, wenn man gerade an einer der
schönsten Schären der schwedischen Westküste
dümpelt.
Unser nächster Tag bietet ein strammes Programm. Denn wir
wollen
am liebsten alles! Zumindest beides: Abends wieder an einer
Schäre
liegen, aber vorher Wasservorrat und Proviant
vervollständigen.
Paula weiß Rat, denn erstens hat sie für den
Vormittag den
schönen Südwind bestellt, mit dem wir ohnehin nicht
vorankämen, und zweitens hat sie dafür gesorgt, dass
Slubberholmen nur vier Meilen von Mollösund entfernt ist. Und
der
Ort hat sich für einen Einkaufsbummel zwischendurch schon vor
zwei
Jahren bestens bewährt.
 Zur
Wahl stehen die Außenlieger, Salty und Oliese. Beide Crews
sind
überrumpelt, haben weder abgewaschen noch sonstwie aufgeklart.
Oliese braucht angeblich auch keinen Proviant, also lautet die
Entscheidung: Salty darf und muss nach Mollösund. Ich vermute,
der
unerledigte Abwasch stapelt sich in den Backskisten, als Skipperin
Claudia uns um die Schäre segelt. An Bord sind Claus und
Steffi
von der Frieda mit meinem Einkaufszettel in der Tasche, sowie Gerd von
der Oliese, die nun doch ein paar Erledigungen hat. Für die
auf
Landgang befindliche Martha-Crew habe ich beschlossen, dass ein Brot
gekauft wird, und außerdem ihren leeren Wasserkanister
entführt. Denn Wasser sollen wir auffüllen, so
randvoll es
geht.
Zur
Wahl stehen die Außenlieger, Salty und Oliese. Beide Crews
sind
überrumpelt, haben weder abgewaschen noch sonstwie aufgeklart.
Oliese braucht angeblich auch keinen Proviant, also lautet die
Entscheidung: Salty darf und muss nach Mollösund. Ich vermute,
der
unerledigte Abwasch stapelt sich in den Backskisten, als Skipperin
Claudia uns um die Schäre segelt. An Bord sind Claus und
Steffi
von der Frieda mit meinem Einkaufszettel in der Tasche, sowie Gerd von
der Oliese, die nun doch ein paar Erledigungen hat. Für die
auf
Landgang befindliche Martha-Crew habe ich beschlossen, dass ein Brot
gekauft wird, und außerdem ihren leeren Wasserkanister
entführt. Denn Wasser sollen wir auffüllen, so
randvoll es
geht.
Salty und ich segeln ein Stündchen auf und ab, nachdem wir die
Einkaufsdelegation abgesetzt haben. Ein voller Schlauchbootsteg
verrät, dass es Viele so angehen wie wir. Auf dem
Rückweg,
Gerd und ich Lümmeln auf dem Vorschiff, Claus und Claudia
plaudern
im Cockpit, beginnt meine Nervosität. Wir sollen alle abgelegt
haben, bevor uns der auflandige Wind das Leben schwer macht. Doch Salty
läuft keine Höhe - wenn es so weiter geht, werden wir
einen
Holeschlag brauchen, um die Steine vor uns zu runden, die wir
eigentlich gar kein Hindernis darstellen müssten. Ich
beschwere
mich massiv und deutlich bei der Rudergängerin. Sie
konzentriert
sich. Und Salty segelt wie der Blitz zurück nach
Slubberholmen.
Jetzt müssen aber noch Mittagshäppchen und Abwasch
und alles
Mögliche erledigt werden. Meine Laune bleibt schlecht. Der
Wind
dreht, jetzt fehlt es uns noch, dass er aufbrist. Alleine bekomme ich
Paula längst nicht mehr heil vom Felsen weg, ohne dass sie in
die
luvwärtigen Nachbarn treibt. Endlich sind die Anderen bereit
und
legen ab. Rolf löst unsere Vorleine, springt ins Schlauchboot
– und staunt nicht schlecht, als ich sofort volles Rohr
rückwärts gebe und im Vorbeifahren den Heckanker
aufhole. Das
Schlauchboot treibt quer mit schäumender Bugwelle. Oliese hat
als
erste abgelegt und muss die ganze Zeit auf der Stelle tuckern, bis wir
schließlich so weit sind, dass Rolf übersteigen
kann.
Das Schlauchboot nehme ich in Schlepp. Es plätschert im
Schwell
der Motorboote und bremst gewaltig. Ein Flottillentörn ist
immer
auch eine Regatta, und mit dieser Bremse sind wir nicht
konkurrenzfähig. Im Kyrkesund endet meine Geduld, ich zerre
das
Dinghi ins Cockpit. Hier stört es auch. Ich stopfe es, so gut
es
geht, hochkant in den Niedergang. Drücke und zerre und biege
an
einem der Hörnchen am Heck, bis es unter den Reitbalken
flutscht
– nun kann Paulas Großbaum wieder
überkommen, und ich
bin einigermaßen zufrieden. Ich darf nur nichts von unter
Deck
brauchen, der Weg ist versperrt. Aber wir sind wieder schneller und
segeln fröhlich vorneweg. Während ich mich noch
über
dieses neue Setup amüsiere, überholt Frieda dennoch.
Immerhin
kommen wir diesmal alle unter Segeln durch den Kyrkesund.
 Der
Dämmertörn ist einer der schönsten Segeltage
einer an
solchen reichen Reise: Es geht gut, bisweilen zügig, aber
stets
stressfrei voran. Wir haben es nicht eilig, noch ist es lange hell. Und
der Segelnachmittag ist so kurzweilig, wie er nur sein kann, mit all
diesen Kursänderungen und navigatorischen Leckerbissen. Der
Verkehr ist beinahe null, im Wesentlichen beherrschen die
„Wildgänse“ ihr inzwischen vertrautes
Revier. Wir
durchsegeln auch den Hjärterösund, und zwar fluffig
ohne
fünf Wenden auf fünfzig Metern oder
Grundberührung am
„Jungfrauenloch“. Aber nicht ohne mein
wehmütiges
Gefühl, an meiner Lieblingsschäre frühestens
in zwei
Jahren wieder anlegen zu können. Wir durchsegeln auch
Marstrand
– und damit schließt sich ein Kreis. Vor der
gefühlten
Ewigkeit von fünf Tagen hat diese Reiseetappe dort begonnen
– nun fahren wir in der Abenddämmerung einfach nur
durch und
genießen den Blick auf die Stadt vom Wasser aus. Der volle
Hafen
ist längst zur Ruhe gekommen, die Sonne steht schon tief, und
der
erste den Gästen bereits vertraute Ort bietet ein unerwartet
friedliches Bild.
Der
Dämmertörn ist einer der schönsten Segeltage
einer an
solchen reichen Reise: Es geht gut, bisweilen zügig, aber
stets
stressfrei voran. Wir haben es nicht eilig, noch ist es lange hell. Und
der Segelnachmittag ist so kurzweilig, wie er nur sein kann, mit all
diesen Kursänderungen und navigatorischen Leckerbissen. Der
Verkehr ist beinahe null, im Wesentlichen beherrschen die
„Wildgänse“ ihr inzwischen vertrautes
Revier. Wir
durchsegeln auch den Hjärterösund, und zwar fluffig
ohne
fünf Wenden auf fünfzig Metern oder
Grundberührung am
„Jungfrauenloch“. Aber nicht ohne mein
wehmütiges
Gefühl, an meiner Lieblingsschäre frühestens
in zwei
Jahren wieder anlegen zu können. Wir durchsegeln auch
Marstrand
– und damit schließt sich ein Kreis. Vor der
gefühlten
Ewigkeit von fünf Tagen hat diese Reiseetappe dort begonnen
– nun fahren wir in der Abenddämmerung einfach nur
durch und
genießen den Blick auf die Stadt vom Wasser aus. Der volle
Hafen
ist längst zur Ruhe gekommen, die Sonne steht schon tief, und
der
erste den Gästen bereits vertraute Ort bietet ein unerwartet
friedliches Bild.
 Südlich
des Albrektssundskanal liegt unser Ziel Vaxholmen, bekannte Landmarke
unserer Einführungsrunden. Paula und ich machen es wie in
Slubberholmen: Wir segeln in die Abdeckung und aufs Ufer zu. Erkennen
früh, dass die Plätze mit ausreichender Wassertiefe
besetzt
sind und bedanken uns bei den freundlichen Helfern an Land. Werfen den
Anker. Dann pule ich das einsatzbereite Schlauchboot aus seiner Klemme
im Niedergang. Auch heute bauen wir unsere kleine Insel zwanzig Meter
vor der Schäre mit Hilfe von Landleinen, Heckankern und
Seilfähre.
Südlich
des Albrektssundskanal liegt unser Ziel Vaxholmen, bekannte Landmarke
unserer Einführungsrunden. Paula und ich machen es wie in
Slubberholmen: Wir segeln in die Abdeckung und aufs Ufer zu. Erkennen
früh, dass die Plätze mit ausreichender Wassertiefe
besetzt
sind und bedanken uns bei den freundlichen Helfern an Land. Werfen den
Anker. Dann pule ich das einsatzbereite Schlauchboot aus seiner Klemme
im Niedergang. Auch heute bauen wir unsere kleine Insel zwanzig Meter
vor der Schäre mit Hilfe von Landleinen, Heckankern und
Seilfähre.
Auch Vaxholmen hat ein Kompostklo. Und einen Aussichtspunkt. Einen
ziemlich hohen. Blick auf die Festung, Blick auf Ussholmen, das uns
neulich so gut gefiel und das nun deutlich abfällt
gegenüber
dieser Insel, die auch Vasholmen übertrifft und sogar das
grandiose Slubberholmen: Die Schären überbieten sich
Tag
für Tag und dauernd in ihrer atemberaubenden
Schönheit, und
wer mit grandiosen Glücksgefühl den Felsen
hinausklettert,
kehrt beschwingt und beinahe verstört ob der unerwarteten
Eindrücke an Bord zurück. Ich hoffe, ich werde mich
nie an
diesem magischen Prozess gewöhnen.
 Als
ich im Morgengrauen an Land gehe, Kamera und Stativ im Gepäck,
um
ein paar Schnappschüsse und ein Panorama aufzunehmen, sitzt
Claus
auf einem Felsen. Ich weiß nicht, was er so früh
hier
treibt, und er verrät es nicht, lässt sich aber gerne
zu
einem Landgang überreden. Ein großer Vorteil der
Schären ist, dass man in der Regel in einer Stunde, manchmal
wenigen Minuten, alles sehen und erkunden kann und dennoch
überwältigt ist. Anders als in den
Innenschären oder an
der schwedischen Ostküste, verharrt hier die Natur in einem
fortwährenden Anfangsstadium. Seit dem Vulkanismus, dem
Auseinanderdriften der Kontinente, den Auffaltungen und den Eiszeiten
hat sich nicht viel getan, doch in jeder Kluft regt sich Leben, wuchert
ein üppiges Miniaturwäldchen, und kommt doch nicht
über
den Rand des umgebenden Felsens hinaus.
Als
ich im Morgengrauen an Land gehe, Kamera und Stativ im Gepäck,
um
ein paar Schnappschüsse und ein Panorama aufzunehmen, sitzt
Claus
auf einem Felsen. Ich weiß nicht, was er so früh
hier
treibt, und er verrät es nicht, lässt sich aber gerne
zu
einem Landgang überreden. Ein großer Vorteil der
Schären ist, dass man in der Regel in einer Stunde, manchmal
wenigen Minuten, alles sehen und erkunden kann und dennoch
überwältigt ist. Anders als in den
Innenschären oder an
der schwedischen Ostküste, verharrt hier die Natur in einem
fortwährenden Anfangsstadium. Seit dem Vulkanismus, dem
Auseinanderdriften der Kontinente, den Auffaltungen und den Eiszeiten
hat sich nicht viel getan, doch in jeder Kluft regt sich Leben, wuchert
ein üppiges Miniaturwäldchen, und kommt doch nicht
über
den Rand des umgebenden Felsens hinaus.
 Es
wird Zeit, das Stativ einzuklappen und Paula segelklar zu machen
– wir haben heute Einiges vor: Ohne Motor abzulegen. Ein
gehöriges Stück südwärts zu segeln.
Das
gefürchtete Göteborg-Fahrwasser im Rivö
Fjord zu queren.
Und unsere letzte Schäre zu erreichen, einen kargen
Außenposten: Tistlarna. Das war vor sechs und vor sieben und
vor
zwei Jahren ein Traum von mir, jetzt haben wir das ruhige Wetter, das
hier geboten scheint. Zwischendurch, in der Flaute, zerbreche ich mir
den Kopf über Alternativen. Doch immer wieder kommt ein
Brischen,
das uns weiterbringt, und die Gäste murren nicht ob der
mageren
zwei Knoten. Unterwegs überholt uns ein
Schärenkreuzer mit
einem dänischen Einhandsegler. Ob wir gar nicht mit Lotte
unterwegs seien, fragt er. Ich SMSe der Lotte-Crew seine
Grüße, und es stellt sich heraus, dass Lotte im
gleichen
Moment an der Schäre anlegt, die er empfohlen hat.
Es
wird Zeit, das Stativ einzuklappen und Paula segelklar zu machen
– wir haben heute Einiges vor: Ohne Motor abzulegen. Ein
gehöriges Stück südwärts zu segeln.
Das
gefürchtete Göteborg-Fahrwasser im Rivö
Fjord zu queren.
Und unsere letzte Schäre zu erreichen, einen kargen
Außenposten: Tistlarna. Das war vor sechs und vor sieben und
vor
zwei Jahren ein Traum von mir, jetzt haben wir das ruhige Wetter, das
hier geboten scheint. Zwischendurch, in der Flaute, zerbreche ich mir
den Kopf über Alternativen. Doch immer wieder kommt ein
Brischen,
das uns weiterbringt, und die Gäste murren nicht ob der
mageren
zwei Knoten. Unterwegs überholt uns ein
Schärenkreuzer mit
einem dänischen Einhandsegler. Ob wir gar nicht mit Lotte
unterwegs seien, fragt er. Ich SMSe der Lotte-Crew seine
Grüße, und es stellt sich heraus, dass Lotte im
gleichen
Moment an der Schäre anlegt, die er empfohlen hat.
 Tistlarna
ist...nunja. Einigermaßen voll. Die verbliebenen
Plätze
sind: flach. Paula probiert ihr Glück in langsamer Fahrt, es
macht
klack, Tonne Gusseisen auf geduldigem Granit. Die bewährte
Seilfähre hat diesmal nur drei Meter zu
überbrücken. Das
Klo ist auf der anderen Seite der Bucht, für den Weg dorthin
muss
das Schlauchboot also von seinen Sorgleinen gelöst werden.
Geht
alles. Von der Umgebung bin ich zunächst ein bisschen
enttäuscht. Bis ich bei Sonnenuntergang die Kamera nehme und
Landgang mache. Dann bin ich begeistert, und das will etwas
heißen nach all den vertrauten und neuen Schären
dieser
Reise, doch diese hat wie jede andere ihren ganz eigenen Charakter, was
ebenfalls etwas heißen will, wo doch die gleichen Eiszeiten
den
Fels geformt haben. Hier ist also: Lotsenstation. Außenposten
am
Rande der Zivilisation. Vegetation gleich null. Felsformation gleich
hundert Prozent. Der Rest ist unbeschreiblich, man muss ihn gesehen
haben. Aber nur bei ruhigem Wetter, sonst garantiere ich für
nichts. Wir liegen auf einem Schluck Wasser unterm Kiel. Ich bin nicht
sicher, ob die müden Gäste den sehenswerten Rest
ausgiebig
genug betrachtet haben.
Tistlarna
ist...nunja. Einigermaßen voll. Die verbliebenen
Plätze
sind: flach. Paula probiert ihr Glück in langsamer Fahrt, es
macht
klack, Tonne Gusseisen auf geduldigem Granit. Die bewährte
Seilfähre hat diesmal nur drei Meter zu
überbrücken. Das
Klo ist auf der anderen Seite der Bucht, für den Weg dorthin
muss
das Schlauchboot also von seinen Sorgleinen gelöst werden.
Geht
alles. Von der Umgebung bin ich zunächst ein bisschen
enttäuscht. Bis ich bei Sonnenuntergang die Kamera nehme und
Landgang mache. Dann bin ich begeistert, und das will etwas
heißen nach all den vertrauten und neuen Schären
dieser
Reise, doch diese hat wie jede andere ihren ganz eigenen Charakter, was
ebenfalls etwas heißen will, wo doch die gleichen Eiszeiten
den
Fels geformt haben. Hier ist also: Lotsenstation. Außenposten
am
Rande der Zivilisation. Vegetation gleich null. Felsformation gleich
hundert Prozent. Der Rest ist unbeschreiblich, man muss ihn gesehen
haben. Aber nur bei ruhigem Wetter, sonst garantiere ich für
nichts. Wir liegen auf einem Schluck Wasser unterm Kiel. Ich bin nicht
sicher, ob die müden Gäste den sehenswerten Rest
ausgiebig
genug betrachtet haben.
 Für
die Nacht ist ein schwacher Südost angesagt. Genau von hinten,
das
müssen die Heckanker halten. Zeitpunkt fürs
Auslaufen: Kurz
bevor der Nordwest einsetzt. Das schaffen wir, motoren träge
aus
der Bucht, setzen die Segel, warten ab. Wir driften auseinander, alle
suchen irgendwo Wind. Am Ende führt jede Strategie zum
gleichen
Ergebnis: Mit selten über drei Knoten segeln wir
südwärts. Irgendwann passieren wir
Hästholmen und die
umgebenden Schären. Ich winke und verabschiede mich:
„Tschüß ihr Steine – wir kommen
wieder!“
Die Wunderwelt der Schären endet abrupt eine Meile
später.
Für
die Nacht ist ein schwacher Südost angesagt. Genau von hinten,
das
müssen die Heckanker halten. Zeitpunkt fürs
Auslaufen: Kurz
bevor der Nordwest einsetzt. Das schaffen wir, motoren träge
aus
der Bucht, setzen die Segel, warten ab. Wir driften auseinander, alle
suchen irgendwo Wind. Am Ende führt jede Strategie zum
gleichen
Ergebnis: Mit selten über drei Knoten segeln wir
südwärts. Irgendwann passieren wir
Hästholmen und die
umgebenden Schären. Ich winke und verabschiede mich:
„Tschüß ihr Steine – wir kommen
wieder!“
Die Wunderwelt der Schären endet abrupt eine Meile
später.
 Es
ist ein langer, zäher, uninspirierender Segeltag.
Deckschrubben
– es war nötig – hat mich nur für
zehn Minuten
beschäftigt. Zwei Stunden lang höre ich –
das habe ich
noch nie unterwegs gemacht – megalaut Musik. Dann vertilge
ich in
Windeseile eine Tafel Schokolade. Für eine Weile geht es
voran,
dann wird es erneut zäh und mühsam. Doch die
Gäste sind
nachher völlig begeistert. Ich kann wirklich nicht
nachvollziehen,
wovon – es waren zu viele Meilen für zu wenig Wind,
aber
beides ließ sich nicht ändern. In der
Abenddämmerung
biegen wir in das Fahrwasser nach Varberg ein. Am Ende meiner Geduld
berge ich die Segel und starte den Motor. Prompt kommt ein neuerliches
Brischen auf, gegen das wir aber hätten kreuzen
müssen, und
irgendwann ist ja auch mal gut. Nach Sonnenuntergang legen wir an
– am Wohnmobilstellplatz!
Es
ist ein langer, zäher, uninspirierender Segeltag.
Deckschrubben
– es war nötig – hat mich nur für
zehn Minuten
beschäftigt. Zwei Stunden lang höre ich –
das habe ich
noch nie unterwegs gemacht – megalaut Musik. Dann vertilge
ich in
Windeseile eine Tafel Schokolade. Für eine Weile geht es
voran,
dann wird es erneut zäh und mühsam. Doch die
Gäste sind
nachher völlig begeistert. Ich kann wirklich nicht
nachvollziehen,
wovon – es waren zu viele Meilen für zu wenig Wind,
aber
beides ließ sich nicht ändern. In der
Abenddämmerung
biegen wir in das Fahrwasser nach Varberg ein. Am Ende meiner Geduld
berge ich die Segel und starte den Motor. Prompt kommt ein neuerliches
Brischen auf, gegen das wir aber hätten kreuzen
müssen, und
irgendwann ist ja auch mal gut. Nach Sonnenuntergang legen wir an
– am Wohnmobilstellplatz!
Es ist der Abend der Mondfinsternis, des
„Blutmondes“,
für den wir aber nur bedingt einen Blick haben. Ich hatte mal
verkündet, dass wir morgens um vier auslaufen und nach Anholt
segeln würden, um dort dann einen erholsamen Liegetag zu
verbringen. Habe nach dem Segelpacken die aktuellste Version des
Wetterberichts studiert. Und bitte gegen elf Uhr alle an Land zu einer
außerordentlichen Törnbesprechung.
Jemand hat vor einem wahnsinnig großen Wohnmobil Teppiche
ausgelegt und eine Sitzgruppe bereitgestellt. Wir geraten in
Versuchung, uns ihrer zu bemächtigen, aber dann
begnügen wir
uns doch mit der Betonmole – wir sind schließlich
Folkebootsegler und keine überkandidelten Snobs. Meine
Botschaft
lautet: Gewitterwarnung ab frühem Nachmittag. Bis dahin
sollten
wir einen Hafen erreichen. Ich könnte mir aber vorstellen,
dass
Auslaufen um vier, also Aufstehen um zwei, nach diesem langen Tag eine
Spur zu hart wäre. Alternative also: Auslaufen um acht und nur
die
zwanzig Meilen nach Falkenberg segeln. Das müssen wir aber
zumindest schaffen, denn damit wäre entschieden, dass wir
entlang
der Küste Schwedens und Seelands fahren, und das ist ein
ganzes
Stück länger.
Je länger wir reden, desto überzeugter bin ich von
der
Alternative: Ich möchte nach Falkenberg, ich möchte
nach
Seeland. Es ist bemerkenswert, dass die frühe Aufstehzeit und
der
wenige Schlaf absolut kein Thema sind in der Diskussion. Stattdessen
ist es schließlich Rolf, der sich als Erster eindeutig
positioniert, indem er sagt: „Ich möchte so viel wie
möglich segeln.“. Wenn die kürzere Variante
des
morgigen Tages eine längere Gesamtstrecke bedeutet –
umso
besser! Dem können sich alle anschließen.
 Wir
legen also, nicht wirklich ausgeschlafen, aber frohen Mutes, um acht
Uhr ab. Wolkenloser Himmel, Ost 4, mit viereinhalb Knoten gekoppelt
haben wir eine Chance, Falkenberg vor dem ersten Gewitter zu erreichen,
auch wenn der Wind später auf Südost drehen wird, was
auf dem
letzten Stück zum Hafen gegenan bedeutet. Im Hafenhandbuch
–
der Loseblattsammlung vom DSV, die seit Jahren nicht mehr upgedatet
wird, die Paula aber weiterhin im Schwalbennest spazieren
fährt
und der die meisten Texte des Hafenlotsen des NV-Verlags entstammen
– wird der Ort sinngemäß beschrieben:
„Fahr da
bloß nicht hin! Es ist furchtbar!“ So lassen sich
aber
sämtliche Beschreibungen zwischen Mölle am
Øresund und
dem Kungsbackafjord interpretieren, und irgendwo muss man ja anlegen,
wenn man aus irgendeinem Grund weder über Anholt fahren, noch
direkt nach Grenaa übersetzen will oder kann. Vor sieben
Jahren
landeten Paula und ich in Falkenberg, weil mir Wind und Wetter nicht
geheuer waren, und der Hafen des Segelclubs, zwischen Industrieanlagen
und in schraddeligem Ambiente, wärmte mein Herz. Seitdem hat
sich
herausgestellt, dass Folkeboote und die vom DSV verschmähten
Häfen oft ausgezeichnet zusammenpassen, und wenn es um gleich
fünf Boote geht, die im Hochsommer einen Liegeplatz suchen,
ist
ein wesentliches Argument genau das: Wo die Anderen nicht hinwollen,
breiten wir uns umso lieber aus und machen es uns gemütlich.
Wir
legen also, nicht wirklich ausgeschlafen, aber frohen Mutes, um acht
Uhr ab. Wolkenloser Himmel, Ost 4, mit viereinhalb Knoten gekoppelt
haben wir eine Chance, Falkenberg vor dem ersten Gewitter zu erreichen,
auch wenn der Wind später auf Südost drehen wird, was
auf dem
letzten Stück zum Hafen gegenan bedeutet. Im Hafenhandbuch
–
der Loseblattsammlung vom DSV, die seit Jahren nicht mehr upgedatet
wird, die Paula aber weiterhin im Schwalbennest spazieren
fährt
und der die meisten Texte des Hafenlotsen des NV-Verlags entstammen
– wird der Ort sinngemäß beschrieben:
„Fahr da
bloß nicht hin! Es ist furchtbar!“ So lassen sich
aber
sämtliche Beschreibungen zwischen Mölle am
Øresund und
dem Kungsbackafjord interpretieren, und irgendwo muss man ja anlegen,
wenn man aus irgendeinem Grund weder über Anholt fahren, noch
direkt nach Grenaa übersetzen will oder kann. Vor sieben
Jahren
landeten Paula und ich in Falkenberg, weil mir Wind und Wetter nicht
geheuer waren, und der Hafen des Segelclubs, zwischen Industrieanlagen
und in schraddeligem Ambiente, wärmte mein Herz. Seitdem hat
sich
herausgestellt, dass Folkeboote und die vom DSV verschmähten
Häfen oft ausgezeichnet zusammenpassen, und wenn es um gleich
fünf Boote geht, die im Hochsommer einen Liegeplatz suchen,
ist
ein wesentliches Argument genau das: Wo die Anderen nicht hinwollen,
breiten wir uns umso lieber aus und machen es uns gemütlich.
Es läuft ganz gut. Fahrt durchs Wasser ist bestimmt deutlich
mehr
als viereinhalb Knoten. Aber es läuft uns eine zunehmende
Strömung entgegen. Die war nicht einkalkuliert. Wir sind ein
bisschen spät dran – als wir die Halbinsel
nördlich von
Falkenberg passieren, den Hafen schon gut in Sicht haben und wenden,
schläft der Wind ein.
Es ist ein wirklich unangenehmes Gefühl, bei Flaute in der
Strömung achteraus zu treiben und genau zu wissen: Der
nächste Wind ist eine Gewitterbö. Die Wolken, die
sich
über Land formieren, sind unmissverständlich. Was
tun?
Reffen, während wir gerade mal wieder froh sind über
den
anderhalbten Knoten, widerstrebt mir. Mit dem Außenborder
werden
wir bei der alten Welle vorerst nichts. Über Funk den Anderen
etwas erzählen kann ich kaum – dass das Wetter
schlechter
wird, sehen die selbst. Und wenn sie eine eigene Idee haben und sich
vergewissern wollen, sind wir erreichbar. Also warten wir ab. Und
nehmen zwischenzeitlich noch einmal hübsch Fahrt auf.
Die Untiefentonne, die es vor der Hafeneinfahrt zu runden gilt, habe
ich schon schemenhaft in Sicht, als der erste Schauer kommt. Es ist nur
ein Schauer: Tüchtig Regen und eine fünfer
Bö, endlich
wieder Druck in den Segeln und entsprechend Fahrt. Kaum ist er durch,
schläft der Wind wieder ein. Weil er über Land kommt,
ist
relativ schnell auch die Welle platt. Wir tüfteln weiter am
Projekt, die Untiefentonne zu erreichen. Nach kurzer Zeit kommt der
nächste Schauer – wieder nicht mehr als eine
Abkühlung
und eine willkommene frische Brise. Als es wieder aufklart und schon
der nächste Knaller aufzieht, starte ich den
Außenborder
– das ist bei spiegelglatter See die Chance, erheblich
voranzukommen. Der Trick besteht darin, den Motor auszumachen und
schleunigst aufzuholen, bevor das herannahende Gekräusel uns
erreicht. Denn das ist nicht einfach ein Gekräusel, sondern
erwartungsgemäß binnen Sekunden ein hackiger Seegang
von
einem knappen Meter. Als die Bö einfällt, sitze ich
schon
wieder an der Pinne und gehe auf Kurs.
Paula wirft sich auf die Seite und saust los. Der Regen ist
sekundär, mir fliegt von allen Seiten Gischt um die Ohren wie
selten. Dunkel wird es auch – zum Glück bleibt die
Sicht
beinahe erstaunlich gut, und nach zwei Kabellängen
können wir
wenden und passieren endlich die ersehnte Tonne. Die Wende ist
sportlich, dies ist geschätzt eine stramme sieben oder knappe
acht. Aus der Stand bzw. der Flaute wirklich beachtlich. Ich hole alles
aus dem Rigg, was geht: Traveller nach Lee, Achterstag bis dorthinaus,
Fock dicht und Großschot auf, bis nur noch das Achterliek
wirklich steht. Paula stürzt sich gierig in die Wellen.
Ich reiße die Großschot aus der Klemme und gebe
schwitzend
einen Schrick darauf, ohne sie ganz ausrauschen zu lassen. Paula
fällt ein bisschen ab. Die Einfahrt ist breit, aber nicht
unendlich, und bei diesen Bedingungen müssen wir tunlichst die
Mitte treffen. Schrick um Schrick tasten wir uns heran, bis wir mit
halbem Wind und voller Schräglage die Molenköpfe
hinter uns
lassen. Kaum haben wir die Abdeckung erreicht, ist der Schauer durch.
Knallsonne und Gluthitze breiten sich aus, der Wind schläft
ein,
ich starte den Außenborder. Nach entspanntem Anlegen packe
ich
die – bereits trockenen – Segel und warte auf die
Anderen.
Claudia berichtet: „Du hast gerade gestern erzählt,
ein
Folkeboot könne man ungerefft bei sieben Windstärken
problemlos segeln. Und heute habe ich gedacht: Das hat er gesagt, also
mache ich das jetzt.“ Saltys und Marthas Crew, die vielleicht
eine Meile hinter uns waren, sind sich einig: „Das erste Ding
war
das schlimmste.“ Tatsächlich hat die Wolke auf
dieser Meile
richtig Fahrt aufgenommen: Als bei uns schon wieder die Sonne knallte,
hörte ich hinter uns Donnergrollen. Martha und Salty schlugen
die
Blitze um die Ohren, und der Wind war derartig ruppig, dass der dritte
Schauer sie gar nicht mehr überraschte. Ist ja auch klar:
Feuchtigkeit über dem warmen Wasser aufzunehmen. sorgte
für
zusätzliche Energie. Auf den Trick, zwischendurch den Motor zu
starten, sind alle gekommen. Auf die Idee, ihn frühzeitig
wieder
aufzuholen, nicht alle: Marthas Außenborder hopste, als
Daniel
ihn gerade sichern wollte, aufs Achterdeck. Wie die die Situation
gemeistert haben, bleibt mir ein Rätsel – auf jeden
Fall hat
Daniel den Motor wahrhaftig schnell noch wieder eingefädelt.
Fazit: Bloß gut, dieses Unwetter hat uns nicht auf dem Weg
nach
Anholt erwischt. Unter der Bedingung, dicht unter Land zu sein und den
Hafen in Sicht zu haben, ist es eine wertvolle Erfahrung.
Von Falkenberg geht es nach Mölle. Ich kündige an:
Wir werden
im Schatten des Grand Hotels liegen, in Reichweite des
wunderschönen Bergmassivs des Kullen, das wir schon aus der
Ferne
als Landmarke sehen und in nächster Nähe passieren
werden.
Ich kündige auch knapp vierzig Seemeilen bei Ost drei bis vier
an.
Wir laufen früh aus, und zunächst läuft es
auch wirklich
gut mit zwischen viereinhalb und sechseinhalb Knoten.
Allmählich
bekommt der Wind diese kleinen Schwächephasen, die man
negative
Böen nennen könnte, und die extrem nervig sind, weil
man sie
jedes Mal für Vorboten einer Flaute hält. Die
vielleicht gar
nicht kommt, manchmal aber doch. Diesmal nutze ich eine dieser
Ruhephasen für einen Blick in die Seekarte. Und wundere mich.
Es
ist die meiste Zeit ein reiner Südkurs, also lässt
sich die
Strecke – die ich zur Kontrolle ein zweites Mal abgezirkelt
habe
- mühelos anhand der Bogenminuten abzählen. Es sind
deutlich
über fünfzig Meilen.
Segeln wollten wir ja nur vierzig, und das schaffen wir auch. Dann
schläft der Wind ein. Oliese startet als Erste den Motor,
Paula
und Frieda folgen ihrem Beispiel. Salty und Martha liegen mal wieder
zurück, ich warne sie über Funk, dass wir ihnen nun
davontuckern werden, wenn sie nicht auch ein bisschen Benzin opfern.
Der nächste Funkspruch kommt von Martha: Der Motor sei
ausgefallen. Weil immer noch kein Wind ist, bitte ich Salty, Martha in
Schlepp zu nehmen, und mache mir keine weiteren Gedanken. Mache ich
natürlich doch, aber sie gelten vorwiegend dem Problem, dass
der
Ersatzaußenborder unter Paulas Achterdeck gestaut ist, aber
das
ist ein uralter 4 PS- Zweitakter. Marthas Motor hat 6 PS und einen
längeren Schaft, ein größeres
Gehäuse und mehr
Gewicht. Er wird in die Vorpiek müssen zu all den
Ersatzsegeln,
und Paulas Bug taucht jetzt schon merklich ein. Eigentlich habe ich
keine Lust auf zweieinhalb Wochen kopfüber.
Außerdem hätte ich der Reise, den Booten und vor
allem ihren
tapferen Crews gewünscht, dass wir
standesgemäß unter
Segeln am Kullen vorbeifahren. Es ist schade, dass wir es nun unter
Motorgedröhn tun, aber das hält niemanden davon ab,
die
Basaltsäulen und Felsformationen zu bestaunen. Kurz vor Hafen
setzt die Seebrise ein, die hätten wir nun auch nicht mehr
gebraucht. Nachdem ich mich bei der Tageplanung um gute zehn Seemeilen
verzählt habe, bekomme ich nun die Gelegenheit, etwas
gutzumachen.
 Denn
die Liegeplatzsuche und das Anlegen erfordern Kreativität. Der
Hafen ist in etwa so: An der Innenseite der Außenmole liegt
man
in Boxen. Die sind alle voll. Im Inneren des Hafens liegt man
längsseits. Da gibt es aber keinen freien Stegplatz mehr, wir
müssten uns über irgendwelche Päckchen
verteilen –
keine echte Option. Gegenüber der Außenmole gibt es
eine
Betonpier mit genau auflandigem Wind, wo man vor Heckanker liegen soll.
Ganz links nahe der Hafeneinfahrt liegt eine Spækhugger,
daneben
ist die einzige breitere Lücke, dann folgen diverse
Motoryachten
sowie eine klassische Yacht, für die ich vorläufig
weiter
kein Auge habe. Ich binde Paula an einem der Heckpfähle an der
Außenmole fest und klariere unseren Heckanker. Dabei
zerbreche
ich mir den Kopf, wo wir hier zu fünft liegen sollen. Ergebnis
des
Grübelns ist ein Experiment in sieben Schritten.
Denn
die Liegeplatzsuche und das Anlegen erfordern Kreativität. Der
Hafen ist in etwa so: An der Innenseite der Außenmole liegt
man
in Boxen. Die sind alle voll. Im Inneren des Hafens liegt man
längsseits. Da gibt es aber keinen freien Stegplatz mehr, wir
müssten uns über irgendwelche Päckchen
verteilen –
keine echte Option. Gegenüber der Außenmole gibt es
eine
Betonpier mit genau auflandigem Wind, wo man vor Heckanker liegen soll.
Ganz links nahe der Hafeneinfahrt liegt eine Spækhugger,
daneben
ist die einzige breitere Lücke, dann folgen diverse
Motoryachten
sowie eine klassische Yacht, für die ich vorläufig
weiter
kein Auge habe. Ich binde Paula an einem der Heckpfähle an der
Außenmole fest und klariere unseren Heckanker. Dabei
zerbreche
ich mir den Kopf, wo wir hier zu fünft liegen sollen. Ergebnis
des
Grübelns ist ein Experiment in sieben Schritten.
Schritt 1: Ich löse die Vorleine, und wir treiben mit zur
Sicherheit laufendem Außenborder vor Topp und Takel auf die
breite Lücke zu. Schritt 2: Heckanker fällt und dient
uns
vornehmlich als Bremse. Wir legen schließlich so an, wie es
gedacht ist. Tausend Leute rennen herum, deren Kinder vor unserem Bug
kreischend und plantschend schön baden. Niemand bietet Hilfe
an.
Egal, brauchen wir nicht, Paula hängt sicher an ihrem
Heckanker.
Schritt 3: Ich steige an Land und schreite die Breite der
Lücke
ab. Neun Meter. Hm. So, wie Paula jetzt liegt, kriegen wir drei Boote
hier rein. Keine fünf. Aber das war ja von vornherein nicht
meine
Absicht – die Frage lautete ja, ob wir hier
längsseits gehen
können. Und das passt so gerade. Schritt 4: Ich knote einen
Fender
an die Heckankerleine, löse sie und passe am Bug auf,
während
der Wind Paulas Heck an die Pier treibt. Mache sorgfältig mit
den
üblichen drei Leinen fest. Schritt 5: Ich rufe Oliese und
später Frieda über Funk heran und erkläre
ihnen das
Manöver. Es unterscheidet sich von unserem darin, dass sie
statt
eines eigenen Heckankers unseren aufholen und benutzen sollen. Frieda
pult ihn schließlich aus dem Hafenbecken.
Während wir den Hafen also zu unserem Abenteuerspielplatz
erklären und uns eine Stunde lang richtig austoben, segelt die
inzwischen eingetroffene Martha vor der Einfahrt hin und her. Wir sind
vorläufig zu beschäftigt, ihre ungeduldigen
Funksprüche
zu beantworten, aber endlich reagiere ich doch. Und begebe mich auf die
Außenmole, um die Möglichkeiten auszukundschaften.
Ergebnis
ist folgender Plan: Martha nähert sich ohne Fock und mit
dichter
Großschot platt vor Laken der Einfahrt. Ich balanciere auf
dem
schmalen, wackeligen Wellenbrecher. Martha fährt dicht vorbei.
„Nehmt die Fender rein, dann könnt ihr dichter
vorbeifahren“, bitte ich. Zwar holt Daniel schnell die Fender
ein, aber Nicole traut sich trotzdem nicht näher an das
hölzerne Bauwerk, so dass ich nicht nur einfach von meiner
Sitzposition rutschen kann, sondern mit einem Sprung einen guten Wasser
überwinden muss, um das Vorschiff der mit geschätzten
drei
Knoten vorbeihuschenden Martha zu treffen. „Aus dem
Weg“,
rufe ich noch, Daniel zieht die hilfsbereit ausgestreckte Hand ein und
macht einen Schritt zur Seite. Ich lande und laufe los. Das ist der
Trick: Man muss auf einem beweglichen Ziel sofort loslaufen. Habe ich
oft geübt. Allerdings auf langsameren Booten. Ich renne direkt
ins
Cockpit.
Nicole ist beim ersten Aufschießer ihres Lebens sehr froh
über meine Anwesenheit. Im zweiten Anlauf klappt es, Daniel
bindet
die Vorleine um den gleichen Pfahl, an dem Paula lag, als ich den
Heckanker karierte und unser Anlegemanöver ersann. Wir bergen
das
Groß. Ich stelle ein paar Fragen zur Fehlersuche. Dann starte
ich
den Außenborder. „So“, sage ich, als das
gute
Stück schnurrt wie eh und je, „und nun
möchte ich noch
den kaputten sehen.“ Nachher stellt sich heraus, dass die
Belüftungsschraube zwar auf war, aber bei dem neuen Tank zwei
zusätzliche Umdrehungen gut gebrauchen kann: Als ich sie ein
Stück weiter öffne, zischt es. Da hat Nicole mit mir
als
Souffleur und Beistand aber schon bravourös Martha parallel
zum
Päckchen gehalten und langsam rantreiben lassen. Saltys
Anleger
ist problemlos, Martha ragt deutlich über die Hecks der
Nachbarn
hinaus.
Nun habe ich wirklich schon genug Aufregung für einen einzigen
Tag, doch er ist noch nicht zu Ende. Als Erstes kommt der Skipper der
Peter von Sestermühlen, um
unser Anlegen zu loben: „Es ist schön, alte
Holzboote zu
sehen. Vor allem, wenn sie auch noch gut gesegelt werden. Ich hab dich
vorhin beobachtet.“ Dann lädt mich Saltys Crew, die
ja nun
doch nicht Martha durch die Flaute geschleppt hat, zum Anlegebier ein,
und lässt durchblicken, dass sie bitte keine
Sonderaufträge
wie den Schlepp der motorlosen Martha mehr bekommen möchte:
„Wir sind total am Limit. Wir sind echt fertig. Wir kriegen
das
hier alles so hin, aber nichts extra dazu.“ Zunächst
bin ich
ein bisschen perplex, weil die beiden nach allem, was sie am Anfang
noch nie gemacht hatten - unter Anderem Folkeboot Segeln,
Päckchenliegen und Ankern - inzwischen wirklich
souverän
wirken und kurz vorm Gewitter sogar die Nerven habe, mich nach
Trimmtipps zu fragen, als die schnelle Paula überholt.
Doch ich verstehe sofort, als sie mir beschreiben, wie sie bei keinem
Handgriff auf irgendeine Routine zurückgreifen
können,
sondern über jeden einzelnen nachdenken und sich alles, was
von
außen so gut und gelungen und souverän aussieht,
mühsam
erarbeiten müssen. Es ist offenkundig, dass sie die Reise
trotzdem
total genießen, auch wenn sie urlaubsreif von ihr
zurückkehren werden, und dass es ihnen guttut, offen
darüber
zu reden. Ich verspreche, keine Rücksicht auf sie nehmen zu
können, und beschließe für den
nächsten Tag
dennoch einen kurzen Schlag nach Gilleleje.
Zunächst muss ich mich aber massiv über den Hafen von
Mölle ärgern. Schön gelegen, wie gesagt mit
Grand Hotel
und Blick auf den Kullen. Klein und etwas schraddelig, durchaus
gemütlich, wenngleich im Juli einfach voll. Aber in keiner
Weise
auf diesen Andrang vorbereitet. Ich bin wirklich überhaupt
nicht
anspruchsvoll: Zu meinen liebsten Zielen gehören Musholm (kein
Klo, kein Strom, kein Wasser, kein nichts) und Sottrupskov (Dixi-Klo
und sonst nichts). Aber wenn ich in einem richtigen Hafen liege, wo es
die übliche Ausstattung gibt, soll sie auch praktikabel sein.
In
Mölle besteht die erste Hürde in einem verschlossenen
Hafenbüro und davor einem Automaten, der nur Kreditkarten und
keine EC-Karten akzeptiert. Gerd hilft mir mit dem Hafengeld aus. Mit
dem erhaltenen Code betrete ich die Sanitärräume:
Fünf
Duschen und eine einzige Toilette für an die hundert Schiffe.
Die
Toilette ist natürlich besetzt. Bei den sieben
öffentlichen
Klos muss man Schlange stehen, und als ich dran bin, ist das Klopapier
alle.
Ich wende mich den Fressbuden zu. Die sind seltsam: Es riecht lecker
nach Pommes, aber entweder gibt es keine, oder sie werden nur an Kinder
verkauft und nicht an Erwachsene, auch nicht an Erwachsene, die sie
ihren Kindern mit an Bord nehmen wollen, oder es ist gerade Feierabend.
Als Alternativprogramm suche ich den Kaufmann, wir brauchen Milch und
Tomaten. Ich finde einen Wegweiser dorthin, doch aus dem Kaufmann ist
inzwischen ein weiteres Imbisslokal geworden, wo es auch keine Pommes
gibt. Zurück im Hafen haben die Motorbootleute von nebenan,
deren
Kinder vorhin durch unser nicht völlig belangloses
Anlegemanöver schwimmen durften, den Ghettoblaster auf die
Pier
gestellt, und klicken sich durch eine Playlist entsetzlicher Techno-
und Schlagermucke. Dabei ist so viel Alkohol im Spiel, dass ein
schnelles Ende des Debakels kaum absehbar erscheint. Zu guter Letzt
kaufe ich noch etwas am Bäckereiwagen – der
gähnende
junge Mann erkundigt sich dreimal, was ich nochmal gesagt habe, dass
ich möchte, entschuldigt sich mit „I don’t
know where
my brain is“ und packt mir schließlich ganz etwas
anderes
ein.
Es sei hinzugefügt, dass ein großes Plakat auf die
demnächst beginnenden Umbauten des Hafens hinweist –
offenbar hat man auch in Mölle selbst gemerkt, dass man den
Gastliegern ein bisschen mehr Service bieten muss. Als Momentaufnahme
ärgere ich mich jedenfalls massiv – und
beschließe,
zwecks ausgiebiger Erkundung des Kullen in Zukunft hier trotzdem bald
wieder mit den Charterbooten auftauchen zu wollen. Vielleicht nicht
unbedingt im Juli, aber auf jeden Fall mit mehr Zeit. Gerd ist der
Einzige, der bei Gluthitze nach einem langen, ereignisreichen Segeltag
tatsächlich noch den Mumm zu einem Spaziergang hat.
 Gerd
ist auch derjenige, der in Gilleleje den besten Anleger hinlegt. Ein
Folkeboot rückwärts bei gehörig auflandigem
Wind
rückwärts in eine Ecke zu zirkeln, hat zuvor auch mir
erhebliches Geschick und viel Geduld abverlangt. Hier haben wir alles,
was uns in Mölle vorenthalten blieb: Fischfilet und Pommes
direkt
am Liegeplatz (selten steht ein Fast-Food-Teller auf Paulas
Cockpittisch) und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.
Wir
haben zwei Tage Südost und damit Zeit für die
fünfzig
Meilen entlang der Nordküste Seelands nach Odden. Gerne
hätte
ich das hälftig geteilt, doch einen Hafen genau in der Mitte
gibt
es nicht. Die Wahl für den ersten Tag bestand zwischen
Hundested,
wo ich noch nie war, und Gilleleje, doch weil am zweiten Tag mehr und
zuverlässiger Wind sein soll, nehmen wir für den
ersten Tag
die kürzere Strecke. Passt auch. Nur dass es dann kurz vor
Odden
auf sechs Windstärken aufbrist und das Anlegen für
Fortgeschrittene ist.
Gerd
ist auch derjenige, der in Gilleleje den besten Anleger hinlegt. Ein
Folkeboot rückwärts bei gehörig auflandigem
Wind
rückwärts in eine Ecke zu zirkeln, hat zuvor auch mir
erhebliches Geschick und viel Geduld abverlangt. Hier haben wir alles,
was uns in Mölle vorenthalten blieb: Fischfilet und Pommes
direkt
am Liegeplatz (selten steht ein Fast-Food-Teller auf Paulas
Cockpittisch) und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.
Wir
haben zwei Tage Südost und damit Zeit für die
fünfzig
Meilen entlang der Nordküste Seelands nach Odden. Gerne
hätte
ich das hälftig geteilt, doch einen Hafen genau in der Mitte
gibt
es nicht. Die Wahl für den ersten Tag bestand zwischen
Hundested,
wo ich noch nie war, und Gilleleje, doch weil am zweiten Tag mehr und
zuverlässiger Wind sein soll, nehmen wir für den
ersten Tag
die kürzere Strecke. Passt auch. Nur dass es dann kurz vor
Odden
auf sechs Windstärken aufbrist und das Anlegen für
Fortgeschrittene ist.
Ich bin nicht überrascht, ich kenne den Seewetterbericht, aber
die
Gäste ahnen vorher nichts von ihrem Glück. Die
Oliese-Crew
läuft munter als Erste in den Hafen, lotst Frieda und uns in
eine
Ecke, wo angeblich fünf Boxenplätze frei sind
– und
dann sind es doch nur drei, Frieda liegt auf Legerwall an den
Pfählen, und wir müssen uns alle mühsam
wieder aus
dieser Ecke pfriemeln. Gerade noch so gelingt es Paula und mir, den
letzten freien Platz an der Innenseite der Außenmole zu
ergattern, bevor sich diese Lücke schließt. Die
Bedingungen
sind kacke: Wind pustig wie sonstwas und beinahe parallel zur Pier mit
leichter auflandiger Komponente. Die Lücke ist zehn Meter
breit,
eine Punktlandung gefragt. Ich nehme zu früh den Gang raus und
hangele Paulas Heck das letzte Stück am Bugkorb der Nachbarn
in
Lee entlang, während der hilfsbereite Nachbar in Luv auch
nichts
daran ändern kann, dass Paulas Bug dann eben an der Pier
entlangschubbern muss, bis die Leinen fest sind.
Bevor die Anderen kommen, die entweder noch draußen Segel
bergen
oder sich mühsam aus der Sackgasse puzzeln, legt sich beim
Nachbarn in Lee eine zweite große, breite Yacht ins
Päckchen. Paula heil zu erreichen, ist damit erheblich
schwieriger
geworden. Es klappt dann irgendwie doch, schließlich habe wir
alle einen Platz, und ich darf mich, fast heiser vom vielen
Brüllen energischer Hinweise und Kommandos, beruhigen. Und
genießen, dass wir in Odden sind.
Ich bin zum dritten Mal hier. Odden ist weder herausragend
schön
noch irgendwie besonders. Vermutlich würde sich ein
Spaziergang
zur Nordwestecke Seelands lohnen, doch der fällt auch dieses
Mal
aus. Aber es gibt dieses Fischgeschäft, wegen dem sich ein
Besuch
auf jeden Fall rentiert, und das will etwas heißen, wenn man
gerade aus dem lebhaften Fischereihafen Gilleleje kommt. Der Laden ist
nichts als eine schmucklose Halle mit einem Glastresen. Doch die
Betreiber wie das Ambiente wirken so freundlich und authentisch, und
die Ware derart frisch und verlockend, und das Ganze so stimmig, dass
man zunächst unmöglich vorbeigehen kann, ohne einen
Blick ins
Innere zu werfen, und danach auch keineswegs einfach wieder rausgehen
mag, ohne ausgiebig einzukaufen. Ich lasse mir auch gleich noch ein
kühles Bierchen zapfen – trotz des frischen Windes
ist es
erneut ein heißer Tag. Die Gäste begegnen mir einer
nach dem
anderen mit identischen Tüten voll frischem und
geräuchertem
Fisch.
 Allmählich
nähert sich die zweite Reiseetappe ihrem Ende. Uns bleiben
drei
Tage – Odense wird eine Punktlandung, und ich bin froh,
letzte
Woche die zwanzig Meilen nach Süden gesegelt zu sein und nicht
nach Norden. Die Gruppe habe ich liebgewonnen und weiß jetzt
bereits: Ich werde jede und jeden Einzelnen vermissen. Klar habe ich
manchmal durch den Hafen gebrüllt und mir die Haare gerauft,
bestimmt haben Manche auch bisweilen geflucht über die
Schwierigkeiten, die ich ihnen jetzt wieder eingebrockt habe
–
aber alle haben enorm gelernt und Fortschritte gemacht. Und alle haben
voller Begeisterung sogar von unseren letzten, wenig
spektakulären
Übernachtungshäfen geschwärmt. Der zweite
Teil des
Abenteuers ist in vollem Gang – doch ich wünsche mir
und vor
allem den Gästen zum Abschluss noch ein paar wirklich
hochkarätige Highlights. Und da trifft es sich ganz gut, dass
als
Nächstes Langør auf dem Programm steht.
Allmählich
nähert sich die zweite Reiseetappe ihrem Ende. Uns bleiben
drei
Tage – Odense wird eine Punktlandung, und ich bin froh,
letzte
Woche die zwanzig Meilen nach Süden gesegelt zu sein und nicht
nach Norden. Die Gruppe habe ich liebgewonnen und weiß jetzt
bereits: Ich werde jede und jeden Einzelnen vermissen. Klar habe ich
manchmal durch den Hafen gebrüllt und mir die Haare gerauft,
bestimmt haben Manche auch bisweilen geflucht über die
Schwierigkeiten, die ich ihnen jetzt wieder eingebrockt habe
–
aber alle haben enorm gelernt und Fortschritte gemacht. Und alle haben
voller Begeisterung sogar von unseren letzten, wenig
spektakulären
Übernachtungshäfen geschwärmt. Der zweite
Teil des
Abenteuers ist in vollem Gang – doch ich wünsche mir
und vor
allem den Gästen zum Abschluss noch ein paar wirklich
hochkarätige Highlights. Und da trifft es sich ganz gut, dass
als
Nächstes Langør auf dem Programm steht.
 Im beschaulichen, landschaftlich unspektakulären
Dänemark
gibt es eine Reihe von Naturhäfen, die man unbedingt gesehen
haben
muss. Allein schon, um es zu glauben. Neben Albuen und Dyvig/Miels Vig
sind das vor allem Langør auf Samsø und Korshavn
an der
Nordostecke von Fyn. Der Stavns Fjord vor Langør ist eine
ertrunkene Grundmoränenlandschaft, und wer mit dieser
Beschreibung
nichts anfangen kann, möge sich eine Ansteuerung vorstellen,
die
von spärlicher Betonnung, jeder Menge Untiefen, tausend
kleinen
Inseln und Sandbänken und einer üppigen Vogel- und
Pflanzenwelt gekennzeichnet ist. Wer das alles auf der Kreuz in voller
Schräglage heil umrundet hat (Ernsts Kommentar vor zwei
Jahren:
„Ist das spannend! Ist das spannend!“), landet in
einem
niedlichen kleinen Hafen mit einem hübschen Café,
einem
Holzregal, in dem frisches Gemüse aus den Gärten des
Ortes
zum Kauf bereitliegt, und entspannten Stegnachbarn, die sich voller
Begeisterung für die fünf gemeinsam reisenden
Folkeboote
interessieren. Und wo Paula anscheinend eine Liegeplatzgarantie
für uns ausgehandelt hat - auf jeden Fall haben wir bisher
noch
immer fünf Plätze bekommen. Ein Segelsommer, das kann
ich
nach diesem, letztem und den Freudentränen von vorletztem Jahr
sagen, ist nicht komplett ohne einen Besuch hier.
Im beschaulichen, landschaftlich unspektakulären
Dänemark
gibt es eine Reihe von Naturhäfen, die man unbedingt gesehen
haben
muss. Allein schon, um es zu glauben. Neben Albuen und Dyvig/Miels Vig
sind das vor allem Langør auf Samsø und Korshavn
an der
Nordostecke von Fyn. Der Stavns Fjord vor Langør ist eine
ertrunkene Grundmoränenlandschaft, und wer mit dieser
Beschreibung
nichts anfangen kann, möge sich eine Ansteuerung vorstellen,
die
von spärlicher Betonnung, jeder Menge Untiefen, tausend
kleinen
Inseln und Sandbänken und einer üppigen Vogel- und
Pflanzenwelt gekennzeichnet ist. Wer das alles auf der Kreuz in voller
Schräglage heil umrundet hat (Ernsts Kommentar vor zwei
Jahren:
„Ist das spannend! Ist das spannend!“), landet in
einem
niedlichen kleinen Hafen mit einem hübschen Café,
einem
Holzregal, in dem frisches Gemüse aus den Gärten des
Ortes
zum Kauf bereitliegt, und entspannten Stegnachbarn, die sich voller
Begeisterung für die fünf gemeinsam reisenden
Folkeboote
interessieren. Und wo Paula anscheinend eine Liegeplatzgarantie
für uns ausgehandelt hat - auf jeden Fall haben wir bisher
noch
immer fünf Plätze bekommen. Ein Segelsommer, das kann
ich
nach diesem, letztem und den Freudentränen von vorletztem Jahr
sagen, ist nicht komplett ohne einen Besuch hier.
Zuvor gilt es jedoch erheblich Hürden zu überwinden.
Und
aufgezeigt zu bekommen, dass das Segeln in der Gruppe zwar ein
erhebliches Sicherheitsgefühl erzeugt, man einander im
Ernstfall
aber doch nicht helfen kann. Aber auch, dass das gruppenspezifische
Sicherheitsgefühl manchen Ernstfall zu verhindern vermag.
Angesagt
ist: Nordwest 4-5, abnehmend, mittags abflauend. Einzelne Schauer und
Gewitter. Wir reden von 29 Seemeilen und möchten nicht
motoren,
einigen uns also mühelos auf frühes Auslaufen.
Richtig
frühes Auslaufen. Paula legt um 4 Uhr 15 als letztes Boot ab.
Im
Stockdunkel – Mittsommer ist lange her. Das Ablegen ist easy
going bei Nordwest, schräg ablandig von hinten: Fock hoch,
Achterleine als letzte los und raus aus dem Hafen. Der Wind ist eine
schlappe vier. Aber die Welle, das merken wir, als wir um die Mole
herum sind und im Gehoppel noch das Groß setzen
müssen, ist
ganz erheblich. Das beschert uns eine erste Bewährungsprobe.
Die nächste Schwierigkeit besteht darin, die fünf
Meilen zum
Snækkeløb, der Durchfahrt durch das zu Recht
gefürchtete Sjællands Rev, aufzukreuzen, bevor wir
uns auf
einen moderaten Kurs Richtung Tiefwasserweg T begeben dürfen.
Der
Sonnenaufgang ist spektakulär, doch ich habe keinen
unbeschwerten
Blick dafür. Die Charterboote haben unverkennbar
Schwierigkeiten:
Martha bekommt lange das Groß nicht hoch, Salty
fährt einige
Aufschießer (um das Groß nachträglich
besser
durchzusetzen, wie ich erst später erfahre), Frieda segelt am
Snækkeløb vorbei, Oliese läuft anfangs
keine
Höhe. Irgendwie halten die Boote zusammen und hoppeln voran.
Nach
einer Weile passt auch der Wind zum Seegang, was natürlich
bedeutet, dass es jetzt mit strammen fünf Windstärken
pustet.
Paula und ich kämpfen mit dem zusätzlichen Problem,
dass die
Bordbatterie hinüber ist. Und dem weiteren Problem, dass ich
das
noch nicht weiß. Mein bisheriger Eindruck ist, dass die Funke
kaputt ist und die Spannung in den Keller zieht. Wir sind also, Olieses
Crew konnte ich das im Hafen im letzten Moment noch zurufen, heute per
Funk nicht erreichbar, denn die Ersatzhandfunke ist nach Ausfall eines
der Geräte inzwischen auf Martha im Einsatz.
Gerd, Rolf, Ann-Kathrin und Oli tun das Richtige: Sie kreuzen wie der
Teufel und drehen an der ersten Tonne des
Snækkeløb bei.
Rufen mir das Wesentliche zu: Auf Martha sind beide seekrank. Wissen
nicht, ob sie’s schaffen. „Lass mal
telefonieren“,
sagt Gerd noch im Vorbeisegeln.
Ich warte einige Minuten nervös und vergeblich auf den Anruf.
Tippe entnervt auf dem Handy herum. Finde Gerds Nummer. Keiner geht
ran. Fluchend und schimpfend werfe ich das Gerät in die
Schublade
und knalle sie zu. Dann besinne ich mich darauf, mir zunächst
über eine vernünftige Problemlösung Gedanken
zu machen.
Über Odden hängt inzwischen ein grummelndes,
blitzendes
Gewitter – das wird Marthas Crew sicher zusätzlich
auf die
Stimmung drücken, aber zumindest sorgt es dafür, dass
Umkehren und Zurück nach Odden keine Option ist. Solange wir
Netz
haben, befrage ich alle fünf Minuten den Regenradar
– das
Wolkenband zieht zuverlässig hinter uns durch nach Nordosten.
Außer Odden ist der nächstgelegene Hafen
Sejerø. Die
Untiefentonne, die es auf dem Weg dorthin zu runden gilt, liegt in
Sichtweite unseres Treffpunkts vor Weg T – bis dorthin ist es
also in jedem Fall die gleiche Strecke. Meine Hoffnung lautet, dass es
nach dem Abfallen und jenseits des Sjællands Rev ruhiger wird
und
besser läuft und sich Marthas Crew dann besser fühlt.
Wir
also dort am Treffpunkt nochmal sprechen und notfalls dann nach
Sejerø gehen.
Gleichzeitig frage ich mich, was wir tun könnten. Oliese ist
das
einzige Boot, das ein Crewmitglied abgeben könnte. Aber
Übersteigen bei einem guten Meter Welle? Keine Chance! Es
bliebe
nichts Anderes, als die Seenotrettung zu rufen. Ein bisschen hilflos
fühlt man sich mit dieser Prognose schon...
Rolf ruft an. Sie haben das Handy gut verstaut und nicht
gehört.
Ist ja auch egal, war ja gut, dass ich mir zunächst Gedanken
machen konnte. Ich gebe sie weiter mit der Bitte, sie per Funk zu
verbreiten. Dann gehen wir auf Kurs zum Tiefwasserweg. Ich empfinde es
wirklich ruhiger jetzt, kann aber nicht einschätzen, was eine
Crew
mit ohnehin grummelndem Magen aus dieser Achterbahnfahrt macht. Es ist
ein phantastischer, um nicht zu sagen: geiler! Segeltag bisher
–
Auslaufen im Dunkeln, Mordsgehoppel, plötzlich irre Fahrt mit
haufenweise Spritzwasser, nebenbei Sonnenaufgang und Durchfahrt durch
das Riff, dann Rauschefahrt zum nächsten Abenteuer.
Genießen
kann ich es nicht, solange ich annehmen muss, dass die Charterer es
nicht genießen können.
 Paula erreicht als erste den Treffpunkt. Wir drehen bei und driften
zurück. Treffen Martha. „Und – wie geht
euch
das?“ erkundige ich mich. Lächeln. Daumen hoch.
„Viel
besser!“ Ich nehme erleichtert die Fock über. Fahre
eine
Wende. Die drei Frachter sind durch, der Weg ist frei. Es wir Mittag,
ohne dass der Wind einschläft. Er mäßigt
sich auf drei
bis vier Windstärken, schwächelt kurz, berappelt sich
dann
wieder – es ist ein wundervoller Segeltag, wenn man mal ganz
ehrlich ist. Kurz vor Samsø tausche ich mich mit Daniel und
Nicole schon wieder über den Feintrimm aus. Nach dem ganzen
Halbwindgedödel, das ich einfach nicht kann, müssen
wir jetzt
aber wieder Höhe laufen. Paula fährt einen
gehörigen
Vorsprung heraus, was praktisch ist, weil wir ja ohnehin als Erste
anlegen sollen wie üblich. Langør und der Fjord
sind
herausragend schön wie immer, wir finden
zusammenhängende
Plätze wie gewohnt, das Anlegen in der fiesen
Strömung ist
anspruchvoll, aber es klappt auch heute. Wir klaren die Boote auf. Und
dann bestellen wir im Café kühles Bier für
die
nötige Bettschwere vor dem Mittagsschlaf.
Paula erreicht als erste den Treffpunkt. Wir drehen bei und driften
zurück. Treffen Martha. „Und – wie geht
euch
das?“ erkundige ich mich. Lächeln. Daumen hoch.
„Viel
besser!“ Ich nehme erleichtert die Fock über. Fahre
eine
Wende. Die drei Frachter sind durch, der Weg ist frei. Es wir Mittag,
ohne dass der Wind einschläft. Er mäßigt
sich auf drei
bis vier Windstärken, schwächelt kurz, berappelt sich
dann
wieder – es ist ein wundervoller Segeltag, wenn man mal ganz
ehrlich ist. Kurz vor Samsø tausche ich mich mit Daniel und
Nicole schon wieder über den Feintrimm aus. Nach dem ganzen
Halbwindgedödel, das ich einfach nicht kann, müssen
wir jetzt
aber wieder Höhe laufen. Paula fährt einen
gehörigen
Vorsprung heraus, was praktisch ist, weil wir ja ohnehin als Erste
anlegen sollen wie üblich. Langør und der Fjord
sind
herausragend schön wie immer, wir finden
zusammenhängende
Plätze wie gewohnt, das Anlegen in der fiesen
Strömung ist
anspruchvoll, aber es klappt auch heute. Wir klaren die Boote auf. Und
dann bestellen wir im Café kühles Bier für
die
nötige Bettschwere vor dem Mittagsschlaf.
Vor zwei Jahren war der Rückweg eine eher zähe
Veranstaltung:
Frühzeitig verließen wir die Schären, es
folgten lange
Tage bei viel zu wenig Wind, mit Ach und Krach erreichten wir
rechtzeitig die Schlei. Diesmal kann die Rückweg-Gruppe sich
über nichts beklagen: Wir Schären hintereinander,
eine
schöner als die vorige, und danach noch viele schöne
Segeltage und manch lehrreiches, spannendes Abenteuer. Beim Betrachten
der Fotos fällt auf, dass wir häufig gegen
Sonnenuntergang
das Ziel erreicht haben - dafür sind wir aber auch vielfach
erst
mittags losgefahren.
 Der Schlag nach Korshavn ist auch noch einmal herausragend. Der
Wetterbericht verspricht anfänglich Flaute und ab mittags
schönen Wind. Wir verbringen also den Vormittag bei
schönem
Wind mit Müßiggang und segeln dann in die Flaute.
Was nach
einer grandiosen Niederlage und Fehleinschätzung klingen mag,
ist
ein wirklich kurzweiliges Unterfangen. Einmal sausen Paula und Oliese
in voller Fahrt auf die stehenden Martha, Frieda und Salty zu, um kurz
davor mit schlagenden Segeln ebenfalls stehen zu bleiben. Die drei
wenden nach Backbord, Oli und wir nach Steuerbord. Schlechte Idee,
Paula und ich brauchen eine Dreiviertelstunde, um aus der Flaute mit
der Kreuzsee herauszufinden. Martha segelt munter Richtung
Großer
Belt, ohne allerdings Höhe zu laufen, was sich bitter
rächt.
Und so kämpfen wir uns langsam südwärts in
den Abend
hinein.
Der Schlag nach Korshavn ist auch noch einmal herausragend. Der
Wetterbericht verspricht anfänglich Flaute und ab mittags
schönen Wind. Wir verbringen also den Vormittag bei
schönem
Wind mit Müßiggang und segeln dann in die Flaute.
Was nach
einer grandiosen Niederlage und Fehleinschätzung klingen mag,
ist
ein wirklich kurzweiliges Unterfangen. Einmal sausen Paula und Oliese
in voller Fahrt auf die stehenden Martha, Frieda und Salty zu, um kurz
davor mit schlagenden Segeln ebenfalls stehen zu bleiben. Die drei
wenden nach Backbord, Oli und wir nach Steuerbord. Schlechte Idee,
Paula und ich brauchen eine Dreiviertelstunde, um aus der Flaute mit
der Kreuzsee herauszufinden. Martha segelt munter Richtung
Großer
Belt, ohne allerdings Höhe zu laufen, was sich bitter
rächt.
Und so kämpfen wir uns langsam südwärts in
den Abend
hinein.
Wir hätten es nicht eilig, wenn nicht allmählich
offenkundig
wäre, dass Paula keinen Strom mehr hat. Die Funke steht seit
gestern still, auf halber Strecke verabschiedet sich das GPS, der
nächste Ausfall wird die Bilgepumpe sein – ich muss
nun
regelmäßig von Hand lenzen. In die Dunkelheit
möchte
ich so nicht geraten. Wir schaffen die Ansteuerung nach Korshavn zum
Sonnenuntergang, und Frieda und Oli tun mir den Gefallen, uns nicht nur
den Vortritt zu lassen, sondern beim Warten abwechselnd vor der
untergehenden Sonne entlang zu segeln.
 Dann
gibt es zur Krönung der Reise Päckchenankern unterm
Sternenhimmel. Danach Motorbootfahren bei schwachwindig gegenan in den
Odense Fjord, im Zickzack zwischen Industrieanlagen, durch den Kanal
und die Brücke bis in die Stadt. Ist kein Traum, aber mal ganz
interessant. Abends gehen wir gemeinsam in ein trendiges
Burgerrestaurant. Das ist ziemlich angemessen: Wir sind alle zu alt, um
in dieser Art Gastronomie die Gegenwart und die Zukunft zu sehen. Aber
jung genug, um neue Herausforderungen wie die zurückliegende
Reise
oder einen total abgefahrenen Burger mit wildem, unaussprechlichem
Namen wertzuschätzen. Noch passender wäre vielleicht
ein
Döner gewesen. Einer wie die Reise: „Mit
alles.“
Dann
gibt es zur Krönung der Reise Päckchenankern unterm
Sternenhimmel. Danach Motorbootfahren bei schwachwindig gegenan in den
Odense Fjord, im Zickzack zwischen Industrieanlagen, durch den Kanal
und die Brücke bis in die Stadt. Ist kein Traum, aber mal ganz
interessant. Abends gehen wir gemeinsam in ein trendiges
Burgerrestaurant. Das ist ziemlich angemessen: Wir sind alle zu alt, um
in dieser Art Gastronomie die Gegenwart und die Zukunft zu sehen. Aber
jung genug, um neue Herausforderungen wie die zurückliegende
Reise
oder einen total abgefahrenen Burger mit wildem, unaussprechlichem
Namen wertzuschätzen. Noch passender wäre vielleicht
ein
Döner gewesen. Einer wie die Reise: „Mit
alles.“
weiter: "Wir
hatten Zustände an Bord" - Ein wildes Abenteuer, Teil 3

