| Paulas Törnberichte | 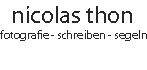 |
|||||
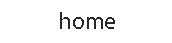 |
 |
 |
 |
 |

|
|
|
|
||||||

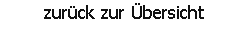
Zuviel
Dänische Südsee im Juli: Die
Fahrtenyachten sind zu groß, zu lang, zu breit, zu viele. Es
gab Zeiten, als ein einzelnes Folkeboot immer noch zwischen zwei
größeren Booten mit in die Box kam - kurz eine
Achterleine hoch, zwischendurch gefahren, fertig. Heute gibt es kein
Zwischen mehr: Die Boote liegen dicht an dicht selbst in den breitesten
Boxen. Grandios, dass die tolle Zeitschrift Yacht in ihrer
Charter-Rubrik genau jetzt, als auch der letzte Deutsche kapiert hat,
dass er hierher segeln darf, auch noch Werbung für das Revier
macht. Tenor: Die Häfen seien unzeitgemäß
bis schäbig, die Einheimischen schrullig, die Preise zu hoch,
das Wetter schlecht, aber davon abgesehen steht einem Törn
rechtsherum von Marstal durch den Svendborgsund nach Lyø
nichts entgegen. Von dänischen Bekannten ist momentan zu
hören: "Ich segel jetzt nicht mehr. Erst wieder, wenn die weg
sind."
Juli 2020
 Die
Butter genießt die Morgensonne. Sie weiß wohl, dass
sie in
der dunklen, kühlen Abgeschiedenheit der Bilge besser
aufgehoben
wäre - doch ist es nicht viel schöner, beim
gemütlichen
Treiben auf dem Cockpittisch dazuzugehören? Gar ein wenig im
Mittelpunkt zu stehen? Sie ist eine fröhliche,
glückliche,
bestens gelaunte Butter. Dann, ganz plötzlich, von einem
Moment
zum nächsten, zerfließt sie in Selbstmitleid, bis
nichts
mehr übrig ist als triefendes Fett.
Die
Butter genießt die Morgensonne. Sie weiß wohl, dass
sie in
der dunklen, kühlen Abgeschiedenheit der Bilge besser
aufgehoben
wäre - doch ist es nicht viel schöner, beim
gemütlichen
Treiben auf dem Cockpittisch dazuzugehören? Gar ein wenig im
Mittelpunkt zu stehen? Sie ist eine fröhliche,
glückliche,
bestens gelaunte Butter. Dann, ganz plötzlich, von einem
Moment
zum nächsten, zerfließt sie in Selbstmitleid, bis
nichts
mehr übrig ist als triefendes Fett.
Mir geht es wie der Butter: Ich zerfließe in Selbstmitleid.
Gerne
habe ich die Sonnenwärme der Gesellschaft von netten Menschen
und
Freunden in den letzten Wochen ausgiebig genossen. Doch ich kenne mich
lange genug, um zu wissen, dass ich das nur aushalte, wenn ich eine
genügende Dosis Alleinsein bekomme. Paula kennt mich so gar
nicht:
In den letzten Jahren hat sich das gut die Waage gehalten,
Einhandsegeln, Eigenbrötlerei und Geselligkeit. Nun habe ich
es
übertrieben. Paula und ich haben noch nicht einen einzigen
Segeltag lang unser ungestörtes, einsames, unbeschwertes,
erholsames Ding gemacht - immer waren wir in Begleitung anderer
Folkeboote und ihrer Crews, oder wir befanden uns auf dem Weg zu ihnen.
Ich bin nicht überrascht. Ich habe es kommen sehen, dass ich
mich
dringend mal wieder verkriechen muss. Hoffentlich ist es nun nicht zu
spät. Ich möchte keinen Menschen sehen oder
hören, mir
stehen Tränen in den Augen, ich spüre einen
körperlichen
Schmerz, der sich nicht lokalisieren lässt, und habe keine
Lust:
Auf Gesellschaft nicht, auf Segeln nicht, und auch auf nichts anderes.
Ich kenne dies alles zur Genüge, auch wenn es lange her ist,
dass
es so schlimm war. Ich habe alle Mühe, meine kindische
Umgehensweise damit zu unterdrücken: Meinen Mitmenschen
wehzutun,
sie spüren zu lassen, wie miserabel es mir geht, und sie mit
Ratlosigkeit und schlechtem Gewissen zurückzulassen, wenn ich
theatralisch die Flucht antrete. Erik, Hille und Michael haben das
nicht verdient. Aber in verständlichen Worten
erklären, was
los ist - dazu fühle ich mich auch nicht in der Lage.
Die Angst vor diesem Zustand schwelte lange. Doch es gibt einen
konkreten Auslöser: Folkeboot Lene hat Erik und mich zum
Abendessen eingeladen. Aber sie möchten nicht weiter nach
Norden
oder Westen, am liebsten bleiben, wo sie sind. Also segeln wir von
Haderslev nach Lyø - so hat Erik es mit Hille und Michael
ausgemacht.
 Bei
Paula und mir haben sich aus der Erfahrung der letzten Jahre zwei
eiserne Prinzipien etabliert: Wir laufen im Juli keine chronisch
überfüllten Häfen an - Nummer eins auf der
No-go-Liste
ist Lyø. Und wir laufen bei Starkwind keine Häfen
ohne
Windabdeckung an - wieder wäre mein erstes Beispiel bei
Nordwest
Lyø. Und was mache ich nicht? Natürlich will ich da
nicht
hin. Natürlich hätte ich jede Menge bessere Ideen, wo
wir uns
treffen könnten, oder wie wir das gemeinsame Diner um einen
Tag
verschieben könnten. Natürlich könnte ich
sagen: "Ohne
mich, macht ihr mal." Aber ich halte meine Klappe. Behalte meine
Bedenken für mich, im sicheren Bewusstsein, dass ich
später
unzufrieden sein werde mit dem Verlauf des Tages. Stattdessen freue ich
mich, dass kein Gang zum Supermarkt erforderlich ist und wir sofort
auslaufen können.
Bei
Paula und mir haben sich aus der Erfahrung der letzten Jahre zwei
eiserne Prinzipien etabliert: Wir laufen im Juli keine chronisch
überfüllten Häfen an - Nummer eins auf der
No-go-Liste
ist Lyø. Und wir laufen bei Starkwind keine Häfen
ohne
Windabdeckung an - wieder wäre mein erstes Beispiel bei
Nordwest
Lyø. Und was mache ich nicht? Natürlich will ich da
nicht
hin. Natürlich hätte ich jede Menge bessere Ideen, wo
wir uns
treffen könnten, oder wie wir das gemeinsame Diner um einen
Tag
verschieben könnten. Natürlich könnte ich
sagen: "Ohne
mich, macht ihr mal." Aber ich halte meine Klappe. Behalte meine
Bedenken für mich, im sicheren Bewusstsein, dass ich
später
unzufrieden sein werde mit dem Verlauf des Tages. Stattdessen freue ich
mich, dass kein Gang zum Supermarkt erforderlich ist und wir sofort
auslaufen können.
Im Aarøsund drückt eine Bö so doll in die
Segel, dass
sich zuerst die Fockschot löst und der Ausbaumer nach vorne
piekst, und während ich sie dichthole, sehe ich, dass sich der
Großbaum so biegt wie die Banane, die Erik mir hinterher
zeigt,
bevor er sie genüsslich verspeist. Ich werfe den
Baumniederholer
los, um den Baum zu retten. Das Groß wickelt sich um den
Jumpbock, also hole ich die Schot dicht. Pommery holt uns ein, Erik
grinst. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Zwanzig Meilen platt
vorm
Laken bei solchem Scheiß? Habe ich keine Lust zu. Immerhin,
der
Wind beruhigt sich auf 4-5. Böen 6, ich hole den
Baumniederholer
wieder durch. Paula läuft mehr "Tiefe" als Pommery - soll
heißen: Wir halten den exakten Vorwindkurs durch.
Ich hingegen beruhige mich nicht. Ich bin jetzt schon empört,
mir
sowas geben zu müssen. Es macht absolut total keinen
Spaß!
Der Seegang ist gar nicht so heftig, aber immer wieder gehen drei
steile, grauenhafte Wellen durch. Mir graut vor der Halse, die wir
zwischen Hornenæs und Lyø werden fahren
müssen. Mir
graut davor, in diesem Scheißgekabbel den blöden
Ausbaumer
einholen zu müssen. Mir graut vor dem vollen Hafen, in dem es
eh
keinen Platz mehr für uns geben wird, und wenn es einen gibt,
wird
er erstens zwischen bescheuerten Joghurtbechercrews sein, und zweitens
möchte ich unter Segeln anlegen unter allen kontrollierbaren
Umständen. Und diese? Werden die kontrollierbar sein?
Pommery segelt hinter uns Halse um Halse. Wir sparen uns das - mit
zeitweise backstehendem Groß segeln wir stoisch auf die
Trille
zu. Wie souverän Paula das macht, beruhigt mich dann doch ein
bisschen. Erik wird später behaupten, das liege an ihrem
eigentlich zu kurzen Fockausbaumer. Soll er doch reden...
 Hinter
der Trille passieren verschiedene Dinge. Der Ausbaumer muss weg. Die
Welle ist durch die Sandbank reduziert, aber der Wind legt nochmal
ordentlich zu, jetzt eher sechs Böen sieben (kein seltenes
Phänomen hier, warum auch immer). Hinter uns folgt eine ganze
Armada, die auch den letzten Liegeplatz ergattern will. Von Osten kommt
die Fähre. Und von Lene fehlt jede Info, ob die eine
Puzzleecke
für uns organisiert haben.
Hinter
der Trille passieren verschiedene Dinge. Der Ausbaumer muss weg. Die
Welle ist durch die Sandbank reduziert, aber der Wind legt nochmal
ordentlich zu, jetzt eher sechs Böen sieben (kein seltenes
Phänomen hier, warum auch immer). Hinter uns folgt eine ganze
Armada, die auch den letzten Liegeplatz ergattern will. Von Osten kommt
die Fähre. Und von Lene fehlt jede Info, ob die eine
Puzzleecke
für uns organisiert haben.
Durchatmen! Der Ausbaumer ist unter Deck, die angeluvte Paula wieder
auf Kurs. Nächster Kraftakt: Fock runter, Paula erneut auf
Kurs
bringen. Keine Zeit für einen Zeising, das Segel schlurt durch
die
wilde See. Details des Hafens werden erkennbar: Die Stege dicht belegt
zu beiden Seiten, dazwischen jede Menge Päckchenlieger. Ich
kann
mir schon lebhaft vorstellen, wie die viel zu langen, viel zu
großen, viel zu vielen Boote aus den Boxen ragen, und wo sie
es
nicht tun, übernehmen das die unvermeidlichen Schlauchboote
und
unsäglichen SUPs. Ich will hier gar nicht hin, denke ich noch,
dann versuche ich, raumschots bis halbwinds die Großschot
dichtzuholen, um Fahrt rauszunehmen. Gelingt nicht - perfekt getrimmt
rauschen wir mit sechseinhalb Knoten auf einen Hafen zu, der in leerem
Zustand geräumig genug wäre, jetzt aber einen
Aufschießer auf den Punkt erfordern dürfte. Den
würde
ich mir in Bestform durchaus zutrauen. Aber ich will ja verdammt
nochmal diesen Spuk gar nicht mitmachen!!!!
 Zwanzig
Meter vor der schmalen Hafeneinfahrt bemerke ich das
Zweierpäckchen, das dort liegt. Die schrecken hier vor gar
nichts
zurück! Paula scheut. Wütend fahren wir einen
Aufschießer. Ich gedenke noch nach vorne zu rennen und erst
die
Fock hochzuziehen, bevor ich das Groß berge, um defensiv nur
mit
dem Vorsegel in den Hafen zu fahren. Dann habe ich plötzlich
den
Außenborder in Gang und das zweite Segel auch unten. Blick
nach
hinten: Die Armada ist nähergekommen, die Fähre auch.
Vollgas, auf Kurs, schwungvoll rein ins zweifelhafte Vergnügen.
Zwanzig
Meter vor der schmalen Hafeneinfahrt bemerke ich das
Zweierpäckchen, das dort liegt. Die schrecken hier vor gar
nichts
zurück! Paula scheut. Wütend fahren wir einen
Aufschießer. Ich gedenke noch nach vorne zu rennen und erst
die
Fock hochzuziehen, bevor ich das Groß berge, um defensiv nur
mit
dem Vorsegel in den Hafen zu fahren. Dann habe ich plötzlich
den
Außenborder in Gang und das zweite Segel auch unten. Blick
nach
hinten: Die Armada ist nähergekommen, die Fähre auch.
Vollgas, auf Kurs, schwungvoll rein ins zweifelhafte Vergnügen.
Hecks, Schlauchboote und SUPs ragen aus den Boxen - an der Luvseite des
Beckens erstmal am Pfahl festzumachen, ist anspruchsvoll bis waghalsig.
Voraus längsseits liegt ein Fünferpäckchen
größerer Yachten und davor ein Päckchen
zweier
Folkeboote - doch der Weg dorthin ist durch Luvleinen der
Großen
versperrt. Ich mache den Gang raus, registriere resigniert, dass der
Motor ausgeht, und lasse Paula auf Legerwall an die Pfähle
treiben. Hinter uns tuckert eine Bavaria in den Hafen und legt sich
quer, Erik kriegt irgendwas zu fassen, an das er einen
Aufschießer fahren kann - sein Außenborder ist zwar
am
Heck, funktioniert aber nicht.
Neben uns liegt Lene. Michael murmelt irgendwas von wie wir hier
schön zusammen liegen könnten. Ich betrachte traurig
das
Dicht-an-Dicht blöder, dusseliger Boote und schüttele
den
Kopf. Paula treibt ein Stück weiter. Wir packen erstmal die
Segel
und klaren komplett auf.
 Erik
macht das Gleiche, doch er lässt die Persenninge weg und ist
schneller. Munter wriggt er zu Lene heran, gemeinsam puzzeln sie
Pommery mit in die Box. Und wir? Wer mich nicht mit großen
Augen
anglotzt, hat irgendeine dusselige Idee, wie wir ganz prima irgendwo
zwischen können. Allen gemeinsam ist: Funktioniert entweder
nicht,
oder ich habe absolut total null Bock auf diesen Mist. Ich starte den
Motor - wir laufen wieder aus. Ich weiß nur noch nicht genau,
ob
wir uns ins große Feld der Ankerlieger gesellen, oder ob wir
vorm
Hafen (wo gerade die Fähre manövriert) solange
treiben, bis
ich die Segel wieder ausgepackt habe. Sicher ist nur: Hier bleiben wir
nicht!!!!! Erik und Michael fummeln irgendwie eine Lücke
zwischen
den Fischerbooten. Erik hat sogar schon unser Hafengeld bezahlt.
Erstaunt über mich selbst lasse ich Paula in die
Lücke
treiben. Abendessen auf Lene? Kein Bock. Kein Appetit. Kein gar nichts.
Zwei Minuten später steht die Kuchenbude und ist beidseits
geschlossen.
Erik
macht das Gleiche, doch er lässt die Persenninge weg und ist
schneller. Munter wriggt er zu Lene heran, gemeinsam puzzeln sie
Pommery mit in die Box. Und wir? Wer mich nicht mit großen
Augen
anglotzt, hat irgendeine dusselige Idee, wie wir ganz prima irgendwo
zwischen können. Allen gemeinsam ist: Funktioniert entweder
nicht,
oder ich habe absolut total null Bock auf diesen Mist. Ich starte den
Motor - wir laufen wieder aus. Ich weiß nur noch nicht genau,
ob
wir uns ins große Feld der Ankerlieger gesellen, oder ob wir
vorm
Hafen (wo gerade die Fähre manövriert) solange
treiben, bis
ich die Segel wieder ausgepackt habe. Sicher ist nur: Hier bleiben wir
nicht!!!!! Erik und Michael fummeln irgendwie eine Lücke
zwischen
den Fischerbooten. Erik hat sogar schon unser Hafengeld bezahlt.
Erstaunt über mich selbst lasse ich Paula in die
Lücke
treiben. Abendessen auf Lene? Kein Bock. Kein Appetit. Kein gar nichts.
Zwei Minuten später steht die Kuchenbude und ist beidseits
geschlossen.
So geht es einigermaßen. Ich habe eine Stinkwut auf mich
selbst,
dafür, hier hin gesegelt zu sein, obwohl dieser Ausgang mehr
als
absehbar war. Ich hasse überfüllte Häfen!
Ich habe
keinerlei Mitleid für all die Idioten, die sich auf diesen
Scheiß hier einlassen und das für einen tollen
Urlaub
halten. Doch ich möchte nie und nimmer zu ihnen
gehören. Auf
Lyø läuft das so, dass morgens, wenn die Ersten
Auslaufen,
sich allmählich die Päckchen auflösen und
die
Ankerlieger in den Hafen strömen. Im Ergebnis sind die
regulären Plätze rund um die Uhr belegt. Es sind
einfach zu
viele Yachten.
Daneben nervt mich auch die Wetterlage: Zuviel Wind! Die ganze Saison
schon fühlt es sich so an, als sei entweder zuviel oder
zuwenig.
Witzigerweise sieht man die Idioten, die nun Lyø
übervölkern, an den wenigen Tagen mit hervorragenden
drei bis
vier Windstärken unter Motor ihr blödes Ziel
ansteuern - aber
das ist ein Thema für einen anderen Blogeintrag. Diese Woche
waren
Samstag und Sonntag grandios, sofern man auf Wind erst ab
frühem
Nachmittag eingestellt war. Seitdem ist das Tief durch, der
Zwischenhochkeil hat sich über Großbritannien
eingeklemmt,
und es pustet mit 4-7 ohne Unterlass. Platt vorm Laken, begleitet von
Schauern, ist das kein Segelvergnügen.
 Und
so habe ich also am Dienstagmorgen absolut keine Lust: Auf Leute, von
denen es auf Lyø wimmelt wie im Ameisenhaufen an Ameisen.
Auf
Menschen, die irgendwas von mir wollen oder es gut mit mir meinen. Auf
Segeln bei diesem unerträglichen Hack. Auch nicht auf
Tränen
in den Augen und Schmelzen im Selbstmitleid wie ein Stück
Butter
in der Morgensonne. Zwar habe ich gestern Abend selbst Troense als
nächstes Ziel vorgeschlagen und vom Blick auf die
Südsee von
der Bregninge Kirke vorgeschwärmt. Zwar habe ich mich eben
noch
zusammengerissen, wie man sich eben zusammenreißt, und auf
Lene
verkündet, dass wir ja bald auslaufen könnten. Doch
jetzt
will ich einfach nur: Nichts! Nichts nichts und nichts. Und vor allem:
In Ruhe gelassen werden.
Und
so habe ich also am Dienstagmorgen absolut keine Lust: Auf Leute, von
denen es auf Lyø wimmelt wie im Ameisenhaufen an Ameisen.
Auf
Menschen, die irgendwas von mir wollen oder es gut mit mir meinen. Auf
Segeln bei diesem unerträglichen Hack. Auch nicht auf
Tränen
in den Augen und Schmelzen im Selbstmitleid wie ein Stück
Butter
in der Morgensonne. Zwar habe ich gestern Abend selbst Troense als
nächstes Ziel vorgeschlagen und vom Blick auf die
Südsee von
der Bregninge Kirke vorgeschwärmt. Zwar habe ich mich eben
noch
zusammengerissen, wie man sich eben zusammenreißt, und auf
Lene
verkündet, dass wir ja bald auslaufen könnten. Doch
jetzt
will ich einfach nur: Nichts! Nichts nichts und nichts. Und vor allem:
In Ruhe gelassen werden.
Erik tapert an Bord und öffnet den Reißverschluss
der
Kuchenbude. Pommery und Lene sind klar zum Auslaufen. Und Paula soll
doch voranfahren - sie wollen mir ja schließlich beim
Ausparken
helfen. "Ja hm keine Lust", murmele ich. "Wir trinken mal noch n
Kaffee", schlägt Erik vor, "und behalten die Kuchenbude im
Blick."
Es gab auch Leckerbissen in dieser Woche. Einer davon war die Quiche,
die Hille auf Lene zubereitete. Erik konnte mich schließlich
doch
noch überreden, daran teilzuhaben, und es wurde - da ich mich
vorübergehend beruhigt hatte - ein wirklich schöner
Abend. Am Tag davor trafen sich Pommery und Paula zu einem spannenden
Ausflug in die
Idylle des Haderslev Fjords. Eigentlich hatten wir uns Samstagabend
schon verabredet. Nach zwei Bootsübergaben wartete ich in
Arnis
auf Wind. Der war zunächst erst für achtzehn Uhr
angekündigt, ich hatte also damit gerechnet, in die Nacht
hinein
nördlich um Als herumzusegeln. Erik startete in
Hørup Hav
in der Annahme, er täte uns einen Gefallen, wenn er
möglichst
weit nach Norden vordringt. Pommery erwartete uns in Varnæs
eingangs des Aabenraa Fjords.
Doch wir legten um vierzehn Uhr schon ab, kamen eine Weile gut voran
und schafften in Sønderborg locker die vorletzte
Brücke
(die drittletzte verpassten wir um fünf Minuten). In der
einschlafenden Abendbrise schafften wir es noch ein gutes
Stück
durch den Als Sund bis zur Dunkelheit. Vor Anker war es herrlich,
einsam und ungestört, nur die Mücken nervten.
 Während
wir den Vormittag in der Strömung trieben, kam ich mit dem
Vorschlag Haderslev. Ich meinte: Heute mal sehen, wie weit wir kommen,
vielleicht ja nur zu Erik nach Varnæs. Doch der meldete sich
auf
halber Strecke bis Aarøsund. Er hatte nämlich die
Idee,
heute schon mit dem Südost reinzusegeln und Montag mit dem
Nordwest wieder raus. Machte ja auch Sinn, und es lief
schließlich wirklich gut.
Wir mussten dann im Sund nur gegen die gewaltige Strömung
ansegeln, während der Südost allmählich
aufgab. Wir
versuchten unser Glück ufernah an der
jütländischen
Seite, mussten zwar eine Sandbank umrunden, waren aber doch deutlich
schneller als diejenigen, die in Fahrwassermitte fast stehenblieben.
Pommery erwartete uns eingangs des Haderslev Fjords.
Während
wir den Vormittag in der Strömung trieben, kam ich mit dem
Vorschlag Haderslev. Ich meinte: Heute mal sehen, wie weit wir kommen,
vielleicht ja nur zu Erik nach Varnæs. Doch der meldete sich
auf
halber Strecke bis Aarøsund. Er hatte nämlich die
Idee,
heute schon mit dem Südost reinzusegeln und Montag mit dem
Nordwest wieder raus. Machte ja auch Sinn, und es lief
schließlich wirklich gut.
Wir mussten dann im Sund nur gegen die gewaltige Strömung
ansegeln, während der Südost allmählich
aufgab. Wir
versuchten unser Glück ufernah an der
jütländischen
Seite, mussten zwar eine Sandbank umrunden, waren aber doch deutlich
schneller als diejenigen, die in Fahrwassermitte fast stehenblieben.
Pommery erwartete uns eingangs des Haderslev Fjords.
Für einen kurzen Klönschnack liefen die Boote
nebeneinander,
dann zog Paula ein Stück davon. Nichtmal eine Meile weiter
schlugen die Segel - Westwind. Ich dachte mir: Dann kreuzen wir eben.
Wer den Haderslev Fjord nicht kennt, dem sei gesagt: Er ist sieben
Meilen lang und die ganze Strecke landschaftlich so schön wie
die
Missunder Enge, dem megakurzen, wahrhaft idyllischen Höhepunkt
der
Schlei. Also durchaus lohnend, es gibt immer etwas zu gucken und zu
erträumen. Die Mehrheit der Segler - die die Yacht oder die
DK-Törnführer liest - kommt gar nicht erst her, man
müsste ja ewig motoren (das ist wieder ein Thema für
einen
eigenen Blogeintrag). Die Verkehrslage ist also gering. Das Fahrwasser
ist an sich nicht wirklich eng, jedenfalls nicht für
Folkebootmaßstäbe, aber es ist durchaus ernst
gemeint und
kann nur um wenige Bootslängen verlassen werden. Es
mäandriert, und wenn nunmal tendenziell gegenan ist, sorgen
die
Ufer und die Bewaldung dafür, dass wirklich permanent genau
gegenan ist.
Paula kreuzte nach Echolot: Zu Beginn fuhr ich die Wenden, wenn es 3
Meter anzeigte, später wurde mir das angesichts der steilen
Kanten
oft zu knapp, also war es eher bei 4 Metern. Pommery hat kein Echolot,
also wussten wir, welches Geburtstagsgeschenk sich Pommery für
ihren Eigner wünschen würde. Was ich nicht wusste:
Erik
manövrierte nach elektronischer Seekarte. Für mich
wirkte das
eher wie the beauty of innocence: Wenn man nicht weiß, wie
flach
es wirklich ist, kann man die Schläge erheblich
länger
ausfahren. Pommery kam auf. Außer auf die Tiefe und den
Verkehr
zu achten, galt es auch noch den Trimm ständig anzupassen -
dass
ich nebenbei fotografierte, war sicher nicht hilfreich.
 An
einer der romantischsten Stellen hörte ich hinter mir das
hässliche Wort "Scheiße!". Pommery saß
fest. Ja, in
der Nähe einer Fahrwassertonne und mit gutem Willen betrachtet
genau im Tonnenstrich - aber auch höchstens drei Meter vom
Schilfgürtel entfernt. Wir kringelten zunächst eher
deswegen,
weil wir ja nicht einfach weitersegeln konnten, während unsere
Freunde ohne zuverlässig funktionierenden Motor im Schlick
steckten. Weil es gerade so gut passte und wir schön in der
Abdeckung waren, ließ ich die Segel oben und spontan den
Außenborder runter und startete ihn. Erik beschrieb es
hinterher
so, als hätte ich beim Ablassen das Startseil festgehalten.
Ich
drückte ihm unsere Achterleine in die Hand, dann kam Paula
erstmal
selbst fest, also gab ich Gas und ruckelte am Want, bis Paula wieder
schwamm. Pommery noch nicht, also gab ich schließlich etwas
mehr
Gas, und dann konnten wir beide weitersegeln.
An
einer der romantischsten Stellen hörte ich hinter mir das
hässliche Wort "Scheiße!". Pommery saß
fest. Ja, in
der Nähe einer Fahrwassertonne und mit gutem Willen betrachtet
genau im Tonnenstrich - aber auch höchstens drei Meter vom
Schilfgürtel entfernt. Wir kringelten zunächst eher
deswegen,
weil wir ja nicht einfach weitersegeln konnten, während unsere
Freunde ohne zuverlässig funktionierenden Motor im Schlick
steckten. Weil es gerade so gut passte und wir schön in der
Abdeckung waren, ließ ich die Segel oben und spontan den
Außenborder runter und startete ihn. Erik beschrieb es
hinterher
so, als hätte ich beim Ablassen das Startseil festgehalten.
Ich
drückte ihm unsere Achterleine in die Hand, dann kam Paula
erstmal
selbst fest, also gab ich Gas und ruckelte am Want, bis Paula wieder
schwamm. Pommery noch nicht, also gab ich schließlich etwas
mehr
Gas, und dann konnten wir beide weitersegeln.
Leider hatte sich währenddessen der Akku von Eriks Tablet
verabschiedet und mit ihm die elektronische Seekarte, während
unser Echolot weiterhin hervorragend funktionierte. Vielleicht war es
auch Angst vs. Selbstvertrauen, jedenfalls setzten wir uns ab. Als ein
holländischer Traditionssegler durch die Rinne motorte, hielt
Erik
Pommery an einer Fahrwassertonne fest. Paula war da schon mit Anlegen
beschäftigt. Der Holländer irritierte dabei auch uns,
denn
als Paula gegen den Wind in Vorleine und Achterspring an die Pier
trieb, gab ihr das holländische Schraubenwasser
plötzlich
Schub und verursachte mir einen hektischen Sprung an die Achterleine.
Anderntags also weiterhin Nordwest und die Verabredung auf
Lyø.
Außenlieger Pommery fuhr los, wir folgten, und richtig
interessant wurde es, als wir potenziell raumschots einer Baumreihe zu
folgen hatten: Statt des Gradientwindes bekamen wir es mit allerlei
Turbulenzen zu tun. Nach zwanzig Patenthalsen auf dreihundert Metern
beschloss ich: Paula segelt nun da, wo der Wind ist. Also der
Gradientwind. Und den fanden wir entlang der Dreimeterlinie (Echolot
sei Dank!) außerhalb des roten Tonnenstrichs. Pommery mochte
einen Vorsprung gehabt haben, aber jetzt stand sie in den Turbulenzen,
und wir sausten in Lee vorbei. Es war Segeln in allen Facetten, wie sie
in Binnenrevieren geläufig sein mögen. Als wir die
offene See
erreichten, waren es zuerst Paula und ich, die sich den grotesken
Windphänomenen weiterhin stellen mussten, bananenartig
biegenden
Großbaum inbegriffen.
So. Nun also: Ich will nicht hierbleiben. Ich will nicht segeln. Ich
will niemanden sehen, auch Erik und die Anderen nicht. Und ich will
niemandem erklären, was los ist. Ein Dilemma.
Schließlich gewinnt der Fluchtinstinkt: Ich mache Paula
segelklar
und ziehe sie ohne Eriks Hilfe aus der Box. Er geht nochmal zum Klo,
als er das bemerkt. Ich stoße Paula ab, ziehe die Fock hoch,
wir
segeln aus dem Hafen, gerade rechtzeitig vor der ankommenden
Fähre, auf die ich überhaupt nicht geachtet habe.
Die braucht lange zum Anlegen, keine Ahnung, was sie für ein
Problem hat. Pommery und Lene sind solange im Hafen gefangen. Als sie
endlich rauskommen, sind wir schon am Lyø Sand vorbei. Noch
in
Sichtweite, aber nicht mehr von all den anderen Segelbooten zu
unterscheiden. So fällt nicht auf, dass wir in Korshavn
anlegen,
wo es ruhig und halbwegs leer und angenehm einsam ist. Ich warte, bis
die beiden Folkes vorbei sind, dann schicke eine SMS mit dem Tenor:
"Wundert euch nicht."
 Morgens
geht es mir wieder besser. Auch der Wind lässt
vorübergehend
auf ein Maß nach, bei dem es Spaß machen
dürfte, zu
segeln. Ich versuche in Aerøskøbing
Geburtstagskuchen
für Erik aufzutreiben. Die Liegeplatzsituation ist
ähnlich
wie auf Lyø, ich gebe den Plan auf, wir segeln einfach
zurück nach Korshavn. Unterwegs treffen wir Pommery. Abends
kommen
noch Deppenbrocks mit ihren Mälarkreuzern: Die Eltern auf der
großen Lucky, Tochter nebst Freund auf der kleineren Josefin.
Passt alles rein in diesen bezaubernden Hafen. Der blöde
Zwischenhochkeil mit dem kalten, pustigen Drecks-Nordwest weicht dem
nächsten Tiefausläufer, bei einem unsteten
Westsüdwest
ist der ungeliebte Rückweg an die Schlei ein bisschen
zäh.
Immerhin: Diesmal ohne Motor, bis in Kappeln der Wind
einschläft.
Ich bin ganz zufrieden.
Morgens
geht es mir wieder besser. Auch der Wind lässt
vorübergehend
auf ein Maß nach, bei dem es Spaß machen
dürfte, zu
segeln. Ich versuche in Aerøskøbing
Geburtstagskuchen
für Erik aufzutreiben. Die Liegeplatzsituation ist
ähnlich
wie auf Lyø, ich gebe den Plan auf, wir segeln einfach
zurück nach Korshavn. Unterwegs treffen wir Pommery. Abends
kommen
noch Deppenbrocks mit ihren Mälarkreuzern: Die Eltern auf der
großen Lucky, Tochter nebst Freund auf der kleineren Josefin.
Passt alles rein in diesen bezaubernden Hafen. Der blöde
Zwischenhochkeil mit dem kalten, pustigen Drecks-Nordwest weicht dem
nächsten Tiefausläufer, bei einem unsteten
Westsüdwest
ist der ungeliebte Rückweg an die Schlei ein bisschen
zäh.
Immerhin: Diesmal ohne Motor, bis in Kappeln der Wind
einschläft.
Ich bin ganz zufrieden.
weiter: "Wir
sind gesegelt, wo der Fisch steht" - das Folkebootesammeln geht weiter

