| Paulas Törnberichte | 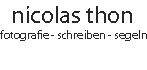 |
|||||
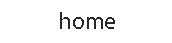 |
 |
 |
 |
 |

|
|

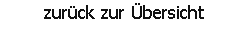
Hunderachtzig
Meilen Gegenwind (Sommerreise Teil 3)
Passender Wind von morgens bis abends, man schleicht sich früh
aus dem Hafen, genießt in wachsender Euphorie die
Rauschefahrt, es geht so super voran, dass gar keine Zeit bleibt,
müde zu werden, und wenn man nachmittags anlegt, hat man
richtig viel Strecke geschafft – ihr kennt alle solche
glorreichen Segeltage.
So einen hatten wir einmal auch...
Juli 2023
 Die
Prognose war ein Desaster: Ich befürchtete, die komplette
Strecke von Simrishamn nach Svendborg aufkreuzen zu müssen,
und zwar an den wenigen Tagen, an denen sich der Gegenwind in
vertretbarem Rahmen hielt. Zwischendurch war ich mir nicht mehr sicher,
ob wir es rechtzeitig schaffen würden, konnte um zwei Uhr
nicht mehr schlafen, studierte wieder und wieder den Wetterbericht und
grübelte über der Seekarte. Die vielen windbedingten
Hafentage hätten zu Beginn nicht sein müssen, sorgten
allerdings dafür, dass wir unsere Kräfte einteilen und
regenerieren konnten – und wir verbrachten sie an
wundervollen Orten, die den Aufenthalt wirklich wert waren.
Die
Prognose war ein Desaster: Ich befürchtete, die komplette
Strecke von Simrishamn nach Svendborg aufkreuzen zu müssen,
und zwar an den wenigen Tagen, an denen sich der Gegenwind in
vertretbarem Rahmen hielt. Zwischendurch war ich mir nicht mehr sicher,
ob wir es rechtzeitig schaffen würden, konnte um zwei Uhr
nicht mehr schlafen, studierte wieder und wieder den Wetterbericht und
grübelte über der Seekarte. Die vielen windbedingten
Hafentage hätten zu Beginn nicht sein müssen, sorgten
allerdings dafür, dass wir unsere Kräfte einteilen und
regenerieren konnten – und wir verbrachten sie an
wundervollen Orten, die den Aufenthalt wirklich wert waren.
 In
der zweiten Woche gingen uns die Reservetage allmählich
aus. Es durfte jetzt wirklich nichts mehr schiefgehen. Doch der
vorletzte Reisetag hielt nicht nur, was er versprach, es lief sogar
noch viel besser als in unerschütterlichem Optimismus erhofft:
Vordingborg-Lohals, 44 Meilen, ein Viertel der Gesamtstrecke in einem
einzigen Tag. Am letzten Tag wurden sogar die verstaubten Fockausbaumer
aus der Vorpiek gezerrt. So wurde es eine Reise voller
Eindrücke und Erlebnisse entlang einer neuen Strecke.
In
der zweiten Woche gingen uns die Reservetage allmählich
aus. Es durfte jetzt wirklich nichts mehr schiefgehen. Doch der
vorletzte Reisetag hielt nicht nur, was er versprach, es lief sogar
noch viel besser als in unerschütterlichem Optimismus erhofft:
Vordingborg-Lohals, 44 Meilen, ein Viertel der Gesamtstrecke in einem
einzigen Tag. Am letzten Tag wurden sogar die verstaubten Fockausbaumer
aus der Vorpiek gezerrt. So wurde es eine Reise voller
Eindrücke und Erlebnisse entlang einer neuen Strecke.
 Samstag:
Wir liegen in Simrishamn, die Gäste reisen an. Ab Ystad ist
Schienenersatzverkehr, der Bus steht im Stau – in Kivik ist
Jahrmarkt. Ich werde bombardiert mit SMS und Mails besorgter Charterer,
die befürchten, mit ihrer Verspätung die ganze Gruppe
aufzuhalten. Alles Neukunden: Sie haben meine Törnberichte
gelesen, aber wir kennen einander noch nicht, sie haben neben reichlich
Vorfreude nur eine vage Vorstellung, was sie erwartet und wie das bei
uns läuft. Das ist hochgradig spannend, aber im Stau kann es
auf die Stimmung drücken. Ich antworte eilig mit beruhigenden
Worten: Ich bin ja hier und erwarte euch! Frieda wartet ein bisschen
länger: Bernd muss Montag noch arbeiten, er und sein Sohn Knud
kommen also erst Dienstag und hoffen uns dann noch einzuholen. Als
ansonsten alle da sind, entspannen wir uns erstmal.
Samstag:
Wir liegen in Simrishamn, die Gäste reisen an. Ab Ystad ist
Schienenersatzverkehr, der Bus steht im Stau – in Kivik ist
Jahrmarkt. Ich werde bombardiert mit SMS und Mails besorgter Charterer,
die befürchten, mit ihrer Verspätung die ganze Gruppe
aufzuhalten. Alles Neukunden: Sie haben meine Törnberichte
gelesen, aber wir kennen einander noch nicht, sie haben neben reichlich
Vorfreude nur eine vage Vorstellung, was sie erwartet und wie das bei
uns läuft. Das ist hochgradig spannend, aber im Stau kann es
auf die Stimmung drücken. Ich antworte eilig mit beruhigenden
Worten: Ich bin ja hier und erwarte euch! Frieda wartet ein bisschen
länger: Bernd muss Montag noch arbeiten, er und sein Sohn Knud
kommen also erst Dienstag und hoffen uns dann noch einzuholen. Als
ansonsten alle da sind, entspannen wir uns erstmal.
 Sonntag:
Einweisung. Gleich wird klar, dass es keine Segelneulinge sind
– das Gegenteil ist der Fall: Hannes segelt in der zweiten
schweizerischen Segelliga, Simone bringt vor allem große
Begeisterung mit, und sie sind ein eingespieltes Team. Susanne und
Andreas haben neben reichlich sonstiger Erfahrung, vorwiegend auf der
Elbe, schon mehrfach in Flensburg und Maasholm Folkeboote gechartert.
Nun sind die dem Charme unserer Sommerreisen (und der Empfehlung von
Susanne / Folkeboot Louise) erlegen. Es ist eine Gruppe, auf die ich
mich seglerisch verlassen kann. Es wird aber auch gleich transparent:
Die wollen gar nicht nur segeln, jeden Tag von morgens bis abends! Sie
möchten Skåne und das Smålands Fahrwasser
kennenlernen, erleben, entdecken, erkunden, und gerne auch mal an einen
schönen Strand. Die vielen Hafentage, die uns bevorstehen,
sind also kein Verlust.
Sonntag:
Einweisung. Gleich wird klar, dass es keine Segelneulinge sind
– das Gegenteil ist der Fall: Hannes segelt in der zweiten
schweizerischen Segelliga, Simone bringt vor allem große
Begeisterung mit, und sie sind ein eingespieltes Team. Susanne und
Andreas haben neben reichlich sonstiger Erfahrung, vorwiegend auf der
Elbe, schon mehrfach in Flensburg und Maasholm Folkeboote gechartert.
Nun sind die dem Charme unserer Sommerreisen (und der Empfehlung von
Susanne / Folkeboot Louise) erlegen. Es ist eine Gruppe, auf die ich
mich seglerisch verlassen kann. Es wird aber auch gleich transparent:
Die wollen gar nicht nur segeln, jeden Tag von morgens bis abends! Sie
möchten Skåne und das Smålands Fahrwasser
kennenlernen, erleben, entdecken, erkunden, und gerne auch mal an einen
schönen Strand. Die vielen Hafentage, die uns bevorstehen,
sind also kein Verlust.
 Eigentlich
würden alle gerne noch eine Spaßrunde vor der
Haustür segeln, doch bei der Segeleinweisung faucht der erste
Drücker durch den Hafen. Das Setzen und Bergen des
Großsegels simulieren wir mit einer Wurfleine, das Segel
bleibt unten und das Boot am Steg. Montag gehen wir es an: Wir treiben
und kreuzen die sechs Meilen nach Skillinge. Ohne Wind gegen die
Strömung Höhe zu laufen, ist eine undankbare Aufgabe,
doch zwei Schauerböen bringen uns voran. Als es aufklart, verbleibt ein
Brischen, und wir erreichen gut gelaunt unser Ziel.
Denn wir sind gesegelt!
Eigentlich
würden alle gerne noch eine Spaßrunde vor der
Haustür segeln, doch bei der Segeleinweisung faucht der erste
Drücker durch den Hafen. Das Setzen und Bergen des
Großsegels simulieren wir mit einer Wurfleine, das Segel
bleibt unten und das Boot am Steg. Montag gehen wir es an: Wir treiben
und kreuzen die sechs Meilen nach Skillinge. Ohne Wind gegen die
Strömung Höhe zu laufen, ist eine undankbare Aufgabe,
doch zwei Schauerböen bringen uns voran. Als es aufklart, verbleibt ein
Brischen, und wir erreichen gut gelaunt unser Ziel.
Denn wir sind gesegelt!
 Dienstag
pustet es wie hulle, wir machen Hafentag. Der unscheinbare Ort entpuppt
sich als Juwel: Die gepflegten Gärten sind trotz Trockenheit
schön anzusehen, und die Gäste unternehmen einen
Ausflug zum Sandstrand von Sandhammaren. Ich bin kein
Strandgänger, sondern Bademuffel, und habe eine Abneigung
gegen feinen Sand in den Haaren und sämtlichen Klamotten,
außerdem gibt es Büroarbeit zu erledigen. Ich bleibe
also im Hafen – und verpasse etwas. Fast niemand segelt freiwillig die Küste von Skånen
entlang, doch jetzt stellt sich heraus: Völlig zu Unrecht. Es
gibt reizvolle und sehenswerte Orte hier, und wir haben die Chance,
einige von ihnen zu erkunden.
Dienstag
pustet es wie hulle, wir machen Hafentag. Der unscheinbare Ort entpuppt
sich als Juwel: Die gepflegten Gärten sind trotz Trockenheit
schön anzusehen, und die Gäste unternehmen einen
Ausflug zum Sandstrand von Sandhammaren. Ich bin kein
Strandgänger, sondern Bademuffel, und habe eine Abneigung
gegen feinen Sand in den Haaren und sämtlichen Klamotten,
außerdem gibt es Büroarbeit zu erledigen. Ich bleibe
also im Hafen – und verpasse etwas. Fast niemand segelt freiwillig die Küste von Skånen
entlang, doch jetzt stellt sich heraus: Völlig zu Unrecht. Es
gibt reizvolle und sehenswerte Orte hier, und wir haben die Chance,
einige von ihnen zu erkunden.
 Gleichwohl
sind wir ja zum Segeln hier, und das kam bisher ein wenig zu kurz.
Sechs Meilen in vier Stunden ist ja schon eine schwache Bilanz, aber
genau genommen waren es sechs Meilen in vier Tagen! Gleichzeitig finde
ich diesen Beginn durchaus gelungen: Wir haben uns – auch,
aber nicht nur, dem Wind geschuldet – Zeit gelassen
für Einweisung, Ankommen, Kennenlernen, Erholen von der
Anreise. Hundertachtzig Meilen sind nicht viel für
zwei Wochen – es entspricht einem Schnitt von
fünfzehn Meilen pro Tag. Nur sehe ich in der Prognose immer
nur West und immer nur dann Böen sechs, wenn es keine siebener
Böen sind. Ein Hoffnungsschimmer hier und da – der
sich mit dem nächsten Update gleich wieder erledigt. Jeder
Hafentag bedeutet dreißig Meilen an einem anderen –
und gegenan sind schon zehn, fünfzehn Meilen ein Kraftakt.
Gleichwohl
sind wir ja zum Segeln hier, und das kam bisher ein wenig zu kurz.
Sechs Meilen in vier Stunden ist ja schon eine schwache Bilanz, aber
genau genommen waren es sechs Meilen in vier Tagen! Gleichzeitig finde
ich diesen Beginn durchaus gelungen: Wir haben uns – auch,
aber nicht nur, dem Wind geschuldet – Zeit gelassen
für Einweisung, Ankommen, Kennenlernen, Erholen von der
Anreise. Hundertachtzig Meilen sind nicht viel für
zwei Wochen – es entspricht einem Schnitt von
fünfzehn Meilen pro Tag. Nur sehe ich in der Prognose immer
nur West und immer nur dann Böen sechs, wenn es keine siebener
Böen sind. Ein Hoffnungsschimmer hier und da – der
sich mit dem nächsten Update gleich wieder erledigt. Jeder
Hafentag bedeutet dreißig Meilen an einem anderen –
und gegenan sind schon zehn, fünfzehn Meilen ein Kraftakt.
 Mittwoch:
Oli, Martha und Paula laufen um fünf Uhr aus Skillinge aus. Es
ist überhaupt kein Wind. Von Norden her – aus
Simrishamn – kommt eine ganze Armada auf, erreicht das
Flautenfeld und startet den Diesel. Erneut brauchen wir fast vier
Stunden für die ersten sechs Meilen. Zwischendurch regnet es.
Mal kommt Wind auf, dann flaut er wieder ab. Mal zeigt sich vor uns
Gekräusel, doch es folgt die Enttäuschung, als wir es
endlich erreichen und statt vorher 1,4 Knoten auch nur 1,9 Knoten
schaffen. Erst ab der Ecke bei Sandhammaren entfaltet sich eine stetige
Brise. Wir segeln einen guten Holeschlag nach Südwesten, dann
wenden wir. Bornholm ist in Sicht, die blöde Insel, zu der ich
schon so häufig hinwollte und nie hinkam, existiert also
wirklich. Wir machen aber jetzt bestimmt nicht den Fehler, zwanzig
Meilen nach Osten zu segeln.
Mittwoch:
Oli, Martha und Paula laufen um fünf Uhr aus Skillinge aus. Es
ist überhaupt kein Wind. Von Norden her – aus
Simrishamn – kommt eine ganze Armada auf, erreicht das
Flautenfeld und startet den Diesel. Erneut brauchen wir fast vier
Stunden für die ersten sechs Meilen. Zwischendurch regnet es.
Mal kommt Wind auf, dann flaut er wieder ab. Mal zeigt sich vor uns
Gekräusel, doch es folgt die Enttäuschung, als wir es
endlich erreichen und statt vorher 1,4 Knoten auch nur 1,9 Knoten
schaffen. Erst ab der Ecke bei Sandhammaren entfaltet sich eine stetige
Brise. Wir segeln einen guten Holeschlag nach Südwesten, dann
wenden wir. Bornholm ist in Sicht, die blöde Insel, zu der ich
schon so häufig hinwollte und nie hinkam, existiert also
wirklich. Wir machen aber jetzt bestimmt nicht den Fehler, zwanzig
Meilen nach Osten zu segeln.
 Der
Westwind dreht südlicher und noch ein bisschen
südlicher, und wir können Ystad beinahe anlegen. Nur
wollen wir hier gar nicht hin, sondern wenn es irgendwie geht sieben
Meilen weiter nach Abbekås. Es hängt nicht unser
Leben davon ab, dass wir das schaffen, aber es wäre schon
hilfreich für den weiteren Verlauf. Im Vorbeisegeln stelle ich
fest: In Kåseberga östlich von Ydstad hätte es uns allen sehr gut
gefallen! Der winzige Ort ist umgeben von einer skurrilen
Steilküstenlandschaft: Gras, hier und da ein einzelner,
tapferer Baum, obendrauf ein vom Wasser aus erkennbarer Steinkreis aus
der Wikingerzeit.
Der
Westwind dreht südlicher und noch ein bisschen
südlicher, und wir können Ystad beinahe anlegen. Nur
wollen wir hier gar nicht hin, sondern wenn es irgendwie geht sieben
Meilen weiter nach Abbekås. Es hängt nicht unser
Leben davon ab, dass wir das schaffen, aber es wäre schon
hilfreich für den weiteren Verlauf. Im Vorbeisegeln stelle ich
fest: In Kåseberga östlich von Ydstad hätte es uns allen sehr gut
gefallen! Der winzige Ort ist umgeben von einer skurrilen
Steilküstenlandschaft: Gras, hier und da ein einzelner,
tapferer Baum, obendrauf ein vom Wasser aus erkennbarer Steinkreis aus
der Wikingerzeit.
 Paula
läuft nicht die Höhe, die Martha schafft. Oliese
saust vor uns davon. Das ist neu und ungewohnt. Ich finde das gut
– für mein Ego brauche ich es nicht, stets schneller
als die Chartergäste zu sein, sondern dies hier spricht
für sie und für den Zustand der Boote. Sie haben aber
mitgebucht oder jedenfalls versprochen bekommen, dass ich für
sie den Zielhafen auskundschafte und ihnen beim Anlegen helfe
– es wäre schlecht, wenn sie darauf stundenlang
warten müssten. Als vor Ystad per Funk die Frage diskutiert
wird, ob wir dort anlegen oder weitersegeln, ist Paula so weit
zurück, dass ich im Rauschen kaum ein Wort verstehe.
„Weitersegeln“, propagiere ich.
Paula
läuft nicht die Höhe, die Martha schafft. Oliese
saust vor uns davon. Das ist neu und ungewohnt. Ich finde das gut
– für mein Ego brauche ich es nicht, stets schneller
als die Chartergäste zu sein, sondern dies hier spricht
für sie und für den Zustand der Boote. Sie haben aber
mitgebucht oder jedenfalls versprochen bekommen, dass ich für
sie den Zielhafen auskundschafte und ihnen beim Anlegen helfe
– es wäre schlecht, wenn sie darauf stundenlang
warten müssten. Als vor Ystad per Funk die Frage diskutiert
wird, ob wir dort anlegen oder weitersegeln, ist Paula so weit
zurück, dass ich im Rauschen kaum ein Wort verstehe.
„Weitersegeln“, propagiere ich.
Prompt dreht der Wind ungünstig und lässt ein wenig
nach. Doch nach Ystad? Ha! Ich erkenne, dass weiter draußen
mehr Wind ist als direkt unter Land – man muss unter dem
Wolkenband bleiben, wenn man schnell sein will. Wir schaffen es in
nochmal drei Stunden, die sieben Meilen aufzukreuzen. Die drei Boote
erreichen gleichzeitig den überaus sympathischen Hafen.
 Das
gemeinsame Anlegebier aus Marthas Bilge entwickelt sich zur festen
Institution. In elf Stunden auf dem Wasser ist eine Menge passiert, wir
haben uns viel zu erzählen. Unterdessen ist Frieda auch unterwegs und hat den Segeltag
in Kåseberga beendet – wir sind fast
ein bisschen neidisch. Für den nächsten Tag nehmen
wir uns nicht zu viel vor: Zehn Meilen bis Smygehamn, Auslaufen gegen
neun. Es ist aber eine Kreuz, und zwar bei 5 Böen 6. Paula
legt zuerst ab, um den Anderen in der engen Ecke Platz zum Drehen zu geben. Daran liegt
es aber nicht, dass wir Schlag um Schlag davonsegeln: Paula findet die
Bedingungen richtig großartig, fliegt beinahe durchs
Gekabbel. Mit Feintrimm am Traveller gelingt es, dass sie auf
Backbordbug genauso schnell ist wie auf Steuerbordburg, obwohl die
Welle nicht in Windrichtung kommt und sie seit Jahren oder immer schon
mit Wind von Backbord schneller ist. Kaum Ruderdruck, fliegende Gischt,
unser Ziel ist in Sicht und kommt näher und näher,
während Martha und Oli zurückfallen – ich
genieße es zutiefst.
Das
gemeinsame Anlegebier aus Marthas Bilge entwickelt sich zur festen
Institution. In elf Stunden auf dem Wasser ist eine Menge passiert, wir
haben uns viel zu erzählen. Unterdessen ist Frieda auch unterwegs und hat den Segeltag
in Kåseberga beendet – wir sind fast
ein bisschen neidisch. Für den nächsten Tag nehmen
wir uns nicht zu viel vor: Zehn Meilen bis Smygehamn, Auslaufen gegen
neun. Es ist aber eine Kreuz, und zwar bei 5 Böen 6. Paula
legt zuerst ab, um den Anderen in der engen Ecke Platz zum Drehen zu geben. Daran liegt
es aber nicht, dass wir Schlag um Schlag davonsegeln: Paula findet die
Bedingungen richtig großartig, fliegt beinahe durchs
Gekabbel. Mit Feintrimm am Traveller gelingt es, dass sie auf
Backbordbug genauso schnell ist wie auf Steuerbordburg, obwohl die
Welle nicht in Windrichtung kommt und sie seit Jahren oder immer schon
mit Wind von Backbord schneller ist. Kaum Ruderdruck, fliegende Gischt,
unser Ziel ist in Sicht und kommt näher und näher,
während Martha und Oli zurückfallen – ich
genieße es zutiefst.
 Zuletzt
nimmt der Wind eine Spur ab, sehr willkommen hinsichtlich des
Anlegens. Schauer ziehen südlich und nördlich vorbei
und lassen uns in Ruhe. Vor dem letzten Holeschlag segelt Paula auf den
Strand zu, und ich frage mich, wie weit man da ran kann – in
der Seekarte wird vor großen Steinen gewarnt. Eine Hallberg
Rassy 57 (!) motort vor uns durch. Ich denke: Wo die durchkommen, passt
es auch für uns. Außerdem: Schwedische Flagge
– die werden sich auskennen. Wir wenden hinter ihrem Heck
– Wassertiefe vier Meter, flacher muss ich es hier nicht mehr
haben. Paula nimmt wieder Fahrt auf. Vor uns ein Knall, gefolgt vom
Rappeln des Riggs. Ich brauche einen Moment, um zu verstehen, was
passiert ist: Die Rassy bewegt sich nicht mehr. Sie steht auf einem
Stein.
Zuletzt
nimmt der Wind eine Spur ab, sehr willkommen hinsichtlich des
Anlegens. Schauer ziehen südlich und nördlich vorbei
und lassen uns in Ruhe. Vor dem letzten Holeschlag segelt Paula auf den
Strand zu, und ich frage mich, wie weit man da ran kann – in
der Seekarte wird vor großen Steinen gewarnt. Eine Hallberg
Rassy 57 (!) motort vor uns durch. Ich denke: Wo die durchkommen, passt
es auch für uns. Außerdem: Schwedische Flagge
– die werden sich auskennen. Wir wenden hinter ihrem Heck
– Wassertiefe vier Meter, flacher muss ich es hier nicht mehr
haben. Paula nimmt wieder Fahrt auf. Vor uns ein Knall, gefolgt vom
Rappeln des Riggs. Ich brauche einen Moment, um zu verstehen, was
passiert ist: Die Rassy bewegt sich nicht mehr. Sie steht auf einem
Stein.
 Von
vier oder fünf Knoten auf null gestoppt zu werden, ist so, wie
wenn man mit dem Fahrrad gegen eine Mauer fährt: Da bleibt man
nicht auf dem Sattel sitzen. Im Cockpit der Yacht ist niemand zu sehen.
Ich bleibe in der Nähe und überlege, ob ich Sweden
Traffic anfunke oder 112 wähle. Der Käpt’n
taucht wieder auf. Offenbar hat er zunächst erste Hilfe
geleistet, auf jeden Fall ist er handlungsfähig. Die Yacht
kommt frei und tuckert langsam um den Hafen herum. Paula wendet und
nimmt Kurs auf die Einfahrt. Ein Rettungswagen fährt in den
Hafen.
Von
vier oder fünf Knoten auf null gestoppt zu werden, ist so, wie
wenn man mit dem Fahrrad gegen eine Mauer fährt: Da bleibt man
nicht auf dem Sattel sitzen. Im Cockpit der Yacht ist niemand zu sehen.
Ich bleibe in der Nähe und überlege, ob ich Sweden
Traffic anfunke oder 112 wähle. Der Käpt’n
taucht wieder auf. Offenbar hat er zunächst erste Hilfe
geleistet, auf jeden Fall ist er handlungsfähig. Die Yacht
kommt frei und tuckert langsam um den Hafen herum. Paula wendet und
nimmt Kurs auf die Einfahrt. Ein Rettungswagen fährt in den
Hafen.
 Auch
ohne Havaristen wäre das Einlaufen spannend genug: Bei diesem
Seegang ist der Außenborder frühestens im kleinen
Vorhafen eine Option. Bei halbem Wind möchte ich nicht mit dem
Groß in einen fremden Minihafen segeln, der erkennbar keinen
Platz für einen Aufschießer bietet. Also
Groß runter und mit der Fock rein. Zumindest als Back-up
möchte ich den Außenborder starten – doch
die Sonne hat den Benzinschlauch zerlegt, der Motor kriegt keinen
Sprit. Dann also ohne: Reinhühnern bei Geschaukel, im Vorhafen
Blick auf den Speed – 3 Knoten. Hm. Eins. Zwei. Drei. Runter
mit der Fock und hoffen, dass der Schwung gerade so reicht für
die schmale Einfahrt in den Innenhafen. Es klappt. Sogar mit
souveränem Anlegen. Martha und Oli lassen erstmal den
Havaristen innen an der Außenmole anlegen, wo die Sanis schon
warten.
Auch
ohne Havaristen wäre das Einlaufen spannend genug: Bei diesem
Seegang ist der Außenborder frühestens im kleinen
Vorhafen eine Option. Bei halbem Wind möchte ich nicht mit dem
Groß in einen fremden Minihafen segeln, der erkennbar keinen
Platz für einen Aufschießer bietet. Also
Groß runter und mit der Fock rein. Zumindest als Back-up
möchte ich den Außenborder starten – doch
die Sonne hat den Benzinschlauch zerlegt, der Motor kriegt keinen
Sprit. Dann also ohne: Reinhühnern bei Geschaukel, im Vorhafen
Blick auf den Speed – 3 Knoten. Hm. Eins. Zwei. Drei. Runter
mit der Fock und hoffen, dass der Schwung gerade so reicht für
die schmale Einfahrt in den Innenhafen. Es klappt. Sogar mit
souveränem Anlegen. Martha und Oli lassen erstmal den
Havaristen innen an der Außenmole anlegen, wo die Sanis schon
warten.
 Frieda
hat es bis Abbekås geschafft, was beeindruckend ist bei dem
Gepuste gegenan. Bernd ist begeistert von seinem
Achtzehnjährigen: Geduscht von Gischtfontänen las er
tapfer eine Artikel in der „Konkret“ zum Thema
Klimaveränderung. Ich werde ihn mir ausleihen, wenn die Seiten
noch zu entziffern sind – dieses Thema bewegt uns hier alle.
Südeuropa leidet unter Rekordhitze. Bei uns ist es
kühl, weil die westliche Strömung vom Atlantik kommt.
Doch eine so konstante Westlage mit permanent grenzwertiger
Böigkeit habe ich bei der Planung der Reise sicher nicht
erwartet. Uns wird hier nichts geschenkt, wir müssen es uns
erarbeiten.
Frieda
hat es bis Abbekås geschafft, was beeindruckend ist bei dem
Gepuste gegenan. Bernd ist begeistert von seinem
Achtzehnjährigen: Geduscht von Gischtfontänen las er
tapfer eine Artikel in der „Konkret“ zum Thema
Klimaveränderung. Ich werde ihn mir ausleihen, wenn die Seiten
noch zu entziffern sind – dieses Thema bewegt uns hier alle.
Südeuropa leidet unter Rekordhitze. Bei uns ist es
kühl, weil die westliche Strömung vom Atlantik kommt.
Doch eine so konstante Westlage mit permanent grenzwertiger
Böigkeit habe ich bei der Planung der Reise sicher nicht
erwartet. Uns wird hier nichts geschenkt, wir müssen es uns
erarbeiten.
 Smygehuk
ist bemerkenswert: Der südlichste Punkt
Schwedens. Und ein ehemaliger Kalkbruch. Es sieht aus, als
schwämmen die Boote in Milch. Vom Grund lösen sich
bizarre, quadratmetergroße Algenpakete. Sie tauchen auf,
driften ziellos herum, der Schwefelkohlenstoff entweicht. Es riecht
schwefelig, bis so viel Gas entwichen ist, dass der Auftrieb nicht mehr
genügt und das Paket wieder auf den Grund absinkt. Der
Leuchtturm ist besteigbar, auf dem Weg dahin soll man die Kreuzottern
nicht erschrecken - sie könnten dann beißen! Ich sehe
zwar keine, glaube aber, auf dem Weg ihre typischen Spuren im Sand
gesehen zu haben.
Smygehuk
ist bemerkenswert: Der südlichste Punkt
Schwedens. Und ein ehemaliger Kalkbruch. Es sieht aus, als
schwämmen die Boote in Milch. Vom Grund lösen sich
bizarre, quadratmetergroße Algenpakete. Sie tauchen auf,
driften ziellos herum, der Schwefelkohlenstoff entweicht. Es riecht
schwefelig, bis so viel Gas entwichen ist, dass der Auftrieb nicht mehr
genügt und das Paket wieder auf den Grund absinkt. Der
Leuchtturm ist besteigbar, auf dem Weg dahin soll man die Kreuzottern
nicht erschrecken - sie könnten dann beißen! Ich sehe
zwar keine, glaube aber, auf dem Weg ihre typischen Spuren im Sand
gesehen zu haben.
 Für
Donnerstag ist das eigentliche Ding vorgesehen: Ein langer Schlag bei
passendem Wind, um für den Rest der Reise wieder
Gestaltungsspielraum zu haben. Wir wollen
nach…Klintholm…Rødvig…nein,
doch nach Klintholm. Die Prognose ist alles andere als toll: Der Wind
passt nicht, sondern dreht von Südwest auf West und wieder zurück. Vierzig
Meilen ohne durchgängig einen Anlieger? Das kann eigentlich nur dazu
führen, dass wir Kräfte vergeuden, uns ins Nirvana
segeln und die bisher perfekte Stimmung den Bach runter geht. Paula
findet: Das wollen wir nicht. Wir wollen lieber den langen Schlag
unterteilen, und dazu passend gibt es ja den Falsterbokanal! Die
Einfahrt ist fünfzehn Meilen entfernt, im Kanal
müssen wir nur eine Meile motoren und die Öffnung der
Klappbrücke abwarten, dann wollen wir nochmal zehn Meilen
segeln um Falsterbo herum nach Skanör. Das wäre der
passende Ausgangspunkt für Samstag – bei Nordwest
zwanzig Meilen rüber nach Rødvig.
Für
Donnerstag ist das eigentliche Ding vorgesehen: Ein langer Schlag bei
passendem Wind, um für den Rest der Reise wieder
Gestaltungsspielraum zu haben. Wir wollen
nach…Klintholm…Rødvig…nein,
doch nach Klintholm. Die Prognose ist alles andere als toll: Der Wind
passt nicht, sondern dreht von Südwest auf West und wieder zurück. Vierzig
Meilen ohne durchgängig einen Anlieger? Das kann eigentlich nur dazu
führen, dass wir Kräfte vergeuden, uns ins Nirvana
segeln und die bisher perfekte Stimmung den Bach runter geht. Paula
findet: Das wollen wir nicht. Wir wollen lieber den langen Schlag
unterteilen, und dazu passend gibt es ja den Falsterbokanal! Die
Einfahrt ist fünfzehn Meilen entfernt, im Kanal
müssen wir nur eine Meile motoren und die Öffnung der
Klappbrücke abwarten, dann wollen wir nochmal zehn Meilen
segeln um Falsterbo herum nach Skanör. Das wäre der
passende Ausgangspunkt für Samstag – bei Nordwest
zwanzig Meilen rüber nach Rødvig.
 Sonnenschein,
Gischfontänen, Rauschefahrt – natürlich
geht es nicht ohne Holeschläge, aber es ist ein wirklich
toller Segeltag. Bis zwei Meilen vorm Kanal der Wind
einschläft. Ich zögere mit dem Naheliegenden, dem
Starten des Außenborders, bis es selbst mit Vollgas zu spät wäre für die Sechzehnuhrbrücke.
Wir tuckern also gemächlich zum Vorhafen, treiben im Leerlauf
mit der Strömung durch den Kanal. Zuletzt legen wir doch noch
im Dreierpäckchen am Wartesteg an, als sich herausstellt, dass
die Brücke keineswegs jede volle Stunde öffnet, wie
das Hafenhandbuch behauptet, sondern erst wieder um achtzehn Uhr. Wir trinken erstmal Kaffee, dann
diskutieren wir die Optionen. Wenig Wind, zu wenig, um es zu einer
halbwegs sinnvollen Zeit bis Skanör zu schaffen. Wir enden in
Höllviken direkt nördlich der Brücke.
Sonnenschein,
Gischfontänen, Rauschefahrt – natürlich
geht es nicht ohne Holeschläge, aber es ist ein wirklich
toller Segeltag. Bis zwei Meilen vorm Kanal der Wind
einschläft. Ich zögere mit dem Naheliegenden, dem
Starten des Außenborders, bis es selbst mit Vollgas zu spät wäre für die Sechzehnuhrbrücke.
Wir tuckern also gemächlich zum Vorhafen, treiben im Leerlauf
mit der Strömung durch den Kanal. Zuletzt legen wir doch noch
im Dreierpäckchen am Wartesteg an, als sich herausstellt, dass
die Brücke keineswegs jede volle Stunde öffnet, wie
das Hafenhandbuch behauptet, sondern erst wieder um achtzehn Uhr. Wir trinken erstmal Kaffee, dann
diskutieren wir die Optionen. Wenig Wind, zu wenig, um es zu einer
halbwegs sinnvollen Zeit bis Skanör zu schaffen. Wir enden in
Höllviken direkt nördlich der Brücke.
Kein
herausragend schöner Hafen. Aber ein Hafen. Und ein guter
Ausgangspunkt für Ausflüge zu Fuß oder per
Fahrrad am anstehenden Hafentag – bei West drei mit
Schauerböen bis sieben oder acht bin ich ganz froh, dass wir
uns nicht raus auf den Sund begeben haben. Es wäre auch schade
gewesen um die Erkundung der hübschen
Dünenlandschaft.
 Nach der Kalkulation mit einem Schnitt von fünfzehn Meilen pro
Tag haben wir fast drei Tage Rückstand, und das Wetter wird
nicht besser. Nun denn – auf nach Dänemark. Die
Prognose: Südwest, süddrehend 4-5 und Dauerregen. Der
Plan: Acht Uhr Brücke, zurück durch den Kanal, dann
Südkurs, und schließlich wenden, sobald entweder der
Wind dreht oder wir südlich des Verkehrstrennungsgebiets sind.
Es verspricht kein Tag zum Genießen zu werden. Den
Gästen verkaufe ich ihn so: „Ihr würdet mir
einen Gefallen tun, wenn ihr vorläufig nichts sagt von wegen
lang oder anstrengend. Ich weiß selber, dass es so ist. Aber
es lässt sich ja nicht ändern.“
Nach der Kalkulation mit einem Schnitt von fünfzehn Meilen pro
Tag haben wir fast drei Tage Rückstand, und das Wetter wird
nicht besser. Nun denn – auf nach Dänemark. Die
Prognose: Südwest, süddrehend 4-5 und Dauerregen. Der
Plan: Acht Uhr Brücke, zurück durch den Kanal, dann
Südkurs, und schließlich wenden, sobald entweder der
Wind dreht oder wir südlich des Verkehrstrennungsgebiets sind.
Es verspricht kein Tag zum Genießen zu werden. Den
Gästen verkaufe ich ihn so: „Ihr würdet mir
einen Gefallen tun, wenn ihr vorläufig nichts sagt von wegen
lang oder anstrengend. Ich weiß selber, dass es so ist. Aber
es lässt sich ja nicht ändern.“
 Brücke
und Kanal klappen reibungslos. Leichter Regen, dann
klart es vorübergehend auf, und die Sonne zeigt sich sogar.
Dafür mangelt es an Wind. Als Stellvertreter schickt er einen
Seehund. Er ist niedlich, doch helfen kann auch er uns nicht. Um die
Zeit nicht zu vergeuden, sondern zu nutzen, motoren wir wacker gegen
die hohe, sanfte Dünung an, bis sich Gekräusel zeigt.
In kurzer Zeit entfalten sich satte sechs Windstärken
in einem ersten Schauer. Nach der Wende können wir den
Sollkurs haargenau laufen. Wobei – oha: Der Wind dreht auf
Süd, Westkurs sollte kein Problem sein, doch die
Strömung gurgelt derart nordwärts, dass wir volles
Rohr Höhe laufen müssen. Der Kompass zeigt 240 Grad, mehr
Höhe geht nicht, und über Grund reicht es so eben und eben,
um Rødvig anzulegen - das sind dreißig Grad Versetzung. Gischt klatscht uns um die
Ohren, fällt eimerweise vom Masttopp ins Cockpit. Dauerregen
ist ein zutreffender Ausdruck, der Kartensatz weicht auf, die
Bilgepumpe ackert, und ich denke: Es ist ja Wassersport…
Hätt nicht der Seemann den Humor, ihm käm die See
versalzen vor – hab ich mal irgendwo gelesen, es
könnte am Türrahmen des Schulungsraums gewesen sein,
wo das Ganze hier mit einem Theoriekurs zum „Amtlichen
Sportbootführerscheine See“ seinen Anfang nahm.
Brücke
und Kanal klappen reibungslos. Leichter Regen, dann
klart es vorübergehend auf, und die Sonne zeigt sich sogar.
Dafür mangelt es an Wind. Als Stellvertreter schickt er einen
Seehund. Er ist niedlich, doch helfen kann auch er uns nicht. Um die
Zeit nicht zu vergeuden, sondern zu nutzen, motoren wir wacker gegen
die hohe, sanfte Dünung an, bis sich Gekräusel zeigt.
In kurzer Zeit entfalten sich satte sechs Windstärken
in einem ersten Schauer. Nach der Wende können wir den
Sollkurs haargenau laufen. Wobei – oha: Der Wind dreht auf
Süd, Westkurs sollte kein Problem sein, doch die
Strömung gurgelt derart nordwärts, dass wir volles
Rohr Höhe laufen müssen. Der Kompass zeigt 240 Grad, mehr
Höhe geht nicht, und über Grund reicht es so eben und eben,
um Rødvig anzulegen - das sind dreißig Grad Versetzung. Gischt klatscht uns um die
Ohren, fällt eimerweise vom Masttopp ins Cockpit. Dauerregen
ist ein zutreffender Ausdruck, der Kartensatz weicht auf, die
Bilgepumpe ackert, und ich denke: Es ist ja Wassersport…
Hätt nicht der Seemann den Humor, ihm käm die See
versalzen vor – hab ich mal irgendwo gelesen, es
könnte am Türrahmen des Schulungsraums gewesen sein,
wo das Ganze hier mit einem Theoriekurs zum „Amtlichen
Sportbootführerscheine See“ seinen Anfang nahm.
 Es
ist also tatsächlich kein Tag zum Genießen. Aber
mit einer Ankunft um sechzehn Uhr zu rechnen und schon um Viertel nach drei
das Groß zu bergen und in den Hafen zu hoppeln,
gefällt mir. „Es war lang“, jammert
Susanne, „und anstrengend.“ Kuchenbude aufbauen,
Heizlüfter anschmeißen, Klamotten trocknen, ausruhen
- morgen geht es weiter. Nun ist Rødvig kein Hafen, wo man
unter normalen Umständen freiwillig hinfahren sollte:
Hässlich, voll und bei Südwest ungeschützt.
Das ist doch wirklich keine allzu seltene und
außergewöhnliche Windrichtung – und wir
haben schon die schwellgeschütztesten Plätze (nicht
in jede Box passen wir von der Breite her rein, die Hecks ragen raus),
doch trotzdem rollen die Boote. Der Ort ist eher eine Siedlung ohne
Zentrum und Historie. Die Kalkabbrücke von Stevns Klint
würden in der Sonne sicher magisch wirken, das eigentliche
Highlight ist aber das Schiffsmotorenmuseum – eher ein
Nischenthema, wenn man ehrlich ist.
Es
ist also tatsächlich kein Tag zum Genießen. Aber
mit einer Ankunft um sechzehn Uhr zu rechnen und schon um Viertel nach drei
das Groß zu bergen und in den Hafen zu hoppeln,
gefällt mir. „Es war lang“, jammert
Susanne, „und anstrengend.“ Kuchenbude aufbauen,
Heizlüfter anschmeißen, Klamotten trocknen, ausruhen
- morgen geht es weiter. Nun ist Rødvig kein Hafen, wo man
unter normalen Umständen freiwillig hinfahren sollte:
Hässlich, voll und bei Südwest ungeschützt.
Das ist doch wirklich keine allzu seltene und
außergewöhnliche Windrichtung – und wir
haben schon die schwellgeschütztesten Plätze (nicht
in jede Box passen wir von der Breite her rein, die Hecks ragen raus),
doch trotzdem rollen die Boote. Der Ort ist eher eine Siedlung ohne
Zentrum und Historie. Die Kalkabbrücke von Stevns Klint
würden in der Sonne sicher magisch wirken, das eigentliche
Highlight ist aber das Schiffsmotorenmuseum – eher ein
Nischenthema, wenn man ehrlich ist.
 Als
ich mich zwei Stunden nach dem Anlegen halbwegs berappelt und schon
wieder die nächsten Tage geplant habe, irritiert mich
Geklöter aus der Nachbarschaft. Es klingt wie ein Folkeboot,
dass zwischen den Pfählen steckenbleibt. Wen sehe ich, als ich
den Reißverschluss der Kuchenbude öffne?
Super-Frieda hat es geschafft, uns einzuholen! Als die Fender aufgeholt
sind, passt sie sogar in die Box. Ich habe Tränen der Rührung in den Augen, Bernd nur
mittelmäßige Laune, und meine Wechselklamotten sind
auch schon wieder durchnässt, nachdem ich fünf
Minuten beim Anlegen assistiert habe. Aber egal - wir sind wieder
vereint! Was für ein grandioser Tag!
Als
ich mich zwei Stunden nach dem Anlegen halbwegs berappelt und schon
wieder die nächsten Tage geplant habe, irritiert mich
Geklöter aus der Nachbarschaft. Es klingt wie ein Folkeboot,
dass zwischen den Pfählen steckenbleibt. Wen sehe ich, als ich
den Reißverschluss der Kuchenbude öffne?
Super-Frieda hat es geschafft, uns einzuholen! Als die Fender aufgeholt
sind, passt sie sogar in die Box. Ich habe Tränen der Rührung in den Augen, Bernd nur
mittelmäßige Laune, und meine Wechselklamotten sind
auch schon wieder durchnässt, nachdem ich fünf
Minuten beim Anlegen assistiert habe. Aber egal - wir sind wieder
vereint! Was für ein grandioser Tag!

 Naja
– das nasse Spektakel hat Spuren hinterlassen. Beim
Briefing wirken alle mehr als skeptisch. Vor uns liegt ein Segeltag,
auf den ich mich seit Wochen riesig freue, nämlich seit wir
auf dem Hinweg beschlossen, über Klintholm zu segeln und nicht
durch den Bøge Strøm. Den werden wir heute
aufkreuzen, und niemand außer mir kann sich vorstellen, dass
das Spaß machen wird. Der Himmel ist wolkenverhangen, es ist
böig, jeder hat eine Wetterapp, die Anderes vorhersagt als
mäßigen Südwest und aufklarenden Himmel.
Segelsetzen ist ein Thema: Der Hafen ist eng, auf der Einfahrt steht
eine tüchtige See – wir müssen da mit
Vollzeug rauskreuzen, alles andere könnte schiefgehen. ich
weise auf die Fehler hin, dich man vermeiden sollte, und mache
Vorschläge, wo und wie das Tuch hoch. Ich habe noch nicht
ausgeredet, da wird schon widersprochen. Klar: So ist nach gestern die
Stimmung. Aber meine ist jetzt miserabel. Ich habe die Fehler ja alle
selbst gemacht, vor denen ich die Gäste bewahren will.
Als sie noch letzte Fallen anschlagen und die Rettungswesten anziehen,
legt Paula einfach ab. Wir treiben an den Kopf der Innenmole, dort
setze ich die Segel, dann sausen wir los.
Naja
– das nasse Spektakel hat Spuren hinterlassen. Beim
Briefing wirken alle mehr als skeptisch. Vor uns liegt ein Segeltag,
auf den ich mich seit Wochen riesig freue, nämlich seit wir
auf dem Hinweg beschlossen, über Klintholm zu segeln und nicht
durch den Bøge Strøm. Den werden wir heute
aufkreuzen, und niemand außer mir kann sich vorstellen, dass
das Spaß machen wird. Der Himmel ist wolkenverhangen, es ist
böig, jeder hat eine Wetterapp, die Anderes vorhersagt als
mäßigen Südwest und aufklarenden Himmel.
Segelsetzen ist ein Thema: Der Hafen ist eng, auf der Einfahrt steht
eine tüchtige See – wir müssen da mit
Vollzeug rauskreuzen, alles andere könnte schiefgehen. ich
weise auf die Fehler hin, dich man vermeiden sollte, und mache
Vorschläge, wo und wie das Tuch hoch. Ich habe noch nicht
ausgeredet, da wird schon widersprochen. Klar: So ist nach gestern die
Stimmung. Aber meine ist jetzt miserabel. Ich habe die Fehler ja alle
selbst gemacht, vor denen ich die Gäste bewahren will.
Als sie noch letzte Fallen anschlagen und die Rettungswesten anziehen,
legt Paula einfach ab. Wir treiben an den Kopf der Innenmole, dort
setze ich die Segel, dann sausen wir los.
 Man
weiß es vorher ja nie, aber es läuft:
Viereinhalb bis fünf Knoten, um die 190 Grad, das ist kein
Anlieger, aber ein hübscher Streckbug. Wir sausen unter einem
aufklarenden Himmel südwärts. Der Wind hält,
nach zwei Stunden wenden wir, und kurz darauf ist die Ansteuerungstonne
schon in Sicht. Martha hält mit, Frieda segelt wacker, Oliese
hält sich heute zurück. Perfekt im Zeitplan erreichen
wir in der Nachmittagssonne die geradlinige Baggerinne eingangs des
Bøge Strøm. Jetzt beginnt der kurzweilige Teil
mit einer Kreuz in kurzen Schlägen. Im weiteren Verlauf
mäandriert das Fahrwasser. Zwei Stunden gilt es, voll
konzentriert Tonnen zu suchen, die Wassertiefe im Blick zu behalten und
Höhe zu laufen. Fast keine Welle mehr, bisweilen
fünfeinhalb Knoten, kurzweiliges Segeln auf höchstem
Niveau. Gegenan auf langen Strecken und in offenem Wasser ist etwas
völlig anderes als dies hier: Der Bøge
Strøm ist ein Spielplatz, wie geschaffen für
Folkeboote.
Man
weiß es vorher ja nie, aber es läuft:
Viereinhalb bis fünf Knoten, um die 190 Grad, das ist kein
Anlieger, aber ein hübscher Streckbug. Wir sausen unter einem
aufklarenden Himmel südwärts. Der Wind hält,
nach zwei Stunden wenden wir, und kurz darauf ist die Ansteuerungstonne
schon in Sicht. Martha hält mit, Frieda segelt wacker, Oliese
hält sich heute zurück. Perfekt im Zeitplan erreichen
wir in der Nachmittagssonne die geradlinige Baggerinne eingangs des
Bøge Strøm. Jetzt beginnt der kurzweilige Teil
mit einer Kreuz in kurzen Schlägen. Im weiteren Verlauf
mäandriert das Fahrwasser. Zwei Stunden gilt es, voll
konzentriert Tonnen zu suchen, die Wassertiefe im Blick zu behalten und
Höhe zu laufen. Fast keine Welle mehr, bisweilen
fünfeinhalb Knoten, kurzweiliges Segeln auf höchstem
Niveau. Gegenan auf langen Strecken und in offenem Wasser ist etwas
völlig anderes als dies hier: Der Bøge
Strøm ist ein Spielplatz, wie geschaffen für
Folkeboote.
 Und
dann geschieht etwas beinahe Magisches: Wir können
abfallen! Halber Wind, dann raumschots – ich müsste
lange nachdenken, um sagen zu können, wann wir das zuletzt
hatten. Ich spare mir den Spaß, auf die letzte halbe Meile
noch den Fockausbaumer aus der Vorpiek zu zerren. Die Ansteuerung von Nyord ist ein bisschen abenteuerlich:
Keine Betonnung, kein Richtfeuer, aber eine schmale Rinne von hundert
Metern Länge, die mit exakt zehn Grad durchfahren werden muss.
So steht es jedenfalls im Hafenhandbuch des NV-Verlags, das aber bei
vielen besonders idyllischen Häfen vom Anlaufen
abrät. Ich berge punktgenau das Groß und gehe
ungefähr auf diesen Kurs. Der Wind ist auf drei bis vier
runter, fast wie bestellt. Wieder pure Magie: Wir kommen ohne
Grundberührung in den Hafen. Fock runter, fast ein bisschen zu
früh, ich muss tüchtig wriggen, damit Paula im
Seitenwind nicht vertreibt. Der Hafen ist nicht einmal halbvoll
– letztes Jahr um diese Zeit haben wir das bei zwei
Windstärken mehr anders erlebt.
Und
dann geschieht etwas beinahe Magisches: Wir können
abfallen! Halber Wind, dann raumschots – ich müsste
lange nachdenken, um sagen zu können, wann wir das zuletzt
hatten. Ich spare mir den Spaß, auf die letzte halbe Meile
noch den Fockausbaumer aus der Vorpiek zu zerren. Die Ansteuerung von Nyord ist ein bisschen abenteuerlich:
Keine Betonnung, kein Richtfeuer, aber eine schmale Rinne von hundert
Metern Länge, die mit exakt zehn Grad durchfahren werden muss.
So steht es jedenfalls im Hafenhandbuch des NV-Verlags, das aber bei
vielen besonders idyllischen Häfen vom Anlaufen
abrät. Ich berge punktgenau das Groß und gehe
ungefähr auf diesen Kurs. Der Wind ist auf drei bis vier
runter, fast wie bestellt. Wieder pure Magie: Wir kommen ohne
Grundberührung in den Hafen. Fock runter, fast ein bisschen zu
früh, ich muss tüchtig wriggen, damit Paula im
Seitenwind nicht vertreibt. Der Hafen ist nicht einmal halbvoll
– letztes Jahr um diese Zeit haben wir das bei zwei
Windstärken mehr anders erlebt.
 Weil
Hannes es nach dem Anlegen triggert, raunze ich kurz meine
Unzufriedenheit mit der Gruppe heraus, ihrem Zweifel an meiner
Kompetenz, ihrem Hinterfragen all meiner Ideen. Beim Segelpacken ist er
mucksch, dann reicht er mir ein Bier rüber. Wir
stoßen an und haben das für alle Zeiten
geklärt. Frieda und Oli legen an, alles ist toll, und dann
kommt dieser Komiker, ein deutscher Tourist, zu uns und fragt:
„Tschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Haben Sie denn
reserviert?“
Weil
Hannes es nach dem Anlegen triggert, raunze ich kurz meine
Unzufriedenheit mit der Gruppe heraus, ihrem Zweifel an meiner
Kompetenz, ihrem Hinterfragen all meiner Ideen. Beim Segelpacken ist er
mucksch, dann reicht er mir ein Bier rüber. Wir
stoßen an und haben das für alle Zeiten
geklärt. Frieda und Oli legen an, alles ist toll, und dann
kommt dieser Komiker, ein deutscher Tourist, zu uns und fragt:
„Tschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Haben Sie denn
reserviert?“
 Reserviert?
Auf Nyord? Alle Achtung! Ich antworte: „Worum
geht das denn?“ Es ist halb sieben, wer wird heute wohl noch
kommen? Seinem Gestammel und sonstigem Gehabe entnehme ich, dass er
hier eine Ferienwohnung hat und nichts vom Segeln und von
Häfen versteht. Er erwartet aber Freunde, die ihn mit ihrer
Charteryacht besuchen kommen. Er hat zwecks Reservierung den
Hafenmeister angerufen (der den Job nebenbei erledigt und vermutlich
einigermaßen genervt war ob dieses Anliegens. Wenn man das
unbeholfene Englisch vieler deutscher Mittfünfziger kennt,
kann man sich vorstellen, wie die beiden aneinander vorbeigeredet
haben). Jetzt hat er wohl Panik, dass hier dauernd vier Boote aufs Mal
eintreffen und in kürzester Zeit alle Plätze besetzt
sein werden, denn der Hafenmeister hat offenbar (und
vernünftigerweise) nur einen Satz gesagt: "Es gibt noch
freie Plätze." Die Charteryacht läuft ein, doch sie
hat wohl die falsche Box reserviert: Sie bleibt zwischen den
Pfählen stecken. Nebenan passt sie rein, und alle sind
glücklich.
Reserviert?
Auf Nyord? Alle Achtung! Ich antworte: „Worum
geht das denn?“ Es ist halb sieben, wer wird heute wohl noch
kommen? Seinem Gestammel und sonstigem Gehabe entnehme ich, dass er
hier eine Ferienwohnung hat und nichts vom Segeln und von
Häfen versteht. Er erwartet aber Freunde, die ihn mit ihrer
Charteryacht besuchen kommen. Er hat zwecks Reservierung den
Hafenmeister angerufen (der den Job nebenbei erledigt und vermutlich
einigermaßen genervt war ob dieses Anliegens. Wenn man das
unbeholfene Englisch vieler deutscher Mittfünfziger kennt,
kann man sich vorstellen, wie die beiden aneinander vorbeigeredet
haben). Jetzt hat er wohl Panik, dass hier dauernd vier Boote aufs Mal
eintreffen und in kürzester Zeit alle Plätze besetzt
sein werden, denn der Hafenmeister hat offenbar (und
vernünftigerweise) nur einen Satz gesagt: "Es gibt noch
freie Plätze." Die Charteryacht läuft ein, doch sie
hat wohl die falsche Box reserviert: Sie bleibt zwischen den
Pfählen stecken. Nebenan passt sie rein, und alle sind
glücklich.
 Außer
mir: Nachdem alle anderen Probleme behoben sind,
funktioniert immer noch Friedas Außenborder nicht. Er
verliert – Benzin? Motoröl? Getriebeöl?
Außerdem startet er nicht, das Zugseil lässt sich
nicht durchziehen. Ein Fall für Morgen, jetzt erstmal ein Glas
Wein auf den gelungenen Tag. Das Problem ist dann schnell
unter Kontrolle:
Mülltüten drum gegen die Leckage, anschließend Tausch mit
Paulas – wir brauchen nicht so dringend einen
funktionierenden Motor, also transportiert Paula ab heute den kaputten
am Heck. In einer Flaute müssten wir allerdings geschleppt
werden, das lässt sich sicher regeln. Erstmal machen wir bei
West 4 Böen 6-7 einen wunderbaren Hafentag auf Nyord.
Außer
mir: Nachdem alle anderen Probleme behoben sind,
funktioniert immer noch Friedas Außenborder nicht. Er
verliert – Benzin? Motoröl? Getriebeöl?
Außerdem startet er nicht, das Zugseil lässt sich
nicht durchziehen. Ein Fall für Morgen, jetzt erstmal ein Glas
Wein auf den gelungenen Tag. Das Problem ist dann schnell
unter Kontrolle:
Mülltüten drum gegen die Leckage, anschließend Tausch mit
Paulas – wir brauchen nicht so dringend einen
funktionierenden Motor, also transportiert Paula ab heute den kaputten
am Heck. In einer Flaute müssten wir allerdings geschleppt
werden, das lässt sich sicher regeln. Erstmal machen wir bei
West 4 Böen 6-7 einen wunderbaren Hafentag auf Nyord.
 Schönwettersegeln gibt es weiterhin nicht, doch am Mittwoch ist die Böigkeit moderater.
Wir schleichen uns morgens kurz vor acht aus dem Hafen. Der erste
Schauer, die erste fünfer Bö. Der zweite Schauer,
ähnlich. Dazwischen ist es ein ruhiger Anlieger auf die
Brücke bei Kalvehave hin. Die Sonne kommt raus, wir beginnen
zu kreuzen. Rumms, tun wir es bei sowas wie 3-4 Böen 6. Wir
reden von einem kurvenreichen, engen Fahrwasser, zehn Meter Tiefe in
der Mitte, an den Rändern wird es rapide flach. Wichtiger als
die Betonnung ist das Echolot. Immerhin steht hier keine Monsterwelle,
sondern im Schutz der Inseln nur ein niedliches Gekabbel. Trotzdem ist
es Ölzeugwetter bei Sonnenschein. Mit einer Windstärke
weniger wäre es netter – dann wäre auch
Muße, die wundervolle Gegend zu bestaunen, reichlich
Grün und wunderschöne Häuser. Jedenfalls
kommt vor allem Hannes auf seine Kosten: Solche Fahrrinnen gibt es in
der Schweiz nicht, und heute darf man ja wirklich beweisen, ob man
segeln kann. Können alle.
Schönwettersegeln gibt es weiterhin nicht, doch am Mittwoch ist die Böigkeit moderater.
Wir schleichen uns morgens kurz vor acht aus dem Hafen. Der erste
Schauer, die erste fünfer Bö. Der zweite Schauer,
ähnlich. Dazwischen ist es ein ruhiger Anlieger auf die
Brücke bei Kalvehave hin. Die Sonne kommt raus, wir beginnen
zu kreuzen. Rumms, tun wir es bei sowas wie 3-4 Böen 6. Wir
reden von einem kurvenreichen, engen Fahrwasser, zehn Meter Tiefe in
der Mitte, an den Rändern wird es rapide flach. Wichtiger als
die Betonnung ist das Echolot. Immerhin steht hier keine Monsterwelle,
sondern im Schutz der Inseln nur ein niedliches Gekabbel. Trotzdem ist
es Ölzeugwetter bei Sonnenschein. Mit einer Windstärke
weniger wäre es netter – dann wäre auch
Muße, die wundervolle Gegend zu bestaunen, reichlich
Grün und wunderschöne Häuser. Jedenfalls
kommt vor allem Hannes auf seine Kosten: Solche Fahrrinnen gibt es in
der Schweiz nicht, und heute darf man ja wirklich beweisen, ob man
segeln kann. Können alle.
In Vordingborg war ich mit Paula vor ungefähr
fünfzehn Jahren mal. Notgedrungen und zwei regnerische Tage
eingeweht, während des Stadtfests mit Dauerlärm und
Autoscooter am Liegeplatz. Danach habe ich den Ort vermieden
– der durchaus Flair hat mit der Burgruine, gute
Infrastruktur bietet sowie ein tolles Restaurant, in das mich die
Gäste einladen werden.
 Doch
zunächst müssen wir anlegen. Bei Westwind liegt
der Hafen genau in Lee einer Senke an Land – eine
tüchtige Düse. Doch doch, es ist weniger Wind als
draußen, aber die Böigkeit bleibt, und die Option
des Motorens haben wir nicht. Ich bleibe nervenstark, Paula ist
souverän wie immer, irgendwann ist das Tuch unten und wir
treiben an den Längsseitsplatz, den mein siebter Sinn
erspäht hat. Die Hafenmeisterin will uns nochmal woandershin,
hinter die andere Yacht anstatt davor, doch sie hilft kompetent beim
Anlegen und findet es schließlich gut, dass wir dort bleiben und ein Viererpäckchen bilden.
Doch
zunächst müssen wir anlegen. Bei Westwind liegt
der Hafen genau in Lee einer Senke an Land – eine
tüchtige Düse. Doch doch, es ist weniger Wind als
draußen, aber die Böigkeit bleibt, und die Option
des Motorens haben wir nicht. Ich bleibe nervenstark, Paula ist
souverän wie immer, irgendwann ist das Tuch unten und wir
treiben an den Längsseitsplatz, den mein siebter Sinn
erspäht hat. Die Hafenmeisterin will uns nochmal woandershin,
hinter die andere Yacht anstatt davor, doch sie hilft kompetent beim
Anlegen und findet es schließlich gut, dass wir dort bleiben und ein Viererpäckchen bilden.
 Vierzehn
Meilen waren das nur – ich bin total geschafft. Mit
letzter Kraft schleppe ich mich zum Supermarkt. Dann studiere ich den
Wetterbericht: Morgen ist der große Tag! Der vorletzte
Reisetag muss (!!) uns ein Viertel der Gesamtstrecke bescheren.
Südwest vier Böen fünf, süddrehend
– das klingt wie ein Traum von einer fernen, anderen Welt,
als ich sie in den letzten zehn Tagen erlebt habe. Aber nein, wir
bekommen es nicht wie bestellt. Wir können nicht beliebig
früh los, der Tag beginnt mit West 6-7, das müssen
wir abwarten und uns sicher danach noch an der alten Welle abarbeiten.
Und vor dem Dreher auf Süd sind je nach Position bis zu drei
Stunden Flaute vorhergesagt – es wird also lang, zäh
und anstrengend. Prognose für Freitag: Null Wind. Susanne
fragt, ob wir nicht notfalls in Omø bleiben können.
Ich antworte: "Von da reicht der Sprit nicht."
Vierzehn
Meilen waren das nur – ich bin total geschafft. Mit
letzter Kraft schleppe ich mich zum Supermarkt. Dann studiere ich den
Wetterbericht: Morgen ist der große Tag! Der vorletzte
Reisetag muss (!!) uns ein Viertel der Gesamtstrecke bescheren.
Südwest vier Böen fünf, süddrehend
– das klingt wie ein Traum von einer fernen, anderen Welt,
als ich sie in den letzten zehn Tagen erlebt habe. Aber nein, wir
bekommen es nicht wie bestellt. Wir können nicht beliebig
früh los, der Tag beginnt mit West 6-7, das müssen
wir abwarten und uns sicher danach noch an der alten Welle abarbeiten.
Und vor dem Dreher auf Süd sind je nach Position bis zu drei
Stunden Flaute vorhergesagt – es wird also lang, zäh
und anstrengend. Prognose für Freitag: Null Wind. Susanne
fragt, ob wir nicht notfalls in Omø bleiben können.
Ich antworte: "Von da reicht der Sprit nicht."
 Um
sechs Uhr pfeifen grimmige Böen durch den Hafen. Auslaufen
um sieben? Wir verschieben es um eine halbe Stunde, dann legt Oli doch
schon um Viertel nach ab. Und wie soll man sagen? Als wir die
Størstrøm Bro und ihre Turbulenzen erstmal
hinter uns haben, läuft es mit fünf bis
fünfeinhalb Knoten. Vor uns kneifen die Charterboote
beträchtlich Höhe. Ich habe dazu keine Lust. Der Wind
dreht von Westsüdwest auf Südwest, dann nochmal auf
Westsüdwest, wir wählen einen nördlicheren
Kurs als ursprünglich geplant. Während die
Charterboote südlich von Omø durchgehen, verlieren wir sie
aus den Augen und landen im Sund zwischen Omø und
Agersø. Die Strömung läuft mit, wir fliegen mit
sieben Knoten durch. Dann
bekommen wir den Südwind. Erheblicher Seegang im Store Belt,
dichter Schiffsverkehr auf dem Tiefwasserweg, aber wir passen genau
hindurch. An der Nordspitze von Langeland treffen wir uns alle wieder
– ich bin nicht überrascht, es sind ja Schwestern.
Um
sechs Uhr pfeifen grimmige Böen durch den Hafen. Auslaufen
um sieben? Wir verschieben es um eine halbe Stunde, dann legt Oli doch
schon um Viertel nach ab. Und wie soll man sagen? Als wir die
Størstrøm Bro und ihre Turbulenzen erstmal
hinter uns haben, läuft es mit fünf bis
fünfeinhalb Knoten. Vor uns kneifen die Charterboote
beträchtlich Höhe. Ich habe dazu keine Lust. Der Wind
dreht von Westsüdwest auf Südwest, dann nochmal auf
Westsüdwest, wir wählen einen nördlicheren
Kurs als ursprünglich geplant. Während die
Charterboote südlich von Omø durchgehen, verlieren wir sie
aus den Augen und landen im Sund zwischen Omø und
Agersø. Die Strömung läuft mit, wir fliegen mit
sieben Knoten durch. Dann
bekommen wir den Südwind. Erheblicher Seegang im Store Belt,
dichter Schiffsverkehr auf dem Tiefwasserweg, aber wir passen genau
hindurch. An der Nordspitze von Langeland treffen wir uns alle wieder
– ich bin nicht überrascht, es sind ja Schwestern.
 Das
letzte Stück müssen wir aber doch noch kreuzen.
Der Wind schwächelt, kommt wieder, schwächelt erneut
- ist jetzt alles egal, Lohals ist in Sicht, und es ist noch
früh an einem glorreichen Tag. Auf dem langgezogenen Flach
zwischen Langeland und Fyn glaube ich zuerst eine Yacht in voller
Schräglage zu sehen, wo doch gerade kaum Wind ist. Doch nein:
Die Yacht ist gestrandet und gesunken - ich habe es eilig mit der
nächsten Wende.
Das
letzte Stück müssen wir aber doch noch kreuzen.
Der Wind schwächelt, kommt wieder, schwächelt erneut
- ist jetzt alles egal, Lohals ist in Sicht, und es ist noch
früh an einem glorreichen Tag. Auf dem langgezogenen Flach
zwischen Langeland und Fyn glaube ich zuerst eine Yacht in voller
Schräglage zu sehen, wo doch gerade kaum Wind ist. Doch nein:
Die Yacht ist gestrandet und gesunken - ich habe es eilig mit der
nächsten Wende.
 Weil
der Wind gerade wieder auf vier zunimmt, ist das Einlaufen und
Anlegen ohne Motor in Lohals etwas für Fortgeschrittene. Wir
fliegen erstmal eine Platzrunde. Die Erkundung ergibt: Martha und Oli
sind schon drin, haben Plätze gefunden, da passen wir sicher
auch noch hin. Nur mit der Fock kommen wir nicht durch die Einfahrt, im
Hafen kriegen wir das Groß nicht runter. Also erstmal wieder
raus. Und dann berge ich das Groß einfach in der Einfahrt.
Habe ich so noch nie gemacht, aber natürlich geht das wunderbar.
Wir treiben an den Pfählen entlang, ich umarme einen oder zwei
von ihnen, um Fahrt abzubauen, dann puzzeln wir uns in die Puzzleecke
zu Martha. Sieht, glaube ich, recht souverän aus, und ich bin
auch gut zufrieden. Den Ernstfall des Motorausfalls haben wir jetzt
lange genug geübt. Bernd wiederum wirkt ganz
glücklich mit Paulas tapferem Mercury an Friedas Heck.
Weil
der Wind gerade wieder auf vier zunimmt, ist das Einlaufen und
Anlegen ohne Motor in Lohals etwas für Fortgeschrittene. Wir
fliegen erstmal eine Platzrunde. Die Erkundung ergibt: Martha und Oli
sind schon drin, haben Plätze gefunden, da passen wir sicher
auch noch hin. Nur mit der Fock kommen wir nicht durch die Einfahrt, im
Hafen kriegen wir das Groß nicht runter. Also erstmal wieder
raus. Und dann berge ich das Groß einfach in der Einfahrt.
Habe ich so noch nie gemacht, aber natürlich geht das wunderbar.
Wir treiben an den Pfählen entlang, ich umarme einen oder zwei
von ihnen, um Fahrt abzubauen, dann puzzeln wir uns in die Puzzleecke
zu Martha. Sieht, glaube ich, recht souverän aus, und ich bin
auch gut zufrieden. Den Ernstfall des Motorausfalls haben wir jetzt
lange genug geübt. Bernd wiederum wirkt ganz
glücklich mit Paulas tapferem Mercury an Friedas Heck.
 Natürlich
lassen wir beim Stegbier den Tag und die gesamte
Reise Revue passieren. Wir stellen fest: Die vielen Hafentage waren
kein Verlust, sondern eine Bereicherung. Die Segeltage auch. Wir haben
es geschafft. „Gratuliere“, sagt Hannes beim
Anstoßen. Und er hat Recht: Jeder Segeltag stellt uns vor
eine Aufgabe. Wenn wir das Ziel erreichen, haben wir sie
bewältigt. Und dazu darf man einander durchaus mal
gratulieren, gerade wenn es nicht ganz so einfach war.
Natürlich
lassen wir beim Stegbier den Tag und die gesamte
Reise Revue passieren. Wir stellen fest: Die vielen Hafentage waren
kein Verlust, sondern eine Bereicherung. Die Segeltage auch. Wir haben
es geschafft. „Gratuliere“, sagt Hannes beim
Anstoßen. Und er hat Recht: Jeder Segeltag stellt uns vor
eine Aufgabe. Wenn wir das Ziel erreichen, haben wir sie
bewältigt. Und dazu darf man einander durchaus mal
gratulieren, gerade wenn es nicht ganz so einfach war.
 Freitagmorgen
kurz nach sechs: Kein Lüftchen regt sich, die
Verklicker zeigen in beliebige Richtungen. Fyn ist im Dunst nicht zu
erkennen, als sich die Sonne über Langeland erhebt. Aber da
ist ein dunkler Streifen im Wasser: Gekräusel! Ich habe den
Kaffeebecher noch nicht leer, als Wind aufkommt, eine tolle
Morgenbrise. Aber ich muss noch zum Klo, Zähneputzen,
Aufklaren, Segel auspacken…wir versäumen einen
guten Teil von ihr. An einem flautigen Tag darf man den Wind nicht
vergeuden! Zwanzig nach sieben segelt Paula aus dem Hafen.
Freitagmorgen
kurz nach sechs: Kein Lüftchen regt sich, die
Verklicker zeigen in beliebige Richtungen. Fyn ist im Dunst nicht zu
erkennen, als sich die Sonne über Langeland erhebt. Aber da
ist ein dunkler Streifen im Wasser: Gekräusel! Ich habe den
Kaffeebecher noch nicht leer, als Wind aufkommt, eine tolle
Morgenbrise. Aber ich muss noch zum Klo, Zähneputzen,
Aufklaren, Segel auspacken…wir versäumen einen
guten Teil von ihr. An einem flautigen Tag darf man den Wind nicht
vergeuden! Zwanzig nach sieben segelt Paula aus dem Hafen.
 Wir
segeln die ersten sechs Meilen mit guten vier Knoten. Treiben die
nächsten fünf in der Strömung. Den Rest
können wir wieder schön segeln, im T-Shirt statt mit
Strickpullover und Ölzeug, und weil der Wind beharrlich mitdreht, steht bis kurz vor Thurø der Fockausbaumer. Wir
gruppieren uns um den Badeponton, badefreudigen Gästen zur
Freude, und abends entwickelt sich dort eine letzte Stegparty. Ja, man hat
uns eine Aufgabe gestellt, und wir haben sie bewältigt. Wir
haben aber noch enorm viel mehr geschafft: Es ging ja nicht nur darum,
die Boote zurückzusegeln, sondern wir wollten auch den
Gästen etwas bieten, sie zufriedenstellen, sie positiv
überraschen und – zumindest im Fall der Schweizer
– von den Vorzügen der Ostsee als Segelrevier
überzeugen. Dass das bei widrigsten Bedingungen voll und ganz
gelungen ist, darauf bin ich ein bisschen stolz.
Wir
segeln die ersten sechs Meilen mit guten vier Knoten. Treiben die
nächsten fünf in der Strömung. Den Rest
können wir wieder schön segeln, im T-Shirt statt mit
Strickpullover und Ölzeug, und weil der Wind beharrlich mitdreht, steht bis kurz vor Thurø der Fockausbaumer. Wir
gruppieren uns um den Badeponton, badefreudigen Gästen zur
Freude, und abends entwickelt sich dort eine letzte Stegparty. Ja, man hat
uns eine Aufgabe gestellt, und wir haben sie bewältigt. Wir
haben aber noch enorm viel mehr geschafft: Es ging ja nicht nur darum,
die Boote zurückzusegeln, sondern wir wollten auch den
Gästen etwas bieten, sie zufriedenstellen, sie positiv
überraschen und – zumindest im Fall der Schweizer
– von den Vorzügen der Ostsee als Segelrevier
überzeugen. Dass das bei widrigsten Bedingungen voll und ganz
gelungen ist, darauf bin ich ein bisschen stolz.
weiter: Sturmtief "Hans", der kürzeste Segelschlag
überhaupt und die weltbeste Passagierin
zurück: Nüsschenabend

